(openPR) i. WM-Jahr 2006 bringt womöglich den Durchbruch für den M-Commerce und M-Gambling in Deutschland
ii. Hambach & Hambach erwirkt Entscheidung vor Baden-Württembergischem Verwaltungsgerichtshof
iii. Holländisches Gericht befindet das Casinomonopol Hollands als unvereinbar mit dem Vertrag von Rom
iv. Recht des E-Commerce als Vertrauensbildende Maßnahme?
v. In eigener Sache
vi. Zu guter Letzt
vii. Impressum
i. WM-Jahr 2006 bringt womöglich den Durchbruch für den M-Commerce und M-Gambling in Deutschland
Da stellt sich die Frage: Neue Technik, altes Recht?
Ein Bericht von RA Dr. Wulf Hambach und RA Dr. Hendrik Schöttle, Hambach & Hambach
Vor gar nicht allzu langer Zeit eroberte der Handel den Cyberspace. Vor gerade einmal 10 Jahren gingen auch die ersten reinen Glücksspielangebote online. Seit Neuestem formt sich neben dem E-Commerce bzw. dem E-Gaming der M-Commerce bzw. das M-Gambling aus.
Mit fortschreitender technologischer Entwicklung mobiler Geräte wie PDAs, Handhelds oder Smartphones scheint der M-Commerce noch einmal eine zweite Chance zu bekommen. Nachdem sich der Internet- und Mobilfunk-Hype Anfang des Jahrzehnts gelegt hat und einige hochgejubelte Technologien wie WAP oder UMTS sich nicht über einen Nischenmarkt hinaus entwickeln konnten, scheint es jetzt wieder an der Zeit, sich diesen Markt näher anzusehen.
J2ME, die Java-Plattform für mobile Geräte, stellt eine wachsende Basis für Java-Anwendungen auf Handys, PDAs und Smartphones & Co. dar. Symbian OS, ein Betriebssystem für Handys, kann aufgrund seiner modellübergreifenden Verfügbarkeit schon als Standard angesehen werden. Es gibt noch eine Reihe weiterer Entwicklungen, die alle dafür gesorgt haben, dass das Erstellen auch von anspruchsvollen Software-Anwendungen für mobile Geräte nicht mehr allein Sache des Herstellers ist, sondern plattformübergreifend auch durch Externe angeboten werden kann. Die Geräte, die solche Standards unterstützen, sind immer mehr verbreitet, so dass der M-Commerce nicht mehr nur eine Frage technischer Machbarkeit ist, sondern inzwischen als neuer und wachsender Markt darauf wartet, erschlossen zu werden.
Die Vorteile des M-Commerce gegenüber internetgestütztem Handel liegen auf der Hand: Die Angebote sind überall verfügbar, vor allem dann, wenn gerade kein Internetanschluss in der Nähe ist. Zudem wird das Marktsegment erschlossen, das nicht über einen Internetzugang verfügt, wohl aber über ein Mobiltelefon.
Allerdings: der M-Commerce ist – wie das Internet – kein rechtsfreier Raum. Man mag darüber streiten, ob M-Commerce ein neues Medium ist. Aber wie so oft finden Gesetze Anwendung, die etwas anderes im Visier hatten, als sie erlassen wurden.
Denn viele der Regelungen, die für den mobilen Handel gelten, sind auf Internet-Sachverhalte zugeschnitten. Etwa das Fernabsatzrecht oder die Vorschriften über Teledienste (Teledienstegesetz und Teledienstedatenschutzgesetz). Schwierigkeiten bereiten dabei insbesondere die umfangreichen Hinweis- und Informationspflichten. Auf einer normalen Website lassen sich auch umfangreiche Belehrungen noch übersichtlich darstellen. Einwilligungserklärungen können ohne große zeitliche Verzögerung vom Kunden im Browser abgegeben und per E-Mail bestätigt werden. Aber wie lässt sich eine vollständige Anbieterkennzeichnung in einer SMS unterbringen? Wie kann eine Einwilligungserklärung datenschutzkonform umgesetzt werden? Muss ein Nutzer zur datenschutzrechtlichen Einwilligung eine aufgebaute GSM-Verbindung beenden, auf eine SMS warten und diese beantworten, bevor er ein Angebot nutzen kann? Wie sieht es mit den Anforderungen der Rechtsprechung aus, einen Link zur Anbieterkennzeichnung auf der ersten Bildschirmseite anzuzeigen – gilt dies auch bei einer Bildschirmauflösung von 128x128 Pixeln, wie sie bei Mobiltelefonen üblich ist?
Es ist klar, dass die Anwendung der genannten Regelungen Probleme mit sich bringt. Manche „best practices“ können aus der Welt des Internetrechts ohne Änderungen übernommen werden; andere Regelungen sind kaum ohne Anpassung denkbar. Noch ist es wohl zu früh, um eine Prognose zu wagen, welche Anforderungen die Rechtsprechung an rechtskonforme Angebote stellen wird. Eines kann allerdings jetzt schon vorhergesagt werden: Mit zunehmender Bedeutung des M-Commerce wird auch der Konkurrenzdruck steigen. Das wiederum wird die (oft nur vermeintlichen) Hüter des Wettbewerbsrechts auf den Plan rufen; mit anderen Worten: die rechtliche Unbedenklichkeit von E-Commerce-Anwendungen wird nicht nur ein Aushängeschild für den potenziellen Kunden, sondern auch ein Schutzschild gegen unberechtigte und kostspielige Abmahnungen sein.
Der Marktplatz des M-Commerce bietet unter dem Stichwort „mobile gaming“ auch dem Online-Spiele-Markt interessante Perspektiven. Sportwetten lassen sich über mobile Geräte dorthin tragen, wo das Ereignis stattfindet , aber kein Internetanschluss zur Verfügung steht – in Stadien, Kneipen und auch im Wohnzimmer. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt – sowohl auf der Seite der Anbieter als auch auf der Nutzerseite – auf diese Möglichkeiten reagiert.
Leider existiert in Deutschland kein einheitliches Regelungswerk, wie etwa die britische Gambling Bill 2005, die dieses Jahr in Kraft getreten ist und die ausführliche Regelungen zum remote gambling enthält. Es wäre verfehlt, an dieser Stelle eine weitere gesetzliche Regelung in Deutschland zu fordern, da das Regelungsdickicht des Verbraucherschutzes im E-Commerce und im M-Commerce bereits hinreichend unübersichtlich ist. Zumindest aber wäre es wünschenswert, wenn die Rechtsprechung eindeutige Anforderungen an Anbieter im M-Commerce herausarbeiten würde – auch wenn dies bei der widersprüchlichen und verworrenen Gesetzeslage alles andere als einfach ist.
Im M-Commerce bzw. M-Gambling Bereich stehen den rechtlichen Unsicherheitsfaktoren klare Wachstumsprognosen gegenüber. Anfang 2005 veröffentlichte das britische Marktforschungsinstitut Juniper Research, dass vor allem der europäische Markt der mobilen Sportwetten sehr stark wachsen wird. So soll der Umsatz von 110 Mio. Dollar im Jahr 2004 auf drei Mrd. Dollar im Jahre 2009 steigen. Weltweit prognostiziert Juniper Research, dass sich die Umsätze mit mobilen Services wie Lotterien, Sportwetten und Casino-Spielen im Vergleich zu 2005 (2 Mrd. Dollar) bis 2009 auf 19,3 Mrd. Dollar fast verzehnfachen. Auch die auf den Sektor neue Medien spezialisierte britische Unternehmensberatung Informa Telecoms & Media (ITM) erklärt den europäischen M-Betting Markt zum Wachstumsmarkt – alleine der europäische mobile Sportwettenmarkt soll jährlich um sage und schreibe 140 % wachsen. Im Jahr 2010 sollen etwa 200 Mio. Wettbegeisterte zum Wetten zu Ihrem Handy greifen.
Diese Zahlen kennen offensichtlich auch die staatlichen Glücksspielanbieter in Deutschland: Am 16. Dezember 2005 lief die Meldung über den Ticker, dass der staatliche Glücksspielanbieter Toto-Lotto Niedersachsen seit neuestem mit dem privaten Anbieter für mobile Mehrwertdienste net mobile AG kooperiert, um „sukzessiv die Angebotspalette mobiler Wetten auszubauen“. Angesichts der möglicherweise bevorstehenden Liberalisierung des deutschen Glücksspielmarktes wollen es sich die staatlichen Glücksspielanbieter offensichtlich nicht nehmen lassen, noch rechtzeitig zukunftsträchtige Marktsegmente zu besetzen.
Fazit: Wer sich auf dem M-Commerce- bzw. M-Gambling-Markt mittelfristige Marktchancen sichern will, sollte dort jetzt bereits Fuß fassen. Er muss sich aber – jetzt, wie später – vor tückischen und letztlich teuren juristischen Fallstricken hüten, die immer dann drohen, wenn das Recht aktuellen technischen Entwicklungen hinterherhinkt.
ii. Hambach & Hambach erwirkt Entscheidung vor Baden-Württembergischem Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württembergisches Ordnungsamt erleidet erneute Schlappe – dieses Mal vor dem VGH Mannheim (Az. 6 S 1947/05). Wenn es um Sportwetten geht, greifen die Ordungsbehörden bekanntlich hart durch – leider ohne Rücksicht auf Recht und Ordnung
Ein Bericht von RA Dr. Wulf Hambach und RA Claus Hambach
Private Sportwettenvermittler, die Sportwetten an Veranstalter aus dem EG-Ausland vermitteln, sind dem Staat schon seit längerem ein Dorn im Auge. Denn sie machen dem staatlichen Sportwettenanbieter ODDSET Konkurrenz und berufen sich dabei auf ihre Grundrechte und die europarechtlich garantierte Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Die Ordnungsbehörden stehen in ihrem Kampf gegen die private Konkurrenz aber zunehmend auf verlorenen Posten. Grund hierfür sind zahlreiche Entscheidungen zugunsten der privaten Betreiber vor allem vor den Verwaltungsgerichten und den Strafgerichten. Zudem forderte das Bundesverfassungsgericht bereits zahlreiche Behörden auf, im Vorfeld seiner Anfang 2006 erwarteten Grundsatzentscheidung keine Vollstreckungsma?nahmen gegen die Sportwettenvermittler zu ergreifen.
Die Ordnungsbehörden wenden sich darum nun verstärkt dem klassischen Ordnungsrecht zu, wie z.B. bauordnungsrechtlichen Bestimmungen oder den Lebensmittelhygiene-/ Zusatzstoffzulassungs- und Preisabgabenverordnungen. Beispielhaft ist hier das skandalöse Vorgehen des Ordnungsamtes Heilbronn gegen in ihrem Zuständigkeitsbereich liegende Gastronomen zu nennen. Das Amt entzog einem baden-württembergischen Gaststättenbetreiber die Gaststättenlizenz und forderte ihn auf, sein Lokal zu schließen. Begründet wurde die Entscheidung ausschließlich damit, dass er in der Vergangenheit Sportwetten vermittelt habe. Die Entscheidung wurde für sofort vollziehbar erklärt (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO). Gegen den Verwaltungsakt legte die Kanzlei Hambach & Hambach namens des Gaststättenbetreibers Widerspruch ein und beantragte vor dem Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherzustellen.
Da das Ordnungsamt offenbar befürchtete, dass dies zur Begründung des Sofortvollzuges nicht ausreichen würde, trug es im laufenden Verfahren weitere (nicht sportwettenrechtliche) Gründe vor, die eine Entziehung der Gaststättenerlaubnis rechtfertigen sollten, wie z.B. ein fehlendes Gasmagnetventil sowie eine fehlende Sicherungsvorrichtung für einen CO2-Behälter im Lagerraum etc.. Zur Beseitigung dieser Mängel wurde dem Gaststättenbetreiber eine Frist zur Beseitigung dieser Mängel gesetzt. Noch vor Ablauf dieser Frist entschied jedoch das VG Stuttgart, dass es eine Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ablehne (Az. 15 K 1563/05).
Der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hob nunmehr den Beschluss des VG Stuttgart auf. Der VGH trug insbesondere vor, dass seitens des Gastonoms ausreichende Gründe vorgetragen wurden, die eine besondere Gefahr durch den Gaststättenbetrieb bis zum Abschluss des Hauptverfahrens ausräumen. Eine Einstellung der Gaststätte bis zum Abschluss des Hauptverfahrens schien dem VGH entgegen der Vorinstanz und dem Vortrag der Ordnungsbehörde als nicht geboten. Der Grund: Die Einstellung der Gaststätte hätte einen zu schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfreiheit des Gaststättenbetreibers bedeutet.
Fazit: Bereits in der von der Kanzlei Hambach & Hambach erwirkten Entscheidung vom 8. September 2005 (vgl. Betting-Law-News 7/05) wurde der Ordnungsbehörde Heilbronn gerichtlich aufgegeben, künftig die sofortige Schließung von Wettbüros nur noch unter Nachweises konkreter Gefahren für das Allgemeinwohl sofort vollziehbar zu schließen. Wenn die Ordnungsbehörden nun meinen, einfach auf andere – nicht sportwettenrechtliche – Gefahren ohne nähere Prüfung ausweichen zu können, so wird dieses geradezu plumpe Vorgehen einer gerichtlichen Überprüfung kaum standhalten können.
iii. Holländisches Gericht befindet das Casinomonopol Hollands als unvereinbar mit dem Vertrag von Rom
Europäische Kommission lässt erkennen, das es den vorgeschlagene Entwurf zum holländischen Internet gaming Monopol für unverhältnismäßig hält.
Entscheidung vom 02.12.2005 CFR gegen den holländischen Staat
Ein Gastkommentar des holländischen Rechtsanwalts Justin Franssen, Van Mens & Wisselink/Amsterdam
Nach der Hauptverhandlung vom 2.12.2005 traf das Verwaltungsgericht von Breda eine grundlegende Post-Gambelli-Entscheidung in dem strittigen Verfahren zwischen der Compagnie Financière Régionale B.V. (nachfolgend: „CFR“) und dem Justizministerium sowie dem Wirtschaftsministerium der Niederlande (nachfolgend: „Staat“). Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Breda kann als nichts geringeres angesehen werden, als ein historischer Sieg der Verfechter der Prinzipien des Vertrages von Rom, insbesondere der Artikel 43 und 49 des EG-Vertrages. Nachdem verschiedene holländische Gerichte im Rahmen einstweiliger Verfahren sowie in einem Hauptsacheverfahren zu dem Ergebnis gekommen waren, dass die holländische Gesetzgebung zum Spielerecht und die dahinter stehende Politik mit den sog. Gambelli-Kriterien in Sachen grenzüberschreitendem Internet-Gambling zu vereinbaren sei, entschied das Verwaltungsgericht Breda nun, dass das staatliche Monopol auf (Casino) Spiele unwirksam sei. Einer der Hauptgründe: Es seien keine klaren Beweise dafür substantiiert vorgebracht worden, dass die restriktive Gesetzgebung in Bezug auf Casinos kohärent, also widerspruchsfrei und konsistent sei.
Zum Fall: Die CFR hatte eine Lizenz beantragt, um in dem holländischen Bezirk von Bergen op Zoom ein Kasino betreiben zu können. Mitte 2003 wurde dieser Antrag unter Hinweis auf das niederländische staatliche Glücksspielmonopol abgelehnt. So betreibt der niederländische Staat mit der Gesellschaft „Holland Casino“ 12 Casinos in den Niederlanden. Außerdem berief sich der Staat auf die Rechtsprechung des EuGH und schlussfolgerte, dass die Politik restriktiver Lizenzvergaben mit dieser europarechtlichen Rechtsprechung übereinstimme.
Daraufhin legte CFR Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht gegen diese Entscheidung des Staates ein und es kam zu einer ersten Anhörung am 29.9.2004. Nach dieser Anhörung wurde das Verfahren vor dem zuständigen Gericht am 21.12.2004 fortgeführt und dem Staat eine Reihe weiterer Fragen diesbezüglich gestellt. Der Staat reichte daraufhin am 4.2.2005 eine schriftliche Stellungnahme ein, auf die CFR mit Schreiben vom 31.3.2005 reagierte.
CFR begründete seine Position damit, dass das restriktive Kasinomonopol gegen die Prinzipien des EuGH aus der Gambelli-Entscheidung verstößt, in welchem der EuGH seinen Standpunkt hinsichtlich des Verhältnismäßigkeitsprinzips untermauerte und in der der EuGH den Nachweis sachlicher Tatsachen zum substantiierten konsistenten und kohärenten Vortrag hinsichtlich der Spielpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten verlangte, soweit diese die Grundfreiheiten einschränkten, wie sie im Vertrag von Rom festgeschrieben sind.
Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Mitgliedsstaaten grundsätzlich ein weiter Ermessensrahmen zusteht. Dies gelte insbesondere in Bezug auf die Regulierung ihrer entsprechenden Spielmärkte. Diese Restriktionen mussten allerdings kohärent und konsistent sein und durch anwendungsvorrangige Prinzipien, wie das Allgemeininteresse, Betrugsbekämpfung und Spielerschutz gerechtfertigt sein. Der Staat führt in seiner Begründung aus, dass das Casinomonopol notwendig sei und es dem Staat ermöglichen müsse, unmittelbar zu handeln und das Verhalten von „Holland Casino“ zu kontrollieren.
Das Gericht respektiert zwar diese Sicht der Dinge, allerdings nimmt es gleichzeitig Bezug auf den sog. „Geeignetheits-Test“, wie er in Abs. 66 und 67 der Gambelli-Entscheidung als ausdrückliche, weitere Voraussetzung vom EuGH festgelegt wurde. Anders als alle anderen vorangegangenen Post-Gambelli-Entscheidungen der holländischen Gerichte schlussfolgert das Verwaltungsgericht Breda aus dieser Rechtsprechung des EuGH, dass eine grundlegende Überprüfung der äußeren Umstände stattfinden müsse.
Auf Nachfrage des Gerichts hat sich der Staat auf den Standpunkt gestellt, dass er nicht für das ausufernde Marketingbudget des staatlichen Veranstalters verantwortlich gemacht werden könne. Das Gericht sieht in dieser Begründung allerdings einen klaren Widerspruch zum Auftrag des Staates, durch ein legales Monopol eine größtmögliche und effektive Kontrolle der Aktivitäten des staatlichen Betreibers „Holland Casino“ zu gewährleisten. Das Gericht ist sogar der Auffassung, dass der Staat zur Rechenschaft gezogen werden könne, dass er nicht in die intensiven Marketing-Kampagnen von „Holland Casino“ eingegriffen habe. Der Staat toleriere die Tatsache, dass holländische Verbraucher noch weiter dazu angeregt und ermutigt werden, an Casinospielen teilzunehmen.
Weiter entschied das Gericht, dass die Politik des Staates eher kontraproduktiv sei und auch kein Beweis seitens des Staates dafür angebracht worden sei, dass die staatlichen Ziele tatsächlich verfolgt würden. Zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts sei noch nicht einmal eine verlässliche oder jüngere Studie zur Spielsucht erhältlich gewesen.
Darüber hinaus nimmt das Gericht die Pläne des Staates, das Angebot von „Holland Casino“ noch um zwei weitere Lizenzen auszuweiten, eher kritisch zur Kenntnis, nachdem Forschungen klar ergeben hätten, dass eine Expansion des legalen Casinoangebots einen Effekt auf die Eindämmung illegaler Angebote haben könnte („Substitutiveffekt“). Des Weiteren führt der Staat in seiner Begründung an, dass eine Ausweitung des staatlichen Angebots von „Holland Casino“ keine wesentliche Auswirkung auf das Wachstum von Problemspielern habe. Diesbezüglich betont das Gericht, dass eine derartige Begründung vielmehr auf Annahmen beruhe und dies in keiner Weise durch Tatsachen belegt sei.
Das Gericht schlussfolgert, dass das restriktive Casinomonopol nicht mit den Grundsätzen der Übereinstimmung und Kohärenz zu vereinbaren sei, wie sie in der Gambelli-Entscheidung festgelegt wurden. Das Monopol laufe zudem den administrativen Entscheidungen von Holland zuwider und gab dem Staat daher auf, seine Entscheidung vollständig zu überarbeiten. Sollte der Staat bei dieser neuen Entscheidung weiterhin nicht in der Lage sein, die Einhaltung der staatlichen Zielsetzung mit Fakten zu belegen, dann wird das Gericht das Casinomonopol für europarechtswidrig – also als Verstoß gegen Art. 49 (Dienstleistungsfreiheit) des EG-Vertrages – erklären.
Schlussfolgerung
Holland scheint der nächste Staat zu sein, in dem offensichtlich die Post-Gambelli- Rechtsprechung revidiert werden muss, wie schon zuvor in den Mitgliedsstaaten Italien und Deutschland. Der Autor hält ein Handeln auf europarechtlicher Ebene für notwendig, um die Situation zu klären. Die Entscheidung, Glücksspiele nicht in die Dienstleistungsrechtlinie aufzunehmen, vermochte den fortwährenden Konflikt zwischen der Post-Gambelli-Rechtsprechung in den verschiedenen nationalen Gerichten nicht zu beseitigen. Vielmehr sollte die Europäische Kommission fortfahren, sich mit der Glücksspielproblematik der Vertragsverletzungsverfahren gegen Holland und die übrigen Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn und Italien zu beschäftigen. Nach Ansicht des Autors könnte diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die anhängigen Zivil- und Verwaltungsverfahren haben, die die Legalität von grenzüberschreitenden Internetspielanbietern zum Gegenstand haben. Auch auf die von Wettanbietern aus England angestrengten Verfahren, die sich mit der diskriminierenden Verteilung der (exklusiven) holländischen Spiellizenzen beschäftigen, dürfte diese Entscheidung Auswirkungen haben.
Die Europäische Kommission bringt ihre heftige Kritik zum vorgeschlagenen Internet Glücksspielmonopol für „Holland Casino“ zum Ausdruck:
Vor kurzem wurde ein Gesetzesentwurf zum Dutch Gaming Acts von 1964 beim Parlament eingereicht. Dieser Gesetzesentwurf sieht in Bezug auf Glücksspiele Änderungen im Dutch Gaming Act 1964 vor, und enthält vorübergehende Regelungen der Glücksspielveranstaltung via Internet. Letztendlich beabsichtigt das Justizministerium, „Holland Casino“ eine dreijährige Lizenz zum exklusiven Betrieb von interaktiven Glücksspielen zu gewähren.
Dieser Gesetzesentwurf sah sich sowohl der Kritik seitens der privaten Spielautomatenindustrie als auch seitens des Staatsrats („Raad van State“) – vergleichbar einem Fachbeirat zur Gesetzgebung – ausgesetzt, ebenso wie einer ernsthaften und grundlegenden Kritik seitens der Europäischen Kommission.
Zunächst machten die Anbieter privater Spielautomaten ihren Bedenken und ihrem Ärger Luft. Sie argumentierten, dass das Justizministerium ihnen (den Automatenaufstellern) eine ähnliche vorübergehende Internet Gaming Lizenz versprochen habe, wie sie nun „Holland Casino“ ausgestellt werden soll. Die Industrie der Automatenaufsteller vertritt die Ansicht, dass das Justizministerium diese Versprechungen nur abgegeben habe, um die Vorteile des Erstauftritts auf dem Markt zu sichern. Dies sei ein unfairer Wettbewerb. Bis dato bleibt abzuwarten, ob die von der Industrie initiierten Vertragsverletzungsverfahren, die jeweiligen Minister tatsächlich dazu zwingt, ihr geplantes Monopol für „Holland Casino“ zu überarbeiten und zu prüfen, ob das Parlament tatsächlich hinter dem Gesetz steht, wenn es darüber im Jahre 2006 zur Abstimmung kommt.
Im Hinblick auf einige europarechtliche Fragestellungen im Rahmen seiner Ratschläge zu dieser Gesetzgebung, gab der Staatsrat seinen Bedenken Ausdruck. Angesichts des Verhältnismäßigkeitsprinzips kommt der Rat zu dem Ergebnis, dass die Begrenzung auf einen einzigen Anbieter überdacht werden müsse. In einem Erklärungsschreiben legte der Gesetzgeber dar, dass die Rechtfertigung für die Wahl eines Monopols unter der Führung von „Holland Casino“ eine striktere Kontrolle ermögliche, da es sich bei „Holland Casino“ um einen anerkannten staatlichen Anbieter handele. Dieser weise Erfahrungen im Spielerschutz sowie dem Schutz vor Missbrauch auf. Der Staatsrat stellt fest, dass es ebenso möglich sei, dass andere Anbieter, sowohl ausländische als auch inländische, diese Voraussetzungen erfüllen können. Der Staatsrat stellte zudem die Frage, ob die Begrenzung auf einen einzelnen (holländischen) Anbieter mit einer exklusiven Lizenz nicht zu einer Verletzung der Rechte anderer angesehener EU-Betreiber führen könnte und damit nicht ein Verstoß gegen die Prinzipien des Art. 49 EG-Vertrages vorliegen würden.
Die Europäische Kommission ist in ihrer Kritik – der Richtlinie 98/48/EC folgend – noch wesentlich deutlicher. Die Kommission qualifiziert die Gesetzgebung als nicht vereinbar mit Art. 49 des EG-Vertrages. Sie nimmt dabei ausdrücklich Bezug auf die Gambelli-Rechtsprechung und schlussfolgert aus dem die Gesetzgebung begleitenden Erklärungsschreiben, dass „es den Anschein habe, […] dass sich die holländische Regierung hauptsächlich über die entgangenen Gewinne Sorgen machten (die für das Jahr 2004 von der Regierung auf 144 Mio. € geschätzt werden), die an (illegale) ausländische Dienstleister fließen“. In Übereinstimmung mit den Entscheidungen des EuGH wird deutlich, dass das Auffüllen der Staatskassen, für sich selbst genommen, nicht als objektive Rechtfertigung eines Monopols angesehen werden kann.
Die Kommission führt weiter aus: „Die Kommission hat keine wirksamen Rechtfertigungen dafür erkennen können, wie der holländische Gesetzgeber annehmen kann, dass es notwendig sei, alle grenzüberschreitenden Spielangebote zu begrenzen, wenn sie von solchen lizenzierten Unternehmen angeboten werden, die rechtlich niedergelassen in einem anderen Mitgliedsstaat ihre Dienstleistungen erbringen, wo sie angemessenen Kontrollen unterliegen […]. In Anbetracht der Absicht der holländischen Regierung, kriminelle Vorgehensweisen zu bekämpfen, stellt die Kommission fest, dass ein unabhängiges holländisches Expertenkomitee, die sog. „Werkgroep Wet op de Kansspelen“, die damit beauftragt war, das streitgegenständliche Gesetz zu überprüfen und seine Auswirkungen festzustellen, zu dem Schluss kam, dass die Begrenzung der Anzahl der Anbieter nicht vor Kriminalität und Illegalität schützen kann.“ […]
Die Kommission kommt zu folgendem klarstellenden Ergebnis:
„Schließlich kommt die Kommission zum Ergebnis, dass die Restriktionen, wie sie in dem neuen Gesetzesentwurf zum Glücksspiel vorgesehen sind, den Anschein machen, nicht durch überragende Gründe gerechtfertigt zu sein. Auch scheinen die Begrenzungen nicht verhältnismäßig in Bezug auf das genannte Ziel“ zu sein.
iv. Recht des E-Commerce als Vertrauensbildende Maßnahme?
Zwölf-Punkte-Empfehlungskatalog des Bundesverbands der Digitalen Wirtschaft für Online-Händler herausgegeben
Ein Bericht von RA Dr. Wulf Hambach und RA Dr. Hendrik Schöttle, Hambach & Hambach
Wer sich mit dem Recht des E-Commerce auseinandersetzt, sieht sich zunächst vor allem einem riesigen Katalog an Anforderungen gegenübergestellt, von bis ins letzte Detail gehenden Informationspflichten über organisatorische Maßnahmen bis hin zur Notwendigkeit, vom Kunden zahlreiche Einwilligungen einholen zu müssen. Meistens sind es nur die drohenden Bußgelder und das Risiko einer Abmahnung, was die Unternehmer dazu bewegt, die umfangreichen Pflichten umzusetzen.
Jetzt hat der Arbeitskreis „Vertrauen“, welcher der Fachgruppe E-Commerce des Bundesverbands der Digitalen Wirtschaft angehört, einen Empfehlungskatalog herausgegeben, der – wie der Name des Arbeitskreises schon vermuten lässt – die Förderung vertrauensbildender Maßnahmen im Visier hat. Denn das Misstrauen derjenigen, die sich noch immer dem Online-Handel verweigern, ist nach wie vor groß. „Vertrauen ist nach wie vor die wichtigste Grundlage für den Online-Handel. Wer das nicht ernst nimmt, verspielt viel Potenzial“, so der Vorsitzende der Fachgruppe E-Commerce Roland Fesenmayr (OXID eSales GmbH). Dabei sind es meist nur einfache Dinge, die vom Online-Händler beachtet werden müssten, um das Vertrauen – auch den Absatz – zu steigern.
Überfliegt man die Liste der Anforderungen, denen der Arbeitskreis vertrauensbildende Wirkung zuspricht, liest sich das Ganze wie ein Streifzug durch das Recht des E-Commerce. An erster Stelle steht die Anbieterkennzeichnung (erforderlich nach dem Teledienstegesetz), daneben finden sich Produkt- und transparente Preisinformationen (beides Pflichten des Fernabsatzrechts), auch der Datenschutz und das Widerrufsrecht werden erwähnt.
Auch wenn viele Regelungen der genannten Gesetze in ihrer Ausgestaltung als Pflicht nicht besonders sinnvoll sind, zeigt sich, dass ein professioneller Internetauftritt nicht ohne ein Grundgerüst aus Technik, Information und Sicherheit auskommt. Der Empfehlungskatalog des Bundesverbands der Digitalen Wirtschaft hat jetzt gezeigt, dass die rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen im E-Commerce dabei gar nicht so weit auseinander liegen wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Wer sich am Empfehlungskatalog orientiert und gleichzeitig die Pflichten des Internetrechts rechtssicher umsetzt, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Er schützt sich nicht nur vor Abmahnungen und Bußgeldern, sondern sichert sich auf das Vertrauen der Kunden, das sich bei zunehmendem Konkurrenzdruck schnell in einen wirtschaftlichen Vorteil verwandeln kann.
v. In eigener Sache
Im November 2005 ist RA Dr. Wulf Hambach zum General Member der International Masters of Gaming Lawyers (IMGL – www.gaminglawmasters.com) für Deutschland gewählt worden. IMGL ist eine international aus gerichtete Vereinigung von Glücksspielrechtsexperten, die sich für eine Fortentwicklung des internationalen Glücksspielrechts einsetzt.
?
Wir freuen uns den niederländischen Rechtsanwalt Justin Franssen (![]() ) als Gastkommentator der „Betting-Law-News“ begrüssen zu können. Justin Franssen wird Sie künftig über die Weiterentwicklung des niederländischen Glücksspielrechts auf dem Laufenden halten.
) als Gastkommentator der „Betting-Law-News“ begrüssen zu können. Justin Franssen wird Sie künftig über die Weiterentwicklung des niederländischen Glücksspielrechts auf dem Laufenden halten.
Justin Franssen hat früher als Croupier gearbeitet, studierte Rechtswissenschaften und Philosophie an den Universitäten von Leuven (B), Maastricht und Amsterdam. Er arbeitet bei der Rechtsanwaltskanzlei Van Mens & Wisselink in Amsterdam, wo er sich auf die Problemstellung aus dem Bereich des Glücksspielrechts spezialisiert hat. Er ist an den führenden Post-Gambelli-Verfahren in den Niederlanden beteiligt, veröffentlicht zu diesen Themen (in 3 Ausgaben des Internet Gambling Reports, des Casinolawyer usw.) und hält regelmäßig Vorträge auf internationalen Konferenzen (IMGL, EIG, European Gambling Briefing, Virtual Gaming Forum etc.). Rechtsanwalt Franssen ist „General Member of the International Masters of Gaming Law (IMGL)“ für Holland und Mitglied der „International Association of Gaming Attorneys.“
?
In den Betting-Law-News und unter www.betting-law.com werden wir Sie in Zukunft nicht nur über Wett- und Glücksspielrecht, sondern auch über aktuelle Neuigkeiten aus dem IT-Recht informieren.
vi. Zu guter Letzt
Viele hatten eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Sportwetten noch in diesem Jahr erwartet. Diese Hoffnung wurde enttäuscht, wir konnten lediglich unsere Eindrücke von der mündlichen Verhandlung schildern, die am 8. November 2005 in Karlsruhe stattfand (wir berichteten hierüber bereits im Betting-Law-Newsletter vom 10.11.2005). So wird nun auch der Start ins Jahr 2006 von der Ungewißheit über die Zukunft der Sportwetten in Deutschland begleitet. Wir möchten allerdings jetzt schon einen kurzen Blick hinter den Vorhang wagen und – ganz im Sinne eines Horoskops für 2006 – Sie einmal im Orakeln versuchen lassen:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender des Ersten Senats, des Senats, der über das Sportwettenmonopol entscheidet, hatte im Jahr 1997 zur Vereinbarkeit vom Glücksspielmonopol mit der Berufsfreiheit umfassend Stellung bezogen. Er hielt es schon damals für widersprüchlich, die Erträge aus aus dem Spielbankenbetrieb durch ein gesichertes Monopol vollständig staatlich zu vereinnahmen, obwohl diese angeblich mit einem sozial- oder gesellschaftspolitischen Makel behaftet seien:
„Diese Vorstellung einer „Reinwaschung“ durch Verstaatlichung und Publifizierung ist ein allzu durchschaubarer und vordergründiger, deshalb aber auch ganz untauglicher Versuch, aus einem eigentlichen Finanzmonopol ein mit höheren verfassungsrechtlichen Weihen ausgestattetes Verwaltungsmonopol zu machen.“
Er kommt daher zu folgendem Ergebnis:
„Die Begründung eines öffentlichen Monopols für den Betrieb einer Spielbank verletzt das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 abs. 1 GG) bestehender und/oder potentieller privater Betreiber.“
Welche Schlüsse Sie daraus für den Fortbestand des deutschen Sportwettenmonopols ziehen, möchten wir an dieser Stelle einmal Ihnen überlassen und verbleiben
in diesem Sinne mit den besten Grüßen
zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 2005/2006
Ihr Team der Betting-Law-News
vii. Impressum
Die Betting-Law-News informieren Sie kostenlos über aktuelle Ereignisse aus dem europäischen und internationalen Glücksspielrecht. Hambach & Hambach übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts der Betting-Law-News. Bitte beachten Sie, dass die Betting-Law-News lediglich der Information dienen und eine anwaltliche Rechtsberatung unter keinen Umständen ersetzen. Ein Nachdruck (Zweitveröffentlichung) ist nur unter Nennung der Quelle gestattet.
Der Betting-Law-Newsletter ist beim nationalen ISSN-Zentrum für Deutschland registriert (ISSN 18617441).
Redaktionell verantwortlich:
RA Dr. Wulf Hambach
Presseinformation
Betting-Law-News 09/2005
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:Redaktion:
RA Dr. Wulf Hambach
RA Claus Hambach
RA Andreas Gericke
RA Dr. Hendrik Schöttle
Sarah Madden
RA Dr. Wulf Hambach
RA Claus Hambach
RA Andreas Gericke
RA Dr. Hendrik Schöttle
Sarah Madden
Über das Unternehmen
Haimhauser Str. 1
D-80802 München
Fon: +49 89 389975-50
Fax: +49 89 389975-60
E-Mail: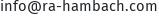
www.betting-law.com
D-80802 München
Fon: +49 89 389975-50
Fax: +49 89 389975-60
E-Mail:
www.betting-law.com
Pressebericht „Betting-Law-News 09/2005“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von Hambach & Hambach


Hambach & Hambach Rechtsanwälte erwirken Vorlage zum EuGH
Hintergründe zum Wettmonopol-Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts vom 30. Januar 2008
Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 31.1.2008 berichtet, hat das VG Schleswig-Holstein in einem durch die Kanzlei Hambach & Hambach geführten Hauptsacheverfahren, das die Geltung einer europäischen Lizenz für das Sportwettenangebot in Schleswig-Holstein zum Gegenstand hatte, beschlossen, das Verfahren auszusetzen und entscheidungs-erhebliche Fragen zum Europarecht im Vorabentscheidungsverfahren durch den EuGH klären zu lassen.
…


Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig vom 30.01.2008
Ein schwarzer Tag für den neuen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland
Verwaltungsgericht Schleswig sieht - wie die EU-Kommission - EU-Recht verletzt und legt europarechtliche Fragen zum neuen Sportwettenmonopol dem EuGH vor.
Schleswig, 31.1.2008: Der 30. Tag im neuen Jahr 2008 war aus rechtlicher Sicht sicherlich kein guter Tag für die Verfechter des einige Wochen jungen Glücksspielstaatsvertrages. Denn: An diesem Mittwoch wurde das junge Vertragswerk nicht nur gleich auf europäischer Ebene durch die Europäische Kommission scharf attackie…
Das könnte Sie auch interessieren:


Unterschiedliche Marktsituation auf den online Glücksspielmärkten weltweit
Der „Global Online Gambling and Betting Report 2012“ von yStats.com – dem Hamburger Spezialisten für sekundäre Marktforschung – stellt den Onlinemarkt für Glücksspiele und Wetten zum einen global und zum anderen für mehr als 20 der verschiedensten Regionen und Länder weltweit dar. Zudem finden sich ein Ranking der 20 führenden Online Poker-Websites sowie News zu 22 Unternehmen aus dem Online-Gambling und -Betting-Umfeld.
Des Weiteren ist auch der „Europe Online Gambling and Betting Report 2012“ erhältlich, welcher Informationen zu 11 europäi…

Hambach & Hambach erwirken neue Gerichtsentscheidung zum Thema Sportwetten
… es die Anbieter kalt erwischen, indem sie mit wettbewerbsrechtlichen Angriffen seitens der Konkurrenz oder gar mit strafrechtlichen Verfahren überzogen werden.
Die Betting-Law-News informieren Sie kostenlos über aktuelle Ereignisse aus dem europäischen und internationalen Glücksspielrecht. Hambach & Hambach übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit …

Bundesländer verteilen weiße Salbe - Soll das zensurfreie Internet bei Online-Spielen finanziellen Interessen geopfert werden?
Bonn/München – In der aktuellen Ausgabe der Betting Law News beschäftigt sich Hendrik Schöttle von der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Hambach & Hambach http://www.ra-hambach.com mit den Versuchen der Bundesländer, das zensurfreie Internet finanziellen Interessen zu opfern. Mit den Rezepten von gestern wolle man den Problemen von morgen zu Leibe rücken, so Schöttle über den Windmühlenkampf der Länder in puncto Sportwetten. Um die zahlreichen europäischen Online-Spieleanbieter vom deutschen Markt zu drängen, werde inzwischen überlegt, auch die d…

Tear down this Wall - Staatliches Glücksspielmonopol braucht Mauerspechte
Bonn/München – Ronald Reagan hat einst Geschichte geschrieben. Der verstorbene ehemalige US-Präsident stellte sich im Juni 1987 vor die Berliner Mauer und rief in Richtung Moskau an die Adresse Gorbatschows: „Tear down this Wall“. Ähnlich visionären Wagemut erhoffen sich die Gegner des staatlichen Monopols auf Glücksspiele von EU-Binnenmarkt-Kommissar Charlie McCreevy. Dass die Staatsmonopolisten in ihm nicht unbedingt einen Freund gefunden haben, machte McCreevy im Oktober 2006 gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel http://www.spiegel.…


Betting-Law-News 6 | 2006
… Die zwischenzeitlich vorgelegten Entwürfe werden allerdings einer verfassungs- und europarechtlichen Überprüfung kaum standhalten (vgl. hierzu Betting-Law-News 04/06: http://www.rahambach.
com/cms/upload/pdf/BLN_04-2006_dt.pdf).
Weiteren Gegenwind erfährt der neue Staatsvertrags-Entwurf durch den Beschluss des Bundeskartellamts vom 23.08.2006. Danach …


Betting-Law-News 03/2006
… zu beziehen. In einer am 23. Juni 2006 eingereichten Kleinen Anfrage stellt die Fraktion 19 konkrete Fragen, die wir bereits teilweise unter Ziffer ii unserer Betting-Law-News beantworten. In diesem Vorschlagspapier zeigen RA Dr. Wulf Hambach und RA Dr. Michael Hettich auf, wie eine liberale Neuregelung des Sportwettenrechts auf Bundesebene aussehen …


Betting-Law-News 2 - 2007
… Vorschlagspapier “Gesetzliche Neuordnung des Glücksspielerchts am Beispiel der Sportwette von RA Dr. Wulf Hambach und RA Dr. Michael Hettich, Hambach & Hambach Rechtsanwälte in Betting-Law-News 03/06).
So bestätigte auch das VG Gießen jüngst:
Die Einführung einer staatlichen Kontrolle über die Anmeldung, die Durchführung und die tatsächliche …

EU Die Vertragsverletzungsverfahren und die Dienstleistungsrichtlinie
3. Die Vertragsverletzungsverfahren und die Dienstleistungsrichtlinie
Die Vertragsverletzungsverfahren
Wie wir in der letzten Ausgabe der Betting-Law-News berichteten, wurden eine Vielzahl von Beschwerden gegen Deutschland sowie gegen andere Mitgliedsstaaten der EU eingereicht, mit denen die Verletzung des EU-Rechts geltend gemacht wird.
Die EU-Kommission …

Betting-Law-News 08/05
… Michl Posch, Marketing Director von Intertops.com geführt.
Die Kanzlei Hambach & Hambach steht Ihnen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung
3. Impressum:
Die Betting-Law-News informieren Sie kostenlos über aktuelle Ereignisse aus dem europäischen und internationalen Glücksspielrecht. Hambach & Hambach übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit …


Betting-Law-News 01 | 2007
… zuzustimmen zu wollen, sondern unter anderem den Verlauf des Notifizierungsverfahrens bei der EU sowie die anstehenden Entscheidungen des EuGH abwarten (vgl. auch Betting-Law-News 6/2006). Diese unzulänglichen Verhältnisse führen nach Ansicht des VG Stuttgart dazu, dass der Sportwettenvermittler davon ausgehen durfte, dass die Bestimmungen des derzeitigen …
Sie lesen gerade: Betting-Law-News 09/2005