Unternehmen gelingt es nicht immer, geplante Strategien und Maßnahmen zu realisieren. Das ist zwar nicht unbedingt „daily business“, ist aber dennoch fest mit dem unternehmerischen Handeln verbunden. Eine Krise, als Bruch einer kontinuierlichen Entwicklung, ist meist auch ein Wendepunkt, ein Übergang. Es sind deshalb nicht allein die negativen Aspekte zu betrachten, sondern ebenso gut das Positive, der Lernprozess, die Chancen insgesamt. Um der Krise mit den richtigen Mitteln zu begegnen, bedarf es der umfassenden Information, sowohl intern als auch extern. Dabei ist die Krisenkommunikation strategisches Mittel, das Gerüchten und Falschinformationen vorbeugt.
Was ist Krisenkommunikation?

Zu den Beispielen von Krisen in Unternehmen zählen:
- Absatzkrisen
- Datenschutzpannen
- Entlassungen
- Korruption
- Leaks
- Liquiditätskrise oder Insolvenz
- Managementkrisen
- Produktrückrufe
- Sex-Skandale
- Standortschließungen
- technische Störungen
- Umwelt- und Tierschutz-Verstöße
- Unfälle
- Verbrauchertäuschung
Diesen Beitrag lieber hören statt lesen? Einfach klicken und openPR-Kanal abonnieren!
Klassische Maßnahmen, die vor, während und nach einer Krise wirkungsvoll einzusetzen sind:
- Über die sozialen Medien in Interaktion gehen: Sie spiegeln die öffentliche Meinung wider und lassen sich andererseits optimal nutzen, um Aufklärung zu betreiben. Bestenfalls beginnt die Kommunikation über diese Medien, noch ehe die Krise von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Vertrauen und Glaubwürdigkeit untermauern, ständige Erreichbarkeit und zur Krise zu stehen, sie nicht „klein reden“ oder gar als Hirngespinst abtun, sind wesentliche Maßnahmen, um erheblichen Schaden an der Reputation abzuwenden.
- Laufendes Krisenmonitoring durch Beobachtung der Vorgänge in den öffentlichen Medien. So lässt sich schnell ein Eindruck gewinnen, wie die eigenen Kommunikationsziele zu erreichen sind und negativen Auswirkungen vorzubeugen ist.
- Erkennen des richtigen Zeitpunkts: Wann ist es am besten, um zu handeln, sowohl intern als auch extern.
- Mitarbeiter informieren und schulen: Es sollte im Krisenfall allen Beschäftigten klar sein, dass sie eine (Teil-)Verantwortung im Krisenmanagement haben. Dadurch wird sichergestellt, dass das Unternehmen handlungs- und entscheidungsfähig bleibt.
- Schnelles und richtiges Reagieren und völlige Offenheit: Wenn auf Krisen erst dann reagiert wird, wenn sie sich bereits in hohem Ausmaß manifestieren, dann entsteht schnell der Eindruck, dass etwas „vertuscht“ werden soll, es das Unternehmen nicht ganz ehrlich meint. So etwas kann sich leicht zum „Rohrkrepierer“ entwickeln, eine nachhaltige Schädigung des Bildes in der Öffentlichkeit ist nicht auszuschließen (Stichwort: Reputation).
- Krisenkommunikation ist Chefsache: Die oberste Geschäftsleitung muss, extern als auch intern, permanent präsent sein und für Auskünfte und Entscheidungen zur Verfügung stehen. Hier stehen die Leadership- und Leitungskompetenzen der Führungskräfte auf dem Prüfstand.
- Nach der Krise ist vor der Krise: Mit professioneller Nacharbeit werden mögliche Fehler erkannt, aber auch Chancen. Ein permanenter Lernprozess, im ganzen Unternehmen verankert, beugt den negativen Auswirkungen künftiger Krisen vor.
Eine Krise zieht in aller Regel einen Interessenkonflikt zwischen Unternehmen und der Öffentlichkeit nach sich. Obwohl es kein „Patentrezept“ für Handlungsanweisungen gibt, so empfehlen Experten das Unterlassen von bestimmten Verhaltensmustern (Fehlverhalten):
- Leugnen, Fakten umdeuten
- Ablehnung von Verantwortung
- Relativierung der Folgen
- Zurückweisung von Kritik
- Mangel an Betroffenheit
- arrogantes Auftreten
- Ignorieren von Argumenten und Fakten.
Was ist Krisen-PR?

Wie ist eine derartige PR-Krise zu vermeiden, was ist zu beachten:
- Die Kommunikationskultur im Unternehmen ist offen auf allen Ebenen und besonders im Management.
- Besonders geschulte Mitarbeiter/innen übernehmen Funktionen im Monitoring der Presse und der sozialen Medien. Sie haben die Aufgabe zu beobachten, wie über das Unternehmen gesprochen wird und auch gezielt Informationen zu streuen (Stichwort Corporate Influencer).
- Frühwarnsysteme sind darauf ausgelegt Schwachstellen zu entdecken und rechtzeitig Alarm auszulösen.
- Kritik sollte niemals als harmlos abgetan werden, jede Äußerung ist ernsthaft auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen und ggf. in die Maßnahmenliste aufzunehmen.
- Ein Netzwerk von Unterstützern (Fan-Gruppen) in der Presse und Öffentlichkeit, kann während der Krise im Sinne des Unternehmens positiv kommunizieren und den Angriffen den Wind aus den Segeln nehmen.
- Ein Krisenstab, der unverzüglich die Arbeit aufnehmen kann, sollte auf Abruf bereitstehen.
Möchten Sie professionelle PR online machen?
Nutzen Sie das rundum sorglos StartUP-Paket von openPR!
Warum ist Krisenkommunikation wichtig?
Die Frage ist leicht zu beantworten, denn nur dadurch stärkt ein Unternehmen das Vertrauen in der Öffentlichkeit. Gerüchte lassen sich frühzeitig aus der Welt räumen und offensives Eingehen auf die aktuelle Problemlage stärkt das Vertrauen und gibt auch Rückhalt der betroffenen Target-Groups.
Der Einwand, dass nicht alle Informationen offenzulegen sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Wie aktiv eine Krise kommuniziert wird, hängt von der Art der Bedrohung ab, die damit verbunden ist. Immer dann, wenn Teile der Öffentlichkeit beteiligt sind, Schaden nehmen könnten, ist jedenfalls aktive offensive Kommunikation angesagt.
Strategien für richtige Kommunikation in der Krise

Mögliche Strategien dazu:
- Aufbau stabiler Kommunikationsplattformen zu den Medien, zu Journalisten, Share- und Stakeholdern.
- Pflege der Accounts in den sozialen Medien.
- Einen Krisenstab bilden und noch vor einer möglichen Krise die Aufgaben zuteilen.
- Aufbau von Kommunikationsverantwortlichen für die Segmente Öffentlichkeit, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter/innen, Shareholder, Finanzierer.
Wie Krisenkommunikation umzusetzen ist
Die ersten Reaktionen und deren Zeitpunkt bestimmen bereits über den möglichen Ausgang der Krise. Es hängt davon ab, ob und wie das Unternehmen die Kontrolle behält, wie schnell es reagiert. Damit zeigt es sich, ob das Schiff sicher und richtig durch den Sturm gesteuert wird oder es Wind und Wellen hilflos ausgeliefert ist.
Die Grundsätze erfolgreicher Krisenkommunikation sind:
- Schnelligkeit: Aktive, frühzeitige und direkte Berichterstattung. Keinesfalls die Kommunikation unbeteiligten Dritten überlassen, die eigene Interessen verfolgen könnten.
- Transparente und sachliche Kommunikation fördert die Glaubwürdigkeit.
- Einheitliche Krisenkommunikation durch koordinierte Veröffentlichungen, keine „Alleingänge“.
- Regelmäßige Berichte über den Stand der Entwicklungen.
- Verständliche Ausführungen anstatt langatmiger Erklärungen.
- Einsatz bildhafter Sprachelemente (bspw. Vergleich mit Sturm auf dem Meer, Ausbruch eines Vulkans, etc.).
Krisenkommunikation & Social Media
Die Anonymität im Web, senkt die Hemmschwelle gegenüber der „realen Welt“. Für Unternehmen gilt es ein Gespür für den richtigen Umgang zu entwickeln. Tatsache ist, dass negative Kommentare schon mal das eine oder andere Unternehmen schwer geschädigt haben. Aus einem kleinem Strohfeuer hat sich ein zerstörerischer Großbrand entwickelt.
Es sind zwei Ausprägungen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben:
1. Einen Shitstorm auslösen: Der Begriff ist mittlerweile nicht neu. Wie ein richtiger Sturm beginnt es mit kleineren Böen und in kurzer Zeit entwickelt sich daraus ein Orkan, vergleichbar mit dem Entstehen von Monsterwellen auf den Ozeanen. Kritik, Beschimpfungen, Verleumdungen sind die kennzeichnenden Merkmale.
Beispiel: „Ein Schaum in Weiß“, so hatte Dickmanns seine Facebook-Kampagne anlässlich der Hochzeit von Harry und Meghan betitelt. Dargestellt war ein „Superdickmann“, bekleidet mit einem weißen Hochzeitskleid. Schokolade hat nun mal eine eher dunkelbraune Anmutung und deshalb brach sofort ein Shitstorm los, der dem Unternehmen Rassismus unterstellte, mit einem Bezug zu den afroamerikanischen Wurzeln der Braut. Die Folge: Aufgrund des öffentlichen Drucks verschwand der Post mitsamt der gesamten Timeline von der Plattform.
2. Trolle: Kennen wir als Fabelwesen, wenig lieblich, meist gefährlich und generell unerwünscht. Auch in den sozialen Medien treiben sie sich herum und haben nur eines im Sinn: Unruhe stiften, provozieren, zer- und verstören. Im Gegensatz zu den Märchen stecken hinter den Internet-Trollen reale Menschen mit meist bösen Absichten. Oft fällt die Unterscheidung zu tatsächlichen Kunden oder Stakeholdern des Unternehmens schwer, die tatsächlich Hilfe wollen, ein richtiges Anliegen haben.
Identifizierbar sind Trolle an folgenden Verhaltensweisen:
- übertriebenen und emotional verstärkten Aussagen
- mangelndem Interesse an Argumenten
- fehlerhafte Schreibweise
- unvollständiges oder leeres Profil
Mitarbeiterkommunikation in der Krise
Sehr schnell spüren Mitarbeiter/innen, dass die Stimmung im Unternehmen eine andere ist. Unterschwellig ändert sich das Klima, die Unsicherheit steigt, Gerüchte tauchen da und dort auf. Jetzt ist es für das Management hoch an der Zeit aktiv zu werden und gegenzusteuern. Am Anfang steht in vielen Fällen eine Mitarbeiterversammlung geleitet von der obersten Führungsebene. Einzelgespräche im Anschluss sind von Vorteil. Vordringlich ist die umfassende, ausreichende und ehrliche Information. Das ist zu beachten:
- Sofern vorhanden ist die Beiziehung der Personalvertretung unabdingbar.
- Die Lage ist realistisch und offen darzustellen.
- Ursachen und Rahmenbedingungen sind offen zu benennen.
- Die verschiedenen Management-Ebenen sind gezielt im Hinblick auf ihre Verantwortungsbereiche zu informieren.
- Wenn erforderlich sind externe Berater beizuziehen.
Best Practice Beispiele
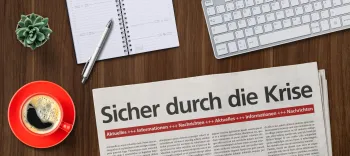
Der Mercedes Elchtest – Klassiker in der Krisenkommunikation
Es war im Jahre 1997 als während eine eher harmlosen Probefahrt ein Mercedes des Typs A-Klasse umkippte. Da das in Schweden passierte, ging das Ereignis als (nicht bestandener) „Elch-Test“ in die Medien ein. Daran, dass nach so vielen Jahren immer noch davon gesprochen wird, kann man erkennen welche Langwertszeit Krisen im globalen Gedächtnis von Nationen haben. Dem Ereignis ging eine Einführungskampagne von 18 Monaten voraus und exakt drei Tage nach Markteinführung geschah das Missgeschick. Der Test lief im Auftrag einer schwedischen Automobil-Zeitschrift. Während dieser Zeit befand sich der gesamte Daimler-Vorstand auf der Tokio-Motor-Show und auch der Pressesprecher war dorthin angereist.
Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte die A-Klasse einen Bekanntheitsgrad von über 86 Prozent erreicht, die Auftragsbücher bei Mercedes waren gut gefüllt (100.000), rund 600 Vorbestellungen kamen täglich hinzu. Dann gingen die Bilder des verunfallten Autos rund um die Welt. Unverzüglich nahm eine „Task-Force“ die Arbeit auf, vor allem weil bald bekannt wurde, dass es ein derartiges Ereignis bereits einen Monat davor, bei einer Probefahrt in Dänemark gegeben hat. Diese Ereignisse in Zusammenhang mit der Kommunikationsstrategie des Unternehmens lösten breite öffentliche Diskussionen aus. Das Pendel schlug zwischen Schadenfreude und Bedauern aus, die Aktie sank um 14%, Mercedes musste einen Auslieferungsstopp verhängen und baute in allen neuen Modellen kostenlos ein ESP-System ein. Kosten rund 300 Millionen DM. Dies, obwohl der Test, laut VDA, nicht den Standardtestverfahren zuzurechnen ist, da das Ergebnis nur schwer objektivierbar sei.
Der Lerneffekt aus der Krise: 70 % Öffentlichkeitsarbeit. Mercedes musste erkennen, dass es falsch war, den Fehler als rein technisches Problem zu sehen. Deshalb gingen 90 Prozent des Aufwandes in die technische Lösung, nur 10 Prozent waren der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet. Dieses Verhältnis, so der Leiter der Task-Force, hätte im Verhältnis 30% Technik, 70% Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation eindeutig positivere Ergebnisse gebracht. Insgesamt wurde der Krisenkommunikation ein gutes Zeugnis ausgestellt, da eine schnelle Reaktion, im Verbund mit psychologisch richtigem Handeln, erfolgte. Die Erkenntnisse mündeten auch in umfangreichen und strengen Qualitätskontrollen. Ab 1999 nahm ein permanenter Krisenstab seine Arbeit auf.
Kommunikationsstrategie von Lufthansa zum Germanwings-Absturz
Ein derartiges Unglück, wie der Germanwings-Absturz 2015, fordert alle Beteiligten in ungeheurem Ausmaß. Dennoch muss es gelingen, die wichtigsten Parameter der Krisenkommunikation mit höchster Qualität zu bedienen. Die Experten sprechen im Nachhinein von einer sehr guten Leistung des Lufthansa-Managements, denn die Kommunikation basierte auf zwei Säulen:
- der Sachebene (schnell, aufklärend, plausibel)
- und der emotionalen Ebene (offen, einfühlsam, persönlich, sympathisch).
Jede diese Ebene wurde von jeweils einem Vorstandsmitglied „bedient“, die Krise hatte damit ein „Gesicht“ bekommen. Die Handlungen waren insgesamt geprägt von
- Schnelligkeit: Post auf Twitter - „schwarzer Tag für die Lufthansa)
- Authentizität und Empathie
- Konsistenz: regelmäßige Auftritte in den Medien und vor der Presse
- Kongruenz: schwarze Krawatte, Körpersprache
Damit hat sich das Management nicht nur in Worten zu seiner vollen Verantwortung bekannt. Das Vertrauen in die Marke blieb im Wesentlichen erhalten.
Leitfaden / Checkliste für Krisenmanagement & PR im Unternehmen
| Aufgabe(n) | To-Do | Maßnahmen | Verantwortlich | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | N | ||||
| Allgemeine Planungen | |||||
| Ist im Unternehmen bereits ein Risikomanagement installiert, die Inhalte für die Risikokommunikation identifiziert? | |||||
| Sind die krisenanfälligen Bereiche im Unternehmen bekannt, die möglichen Themen der Krisenkommunikation analysiert? | |||||
| Sind die Verfahren und Strukturen vorbereitet und eingeübt? | |||||
| Ist ein Stabsbereich für die Krisenkommunikation definiert und allen Akteuren bekannt? | |||||
| Ist der interne Informationsaustausch institutionalisiert und findet regelmäßig statt? | |||||
| Konzept und Planung | |||||
| Liegt bereits ein Konzept für die vorgelagerte Krisenkommunikation vor, ist es sofort zu aktivieren? | |||||
| Ist eine übergeordnete Struktur (Holding, Konzern) und deren Vorgaben zu beachten? | |||||
| Sind bereits Leitlinien und Ziele für die Krisenkommunikation formuliert? | |||||
| Sind die Zielgruppen (Beschäftigte, Stakeholder, Beteiligte, Betroffene, eruiert, bekannt? | |||||
| Sind die Wünsche und Erwartungen der Zielgruppen bekannt? | |||||
| Gibt es bereits eine strukturierte Kommunikation mit den Zielgruppen, die in der Krise nutzbar ist? | |||||
| Sind die Schlüsselbotschaften definiert / bekannt? | |||||
| Sind die offiziellen Sprachregelungen bekannt, trainiert? | |||||
| Sind „Dark-Sites“ im Netz vorbereitet, über die im Ernstfall die Kommunikation laufen kann? | |||||
| Sind die Materialien für die Presse, ev. auch mehrsprachig, erstellt und sofort zu aktivieren / verteilen? | |||||
| Gibt es einen Argumentationskatalog und eine Sammlung von „häufig gestellten Fragen?“ | |||||
| Sind Vorkehrungen getroffen, damit alle Mitteilungen an Presse und (soziale) Medien unternehmensweit abgestimmt sind (One-Voice-Policy)? | |||||
| Ist die interne Veröffentlichung (Pressespiegel, Intranet, Internet) organisiert? | |||||
| Gibt es Verantwortliche, die die öffentliche Meinung beobachten (monitoren)? | |||||
| Stehen wissenschaftliche Berater und / oder Organisations- und Kommunikationsexperten bereit? | |||||
| Organisation | |||||
| Wie erfolgt die „Alarmierung“ (Stufenbau, Schneeball, Medien)? | |||||
| Sind Meldewege / Erreichbarkeiten bekannt (Kommunikationsverantwortliche, Krisensprecher/in) und auf aktuellem Stand (Telefonverzeichnis, Mailliste)? | |||||
| Wer ist für die Durchführung des Krisenkommunikationsplanes verantwortlich (Erreichbarkeit)? | |||||
| Wie wird die kurzfristige Arbeitsfähigkeit des Unternehmens während der Krise sichergestellt, wer ist dafür verantwortlich? | |||||
| Sind die Melde- und Informationswege festgelegt? | |||||
| Sind die Meldepflichten festgelegt / bekannt (Berichterstattung)? | |||||
| Sind die Verantwortlichen für die Außenkommunikation festgelegt / bekannt. Kennen sie die Eskalations-Stufen? | |||||
| Liegt eine Liste der wichtigsten Medien samt aktualisierter Ansprechpartner / Kontaktdaten auf? | |||||
| Personal | |||||
| Ist der verantwortliche Pressesprecher mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet? Ist eine Vertretung organisiert? | |||||
| Sind bei allen beteiligten / betroffenen Personen die Verantwortungen, Abläufe, Meldewege bekannt und steht die nötige technische Ausstattung bereit (PC, Smartphone, Internet)? | |||||
| Sind die Personalressourcen so geplant, dass ein zeitweiser 7/24 Betrieb sichergestellt ist? | |||||
| Sind die Experten für spezielle Fragestellungen bekannt, ist ihr Wissen auf dem aktuellen Stand? | |||||
| Ist ein Aus- und Fortbildungskonzept in Bezug auf Medienkompetenz und -kommunikation vorhanden? | |||||
| Sind die dienstrechtlichen Vereinbarungen getroffen (Rufbereitschaft, Verantwortungen), vor allem im Hinblick darauf, dass die Organisation arbeitsfähig bleibt? | |||||
| Technik | |||||
| Sind alle technischen Möglichkeiten vorhanden, um die interne und externe Kommunikation aufrechtzuerhalten? | |||||
| Sind genügend Kommunikationseinrichtungen, zumindest für den Krisenstab, vorhanden (inkl. BackUP / Redundanzen)? | |||||
| Gibt es einen Notfallplan, wenn die Kommunikation ausfallen sollte? | |||||
| Sind alle erforderlichen Hintergrundinformationen bereitgestellt und sofort abrufbar? | |||||
| Sind die Abläufe für die Krisenkommunikation im Home-Office und bei mobilem Arbeiten geregelt? | |||||
| Ist technisch sichergestellt, dass vertrauliche Informationen nicht in falsche Hände geraten können? | |||||
| Sind im Vorfeld Kommunikationsübungen (technisch) gelaufen? | |||||
Fazit
Krisen sind aus dem unternehmerischen Handeln nicht wegzudenken. Entscheidend über Erfolg oder Misserfolg, den damit verbundenen möglichen Schäden am Image und der Reputation, sind die richtigen und sofortigen Maßnahmen und die permanente Bereitschaft, die Krise mit den richtigen Mitteln zu bearbeiten. Mercedes hat es mit dem Elch-Test „kalt erwischt“. Dem ist durch Vorbereitung und Übung zu begegnen. So wie es ein Team von Feuerwehrleuten tut, die Woche für Woche den Ernstfall proben. Eine Strategie, die auf Unternehmen und Organisationen durchaus zu übertragen wäre.
Eine wirksame Strategie für erfolgreiche Krisen-PR ist die Kontinuität, mit der sie betrieben wird. Das Krisenmanagement ruht damit gemeinsam mit der Prävention auf zwei Säulen, die bereits in krisenfreien Zeiten aufzubauen sind. In der Toolbox sind die wichtigsten Personen und Kontaktdaten enthalten, ebenso wie der Aufbau qualifizierter Mitarbeiter/innen für Krisenkommunikation. Ein Frühwarnsystem ist installiert, ein Krisenhandbuch beschreibt alle mögliche Szenarien und Lösungsansätze.

