Viele Medienhäuser, vor allem Boulevardmedien, werden regelmäßig mit presserechtlichen Informationsschreiben konfrontiert. Diese Schreiben werden von Rechtsanwälten im Namen ihrer Mandanten versendet, um Veröffentlichungen über bestimmte Themen oder Personen zu verhindern und rechtliche Schritte anzudrohen. Für PR-Profis ist es unerlässlich, dieses Instrument zu kennen und zu verstehen, da es direkte Auswirkungen auf Kommunikationsstrategien und den Umgang mit Medien haben kann. Doch was genau verbirgt sich hinter einem solchen Schreiben, welche rechtlichen Grundlagen gelten und welche Wirkung hat es? Dieser Artikel bietet eine verständliche Erklärung mit Beispielen und einschlägigen Urteilen.
Was ist ein presserechtliches Informationsschreiben?
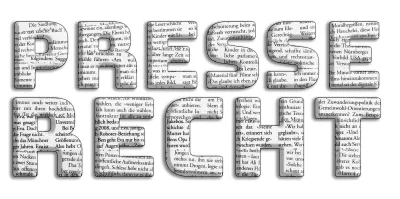
Beispielsweise können solche Schreiben versendet werden, wenn ein Artikel falsche oder irreführende Informationen über eine Person oder ein Unternehmen enthält, um die Veröffentlichung dieser Inhalte zu unterbinden. Ebenso kommen sie zum Einsatz, wenn vertrauliche oder private Informationen ohne Zustimmung veröffentlicht werden sollen, wie etwa bei der Veröffentlichung von privaten Fotos oder detaillierten Berichten über das Privatleben einer Person. Weiterhin werden presserechtliche Informationsschreiben häufig verwendet, um die Verbreitung von verleumderischen Aussagen zu stoppen, die den Ruf eines Unternehmens oder einer Einzelperson nachhaltig schädigen könnten.
Ein presserechtliches Informationsschreiben kann verschiedene Formen annehmen, von einfachen Mitteilungen über mögliche rechtliche Schritte bis hin zu detaillierten Erklärungen von Rechtsverletzungen, die durch eine geplante oder veröffentlichte Berichterstattung entstanden sein könnten. Solche Schreiben dienen mehreren Zwecken:
- Präventiver Rechtsschutz: Sie sollen verhindern, dass Medienunternehmen Persönlichkeitsrechte oder andere gesetzlich geschützte Rechte Dritter verletzen.
- Klärung von Missverständnissen: Sie bieten die Möglichkeit, Missverständnisse oder falsche Darstellungen in der Berichterstattung zu klären, bevor sie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
- Förderung verantwortungsbewusster Berichterstattung: Durch die Androhung rechtlicher Schritte werden Medienhäuser dazu angehalten, sorgfältiger und verantwortungsbewusster zu berichten.
- Rechtliche Grundlage für spätere Schritte: Sollten die Medien trotz des Informationsschreibens weiterhin die angestrebte Berichterstattung durchführen, kann dies als Grundlage für spätere rechtliche Schritte wie Unterlassungsklagen oder Schadensersatzforderungen dienen. Die Übersendung solcher Schreiben dokumentiert die rechtliche Position und die Bedenken des Mandanten gegenüber dem Medienunternehmen, was im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von Bedeutung sein kann.
- Einschränkung der Pressefreiheit: Obwohl die Pressefreiheit ein hohes Gut ist, können presserechtliche Informationsschreiben eine gewisse Einschränkung darstellen, indem sie die redaktionelle Freiheit beeinflussen und die Medienhäuser zu vorsichtiger Berichterstattung bewegen.
Unterschied zu anderen rechtlichen Schreiben
Es ist wichtig, presserechtliche Informationsschreiben von anderen rechtlichen Mitteilungen zu unterscheiden, wie beispielsweise Unterlassungserklärungen. Während Unterlassungserklärungen konkrete Forderungen zur Unterlassung bestimmter Handlungen enthalten, sind presserechtliche Informationsschreiben oft präventiver Natur und richten sich auf die Möglichkeit zukünftiger rechtlicher Schritte, ohne konkrete Forderungen zu stellen.
Pressefreiheit vs. Persönlichkeitsrecht

Sind presserechtliche Informationsschreiben immer zulässig?
Presserechtliche Informationsschreiben sind nicht uneingeschränkt zulässig. Ihre Rechtmäßigkeit hängt maßgeblich vom Inhalt und der Zweckbestimmung ab. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in mehreren Urteilen klargestellt, unter welchen Bedingungen presserechtliche Informationsschreiben zulässig sind:
-
Urteil vom 15. Januar 2019 (VI ZR 506/17): Der BGH entschied, dass die unaufgeforderte Zusendung solcher Schreiben durch Anwälte an Medienunternehmen in der Regel nicht rechtswidrig ist, solange die Schreiben dazu geeignet sind, präventiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass die Schreiben Informationen enthalten müssen, die dem Medienunternehmen ermöglichen, zu beurteilen, ob Persönlichkeitsrechte durch eine Berichterstattung verletzt werden könnten.
-
Urteil vom 25. Juni 2024 (VI ZR 64/23): Der BGH stellte klar, dass ein presserechtliches Informationsschreiben ähnlich wie unerwünschte Werbung unzulässig ist und einen unmittelbaren Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellt, wenn es keine verwertbaren Informationen enthält. Solche Schreiben sind nur dann zulässig, wenn sie Informationen bieten, die dem Medienunternehmen eine fundierte Beurteilung ermöglichen. Andernfalls hat das Medienunternehmen das Recht, die Unterlassung zukünftiger Schreiben zu verlangen, insbesondere wenn ein sogenanntes Opt-Out vorliegt – das heißt, das Unternehmen hat deutlich gemacht, dass es keine derartigen Schreiben mehr erhalten möchte.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Zulässigkeit presserechtlicher Informationsschreiben stark davon abhängt, ob sie konkrete und verwertbare Informationen enthalten. Wenn sie dies nicht tun, können Medienhäuser rechtliche Schritte einleiten, um die Zusendung solcher Schreiben zu unterbinden und ihre redaktionelle Freiheit zu wahren.
Brauchen Sie Unterstützung bei Ihrer Pressearbeit?
Hier finden Sie die passenden Angebote von openPR!
Das sollten Sie als PR-Profi beachten
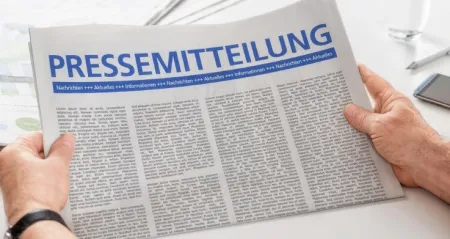
-
Transparente Kommunikation:
- Offene und ehrliche Kommunikation zwischen PR-Profis und Medien kann Missverständnisse vorbeugen und das Vertrauen stärken.
- Klare Darstellung der Fakten und Absichten in allen Kommunikationskanälen.
-
Klare und präzise Informationen bereitstellen:
- Wenn ein Informationsschreiben versendet wird, sollte es klare und konkrete Informationen enthalten, die dem Medienunternehmen eine fundierte Entscheidung ermöglichen.
- Vermeidung vager oder unklarer Formulierungen, die zu Missverständnissen führen könnten.
-
Professioneller Umgang:
- Ein respektvoller und professioneller Umgang auf beiden Seiten fördert eine positive und konstruktive Zusammenarbeit.
- Vermeidung von Drohungen oder einschüchternden Formulierungen, die die Beziehung belasten könnten.
-
Rechtliche Unterstützung einholen:
- Sowohl Absender als auch Empfänger sollten bei Unsicherheiten rechtlichen Rat suchen, um die richtigen Schritte zu unternehmen.
- Zusammenarbeit mit spezialisierten Anwälten kann helfen, rechtliche Risiken zu minimieren.
Durch respektvollen und professionellen Umgang auf beiden Seiten kann eine ausgewogene und faire Medienlandschaft gestaltet werden, die sowohl die Persönlichkeitsrechte schützt als auch die journalistische Freiheit wahrt.

