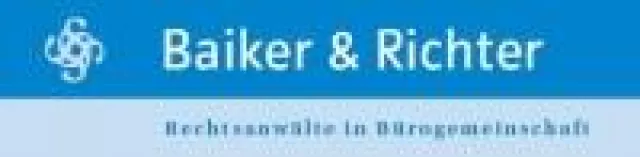(openPR) Der Subventionsgeber ist in atypischen Fallkonstellationen verpflichtet zu überprüfen, ob eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, die den Umfang der Mittel, deren Empfängerkreis und die übrigen Kriterien, anhand derer sie vergeben werden sollen, hinreichend bestimmt bzw. bestimmbar festlegt und umschreibt. Zwar wird für die Zahlung von geldlichen Zuwendungen als Ermächtigungsgrundlage grundsätzlich ein nur durch Parlamentsbeschluss legitimiertes Haushaltsgesetz als ausreichend angesehen,
vgl. BVerwG, Urteil vom 17. März 1977 – 7 C 59.75 -, NJW 1977, S. 1838, Rn. 13 bei juris,
dies gilt jedoch nicht, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Regelung durch ein spezielles Gesetz erforderlich machen.
So hat beispielsweise das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 14. März 2012 – OVG 6 B 19.11 –, juris ausgeführt:
„…Der mit der Klage geltend gemachte Anspruch des Klägers auf Zuwendungen aus dem KJP scheitert damit an einer entsprechenden wirksamen gesetzlichen Grundlage; demgemäß waren auch die den Jugendorganisationen der anderen politischen Parteien im Jahr 2006 gewährten Zuwendungen aus dem KJP rechtswidrig.
Das Erfordernis, die Gewährung der vorliegend in Rede stehenden Zuwendungen durch förmliches Parlamentsgesetz zu regeln, ergibt sich aus dem aus Artikel 20 Abs. 3 GG abzuleitenden (allgemeinen) Vorbehalt des Gesetzes in Verbindung mit der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten, allgemein anerkannten Wesentlichkeitstheorie. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Regelungen selbst zu treffen,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. August 1978 - 2 BvL 8/77 -, BVerfGE 49, 89, 126, Rn. 77 bei juris.
In der parlamentarischen Demokratie verwirklicht sich so die Repräsentation des Volkes und bietet wegen der Diskussion des Gesetzesvorhabens in einem hohen Maße Transparenz für die Wähler und damit die erforderliche Öffentlichkeit,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. März 1992 - 1 BvR 1430/88 -, BVerfGE 85, 386, 403 f., Rn. 66 bei juris.
Nach der Wesentlichkeitstheorie ist zu bestimmen, welche Sachbereiche über-haupt einer parlamentarischen Regelung bedürfen und wie detailliert diese auszugestalten ist,
BVerfG, Beschluss vom 27. November 1990 - 1 BvR 402/87 -, BVerfGE 83, 130, 152, Rn. 74 bei juris.
Welche Rechtsmaterien in diesem Sinne „wesentlich“ sind und demgemäß der Regelung durch förmliches Parlamentsgesetz bedürfen, ist nicht abschließend fest-gelegt, sondern unter Würdigung der die fragliche Materie betreffenden Gesamtumstände von den Gerichten, namentlich dem Bundesverfassungsgericht festzustellen. Die für die Frage der Wesentlichkeit einer bestimmten Rechtsmaterie Orientierung bietenden Kriterien sind in erster Linie den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, darüber hinaus aber auch den Judikaten der Fachgerichte zu entnehmen. Danach ist auf die Grundrechtsrelevanz der in Rede stehenden Maßnahmen abzustellen. Je intensiver Grundrechte betroffen sind, desto eher entsteht die Notwendigkeit eines Parlamentsgesetzes. „Wesentlich“ im grundrechtsrelevanten Bereich bedeutet daher „wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte“,
BVerfG, Beschluss vom 21. Dezember 1977 - 1 BvL 1/75, 1 BvR 147/75 -, BVerfGE 47, 46, 79, Rn. 92 bei juris.
Bedeutung erlangt dies namentlich dann, wenn es um den Ausgleich zwischen verschiedenen Grundrechtsträgern geht,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. November 1990, a.a.O., S. 142, Rn. 39 bei juris.
Maßgeblich ist darüber hinaus die Bedeutung einer Rechtsmaterie für das Gemeinwesen insgesamt,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. August 1978, a.a.O., S. 127, Rn. 78 bei juris.
Das Erfordernis einer speziellen gesetzlichen Ermächtigung kann sich darüber hinaus auch aus dem Gebot staatlicher Neutralität ergeben,
vgl. BVerwG, Urteil vom 27. März 1992 - 7 C 21/90 -, BVerwGE 90, 112 ff., Rn. 36 bei juris, zu staatlichen Förderungsmaßnahmen für einen privaten Verein, der die Öffentlichkeit vor dem Wirken bestimmter Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften warnen soll
sowie dann, wenn der Staat in den Prozess der öffentlichen Meinungs- und Willens-bildung eingreift,
vgl. OVG Berlin, Urteil vom 25. April 1975 - II B 86.74 -, DVBl. 1975, S. 905, 906 f., zur Subventionierung bestimmter Presseerzeugnisse.“
...
Ihr Konkurrent hat eine Subvention erhalten, Sie aber nicht?
Als Behörde stellt sich für Sie die Frage, wann die Rückforderung einer Subvention beispielsweise verfristet ist?
Sie haben Zweifel, ob alle Voraussetzungen für die Rückforderung einer Subvention vorliegen?
Sie fragen sich beispielsweise, ob und wie eine Rückforderung im Insolvenzverfahren erfolgt?
Subventionen können positive Einflüsse auf die Gesamtwirtschaft und den Wettbewerb haben. Anderseits besteht die Gefahr, Verzerrungen hervorzurufen. Um dies zu vermeiden, wird die Subventionsvergabe regelmäßig an eine Vielzahl von Auflagen geknüpft. Beim Subventionsrecht handelt es sich um eine Spezialmaterie, die besonderes Fachwissen erfordert. Wir beraten und vertreten Sie bei allen subventionsrechtlichen Fragestellungen.
link: http://www.baiker-richter.com/Rechtsgebiete/Subventionsrecht