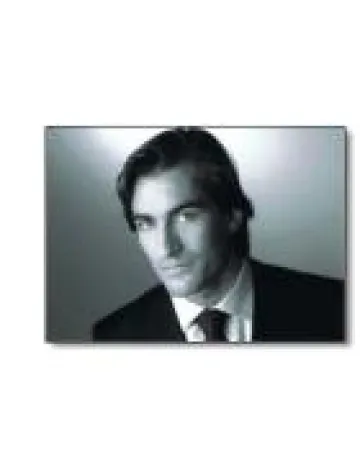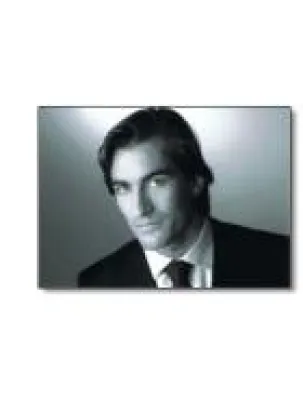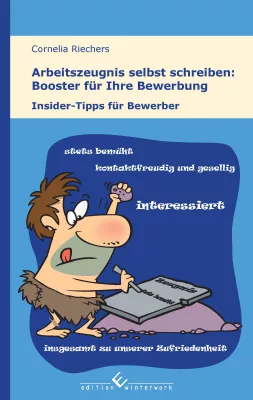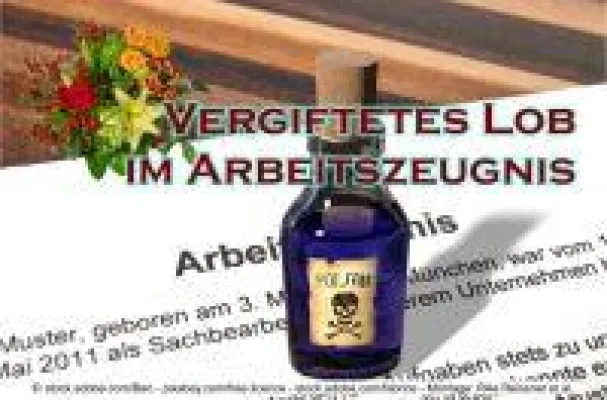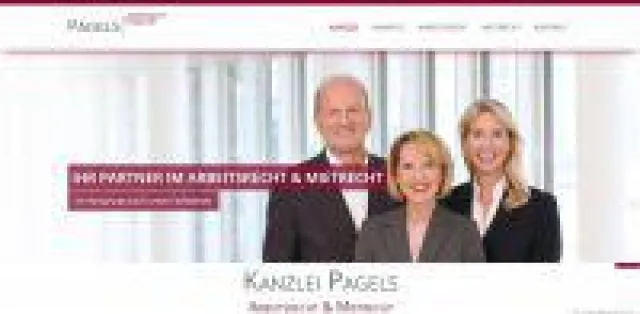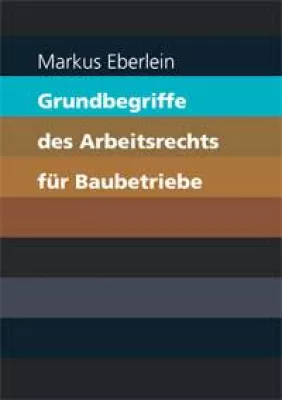(openPR) Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Dabei muss das Zeugnis mindestens Angaben zu Art und Dauer enthalten (sog. einfaches Zeugnis). Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist diesem ein Zeugnis zu erteilen, welches über die Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit hinausgehend zudem Angaben über Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers enthält (sog. qualifiziertes Zeugnis).
Seit dem 1. Januar 2003 ist dieser Zeugnisanspruch für alle Arbeitnehmer, d.h. für kaufmännische Angestellte, gewerbliche und sonstige Arbeitnehmer gleichermaßen, einheitlich in § 109 Gewerbeordnung (GewO) normiert.
Der Arbeitgeber erfüllt den Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers mit einem Zeugnis, das nach Form und Inhalt den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Das Zeugnis muss wahr sein: Es darf den Arbeitnehmer nicht unberechtigt hochloben; andererseits müssen kritische Äußerungen über Leistungen oder Führung des Arbeitnehmers maßvoll abgefasst werden, da unter Umständen schon aus bloßen Andeutungen negative Schlüsse gezogen werden könnten.
Zusammengefasst lässt sich insoweit der Satz festhalten, dass Arbeitszeugnisse „wahrheitsgemäß und von einem verständigen Wohlwollen geprägt“ sein müssen. Ein Arbeitszeugnis hat sowohl dem Gebot der „Zeugniswahrheit“ wie auch der „Zeugnisklarheit“ gerecht zu werden
Das Bundesarbeitsgericht hat insoweit auch den Satz geprägt, dass der gesetzlich geschuldete Inhalt des Arbeitszeugnisses sich nach dem mit ihm verfolgten Zweck bestimmt (BAG, NZA 2006, Seite 104; BAG, NJW 2004, Seite 2770).
Arbeitszeugnisse dienen dem ausscheidenden Arbeitnehmer als Bewerbungsunterlage; für zukünftige Arbeitgeber und Vertragspartner des Arbeitnehmers ist das Zeugnis wesentliches Kriterium bei der Personalauswahl. Form und Inhalt eines Arbeitszeugnisses dürfen dem bewerteten Arbeitnehmer dessen weiteres beruflichen Fortkommen nicht unnötig erschweren.
Bei der Erfüllung des Zeugnisanspruchs ist der Arbeitgeber in der Wahl der Zeugnisformulierung dabei grundsätzlich frei.
Einschränkungen für den Arbeitgeber hinsichtlich der Formulierung eines Arbeitszeugnisses aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses können sich jedoch dann ergeben, wenn der Arbeitgeber inhaltlich von einem dem Arbeitnehmer vormals erteilten Zwischenzeugnis negativ abweicht bzw. abweichen möchte – Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers also im Endzeugnis schlechter als im vormals erteilten Zwischenzeugnis beurteilt werden.
Der 9. Senat des Bundesarbeitsgerichts hatte in seiner Entscheidung vom 16. Oktober 2007 zu klären, welche Auswirkungen ein Zwischenzeugnis auf die inhaltliche Gestaltungsfreiheit des Arbeitgebers bei Erteilung des Endzeugnisses hat (Urteil des 9. Senats des BAG vom 16.10.2007, Az. 9 AZR 248/07).
Dabei stellten die Bundesrichter klar, dass ein Arbeitgeber bei der Formulierung des endgültigen Arbeitszeugnisses grundsätzlich an den Inhalt eines dem Arbeitnehmer zuvor erteilten Zwischenzeugnisses gebunden ist. Dies gilt nach Ansicht der Richter sowohl für die Tätigkeitsbeschreibung als auch für die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung des Arbeitnehmers.
Eine entsprechende Bindung des Arbeitgebers an von ihm zuvor im Zwischenzeugnis gemachte Angaben könne sich aus den Grundsätzen von Treu und Glauben ergeben.
Ein Zeugnis enthalte insoweit Wissenserklärungen des Arbeitgebers zu Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers, von denen er nur abrücken dürfe, wenn ihm nachträglich Umstände bekannt werden, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen.
Im Einklang mit früheren Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts machten die Richter des 9. Senats deutlich, dass auch ein Zwischenzeugnis wie ein Endzeugnis den Zweck habe, Dritte über die Leistungen und Tätigkeit des Arbeitnehmers zu unterrichten. Um dem gerecht zu werden, sei der Arbeitgeber für den Zeitraum, den das Zwischenzeugnis erfasst, grundsätzlich auch hinsichtlich des Inhalts des Endzeugnisses gebunden (Urteil des 9. Senats des BAG vom 16.10.2007, Az. 9 AZR 248/07, mit weiteren Nachweisen).
Der Arbeitgeber könne vom Inhalt des Zwischenzeugnisses nur dann abweichen, wenn die späteren Leistungen und das spätere Verhalten des Arbeitnehmers dies rechtfertigen (BAG a.aO.).
Im Rahmen des entschiedenen Fall stellten die Bundesrichter zudem klar, dass sich bei einem Betriebsübergang auch ein Betriebserwerber als Nachfolge-Arbeitgeber gemäß vorstehenden Bedingungen an dem Inhalt eines zuvor durch den Betriebsveräußerer erteilten Zwischenzeugnisses festhalten lassen muss.
Hinweis:
Dass ein Zeugnis keine geheimen oder doppeldeutigen Ausdrucksweisen enthalten darf, wird in der Praxis nicht stets beachtet. Ob ein Arbeitszeugnis den gesetzlichen Anforderungen und den diversen mittlerweile durch die Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien genügt, sollte, schon um Beanstandungen zu vermeiden, grundsätzlich durch einen auf diese Materie spezialisierten Rechtsanwalt geprüft werden.