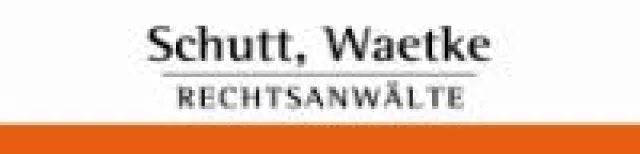(openPR) Die Erben des am 23.11.1991 verstorbenen Klaus Nakszynski, der unter dem Künstlernamen Klaus Kinski sehr bekannt geworden ist, haben keinen Anspruch auf Schadensersatz wegen einer Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts von Klaus Kinski. Dies entschied der BGH in einem Urteil.
Die Beklagten haben den Domain-Namen "kinski-klaus.de" zur Registrierung angemeldet und dazu benutzt, um für eine von ihnen veranstaltete Ausstellung über Klaus Kinski zu werben. Die Kläger haben dies mit Abmahnungen beanstandet und die Abgabe strafbewehrter Unterlassungserklärungen gefordert. Die Beklagten hätten in ihr absolutes Recht an der Vermarktung der Prominenz von Klaus Kinski eingegriffen. Mit ihrer Klage haben die Kläger als Schadensersatz die Erstattung der Abmahnkosten verlangt. AG und LG haben die Klage abgewiesen.
Der BGH hat die Revision zurückgewiesen. Die Kläger hätten keine Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts von Klaus Kinski. Das postmortale Persönlichkeitsrecht schütze allerdings mit seinen vermögenswerten Bestandteilen, die den Erben zustünden, auch vermögenswerte Interessen; eine Rechtsverletzung könne dementsprechend auch Schadensersatzansprüche der Erben begründen. Die vermögenswerten Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts behielten dem Erben jedoch nicht in gleicher Weise wie die Verwertungsrechte des Urheberrechts bestimmte Nutzungshandlungen vor. Es müsse vielmehr jeweils durch Güterabwägung ermittelt werden, ob der Eingriff durch schutzwürdige andere Interessen gerechtfertigt sei oder nicht.
Im vorliegenden Fall hat der I. Zivilsenat einen Anspruch wegen eines Eingriffs in die vermögenswerten Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts schon deshalb nicht für gegeben erachtet, weil dieser Schutz mit dem Ablauf von zehn Jahren nach dem Tod von Klaus Kinski erloschen sei. Er habe damit die für den postmortalen Schutz des Rechts am eigenen Bild in § 22 KUG festgelegte Schutzdauer von zehn Jahren auf den Schutz der vermögenswerten Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts übertragen. Die gesetzliche Begrenzung der Schutzdauer des Rechts am eigenen Bild beruhe nicht nur auf dem Gedanken, dass das Schutzbedürfnis nach dem Tod mit zunehmendem Zeitablauf abnehme. Sie schaffe auch Rechtssicherheit und berücksichtige das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit, sich mit Leben und Werk einer zu Lebzeiten weithin bekannten Persönlichkeit auseinandersetzen zu können. Der postmortale Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ende damit nicht insgesamt nach zehn Jahren. Unter den Voraussetzungen des Schutzes der ideellen Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts bestehe er fort. Über derartige Ansprüche sei jedoch nach dem Gegenstand des Rechtsstreits nicht zu entscheiden gewesen.
Urteil des BGH vom 05.10.2006
Az.: I ZR 277/03
Quelle: Pressemitteilung Nr. 132/2006 des BGH vom 05.10.2006
Vorinstanzen:
AG Charlottenburg, Entscheidung vom 09.01.2003, Az.: 204 C 197/02
LG Berlin, Entscheidung vom 30.10.2003, Az.: 52 S 31/03