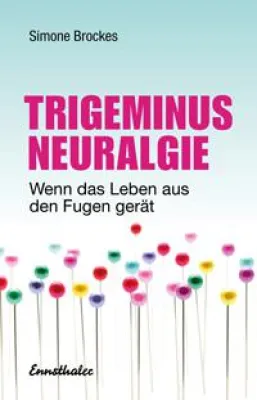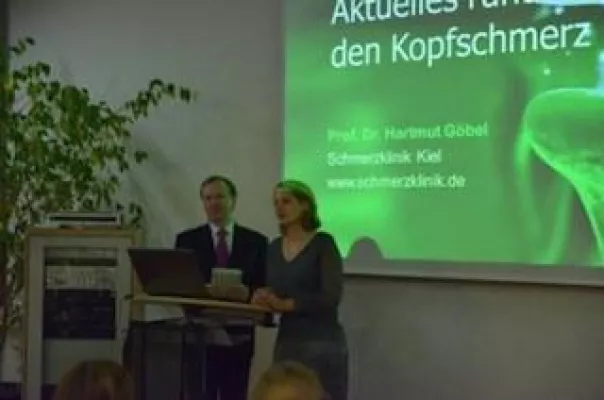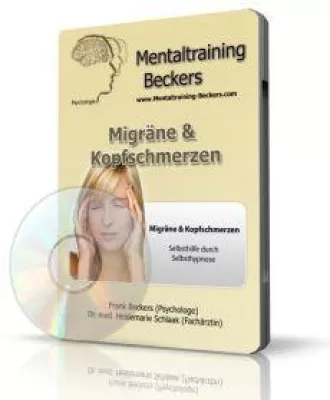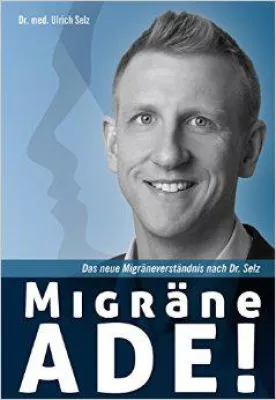(openPR) FAKT 1: ETWA JEDER ZEHNTE IN DEUTSCHLAND LEIDET AN MIGRÄNE.
Migräne ist eine neurologische Erkrankung, an der in Deutschland etwa acht Millionen Menschen leiden. Es sind vor allem Personen zwischen 25-45 Jahren betroffen. Dabei sind Frauen mit einer Prävalenz von 18% dreimal häufiger betroffen als Männer (Prävalenz: 6%). Im Kindesalter sind beide Geschlechter noch etwa gleich häufig betroffen. Knapp 20% der Migränepatienten erkranken erstmals bereits vor dem 10. Lebensjahr. Mit einsetzen der Pubertät steigt die Häufigkeit beim weiblichen Geschlecht im Vergleich zu den Männern an. Dafür nimmt bei Frauen, die unter menstruations-assoziierter Migräne litten, der Schweregrad der Erkrankung nach der Menopause meist wieder ab.
FAKT 2: DIE SYMPTOME SIND VIELFÄLTIG UND INDIVIDUELL SEHR UNTERSCHIEDLICH.
Die Weltgesundheitsorganisation zählt Migräne auf Grund der Symptomatik zu den am stärksten behindernden Erkrankungen, insbesondere wenn die Erkrankung chronisch wird (Migräne an >= 15 Tage/Monat über >= 3 Monate, ohne Medikamentenübergebrauch).
Zu den klassischen Symptomen dieser neurologischen Erkrankung, die während der eigentlichen Kopfschmerzphase auftreten können, zählen bei Erwachsenen
periodisch wiederkehrende, anfallartige, pulsierende und halbseitige Kopfschmerzen, insbesondere im Bereich der Stirn (frontotemporal), Schläfe und dem Auge (retroorbital)
Aura (siehe unten)
Begleitende vegetative Symptome können sein
Appetitlosigkeit
Übelkeit und Erbrechen
Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
Geräuschempfindlichkeit (Phonophobie)
Geruchsempfindlichkeit (Osmophobie).
Die Kopfschmerzphase kann zwischen einer Stunde und drei Tagen andauern. Dabei verschlimmern körperliche Arbeit, Licht und Stress die Kopfschmerzen meist. Durch langanhaltende und hochfrequente Migräneattacken kommt es zu strukturelle Veränderungen im Nervensystem, die weitere neurologische Erkrankungen hervorrufen können.
Der Kopfschmerzphase können eine Vorbotenphase und/oder eine Auraphase vorausgehen und eine Rückbildungsphase folgen.
Vorbotenphase
Bei etwa einem Drittel der Patienten kündigt sich eine Migräneattacke wenige Stunden bis zwei Tage im Voraus durch Vorboten wie Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Geräuschempfindlichkeit, häufiges Gähnen und Störungen im Magen-Darm-Trakt. Typisch sind auch Heißhungerattacken auf bestimmte Nahrungsmittel, die dann häufig fälschlicherweise für den Migräneauslöser gehalten werden.
Auraphase
Eine Aura ist ein Symptom der Migräne (kein Vorbote!). Sie tritt bei etwa 20% der Betroffenen auf und dauert maximal bis zu einer Stunde. Jeder Patient hat eine eigene Symptomatik, die verschiedene Symptome in unterschiedlichem Ausmaß beinhaltet. Allgemein zeichnet sich die Auraphase durch visuelle oder sensorische Wahrnehmungsstörungen wie Lichtblitze, Skotome (Ausfall oder Abschwächung (Dämpfung) der Sehkraft in einem Teil des Gesichtsfeldes), Verlust des räumlichen und scharfen Sehens und Verlust der Berührungsempfindung oder einem Gefühl von Kribbeln in den Armen, Beinen und im Gesicht aus. Diese Symptome sind charakteristischer Weise dynamisch und wandern von einer Position zur anderen. Neben diesen dynamischen Symptomen können der Geruchssinn, das Gleichgewicht oder die Sprache gestört sein. Die Aura ruft keine Schädigung im zentralen oder peripheren Nervensystem hervor. Die Kopfschmerzphase kann noch während der Auraphase einsetzten, spätestens aber eine Stunde danach.
Rückbildungsphase
Während diese Phase, die bis zu 24 Stunden dauern kann, klingen alle Symptome langsam wieder vollständig ab. Betroffene fühlen sich auch in dieser Zeit noch müde und angespannt.
Migräne bei Kindern
Bei Kindern ist die Diagnose der Migräne dagegen deutlich schwieriger, da Kopfschmerzen vollkommen fehlen können oder aber den ganzen Kopf betreffen. Wenn Kopfschmerzen auftreten, dauern sie in der Regel nicht so lange wie bei Erwachsenen. Dagegen sind sie häufiger Geruchsempfindlich, haben wiederkehrende Bauchschmerzen, Erbrechen und Übelkeit und ihnen ist schwindelig.
FAKT 3: DIE URSACHEN FÜR MIGRÄNE SIND NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG GEKLÄRT.
Durch eine Vielzahl an Untersuchungen konnten verschiedene Veränderungen im Gehirn im Laufe einer Migräne festgestellt werden. Basiert darauf haben sich verschiedene Hypothesen der Entstehung des Kopfschmerzes und der Aurasymptome ergeben.
Theorie der genetischen Ursache
Nach heutigen Wissenstand wird vermutet, dass es sich in den meisten Fällen bei Migräne um eine genetische Veranlagung handelt. Diese Hypothese wird dadurch gestützt, dass etwa zwei Drittel der Betroffenen Angehörige haben, die ebenfalls unter einer Form von Migräne leidet.
Die Theorie der genetischen Ursache besagt, dass wahrscheinliche auf Grund einer genetisch bedingten Disposition kommt es zu Beginn einer Attacke ausgelöst durch einen externen Trigger (siehe Auslöser) zunächst zu einer Veränderung der neuronalen Aktivität im Kortex. Dabei wird eine Überdosis an verschiedene Botenstoffe (Neurotransmitter) ausgeschüttet. Zu diesen Botenstoffen gehört Serotonin, der zunächst zu einer Verengung (Vasokonstriktion) der Blutgefäße in den Meningen (eine dünne Gewebsschicht, die das Gehirn umschließt und von vielen Blutgefäßen durchzogen ist) führt. Der daraus resultierende verlangsamte Blutfluss wird als Ursache der Aurasymptome angesehen. Es wird vermutet, dass eine zu starke Gegenregulation des Körpers zu viel Serotonin abbaut und es somit zu einer übermäßigen Erweiterung (Vasodilatation) Blutgefäße kommt. Die Aurasymptome verschwinden.
Vaskuläre Hypothese
Die vaskuläre Hypothese besagt, dass diese Dilatation der Gefäße über Dehnungsrezeptoren, die in den Gefäßwänden lokalisierten sind, zu einer Aktivierung der Schmerzfasern des Nervus trigeminus führt. Diese Aktivierung wird als Kopfschmerz wahrgenommen.
Neurogene Entzündungstheorie
Die neurogene Entzündungstheorie hingegen geht von einer aseptischen (sterile) Entzündung an den auf Grund der Freisetzung von Botenstoffen wie Substanz P, Neurokinin A und CGRP (Calcitonin gene related peptide) an den Nervenenden des Nervus trigeminus, die als Kopfschmerzen empfinden wird, aus.
Übererregbarkeitshypothese
Die Übererregbarkeitshypothese, auch Aura-Spreading-Depression Theorie genannt, vermutet. dass der Migränekopfschmerz auf eine Übererregbarkeit des Kortex auf Grund verstärkter Freisetzung von Kaliumionen zurückzuführen ist. Die Freisetzung von Kaliumionen führt zu einer Depolarisation im diesem Bereich der Hirnrinde, die sich denn binnen weniger Minuten über den Kortex hinweg ausbreitet. Bei dieser Theorie wird die Depolarisation des Sehzentrums für die Aurasymptome und die Depolarisation der Projektionsorte des Nervus trigeminus für die Kopfschmerzen verantwortlich gemacht.
Alle diese Erklärungsversuche sind bislang jedoch nur Hypothesen, die noch durch weitere Forschung belegt oder widerlegt werden müssen. Höchst wahrscheinlich ist ein Mix der verschiedenen Ansätze ursächlich für die Migräne und vom jeweiligen Patienten abhängig.
FAKT 4: VON STRESS, ÜBER UNREGELMÄSSIGEN SCHLAF HIN ZUR ERNÄHRUNG. DIE MIGRÄNEAUSLÖSER SIND VIELFÄLTIG.
Sogenannte Triggerfaktoren (Auslöser) erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Migräneattacke innerhalb eines kurzen Zeitraumes (üblicherweise 3 Monate), dauern Symptome ungewöhnlich lange (>= 72 Stunden Kopfschmerz oder >= 60 Minuten Aurasymptome) oder kommt es zu einer starken Schädigung im Gehirn spricht man von Migränekomplikationen.
Eine genaue Auflistung der Kriterien der einzelnen Migräneformen und der Migränekomplikationen, wie sie von der International Headache Society (IHS) vorgegeben sind, befindet sich am Ende des Artikels. ...zur Klassifikation
Attacken und/oder Kopfschmerz, bei dem ein Merkmal fehlt, das erforderlich ist, um die Kriterien einer der unten aufgeführten Migräneformen vollständig zu erfüllen, wird als wahrscheinliche Migräne der am besten passenden Form angesehen.
FAKT 6: DIE MIGRÄNE WIRD AUF BASIS DER BESCHWERDEN DIAGNOSTIZIERT.
Die Diagnose erfolgt in Form einer Befragung des Patienten mit Erhebung der Krankengeschichte, der sogenannten Anamnese. Ein Kopfschmerztagebuch bzw. Kopfschmerzkalender kann dabei sinnvoll sein.
In erster Linie muss bei der Diagnose ein sekundärer Kopfschmerz (z.B. auf Grund von Tumoren, Traumata, Blutungen oder Entzündungen) ausgeschlossen werden. Dazu dienen die allgemeine körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen und vor allem die Bildgebung CCT oder MRT zum Ausschluss intrakranieller Prozesse/ Veränderungen. Zusätzlich kann noch ein sog. EEG durchgeführt werden. Migräne ist letztlich eine typische Ausschlussdiagnose, d.h., wenn man keinen Grund findet bzw. andere Möglichkeiten ausgeschlossen hat, so stellt man die Diagnose Migräne.
FAKT 7: MIGRÄNE IST MIT HILFE EINER INDIVIDUELL ABGESTIMMTEN THERAPIE GUT BEHANDELBAR.
Migräne ist zwar nicht heilbar, aber sie kann in den allermeisten Fällen erfolgreich mit nicht-medikamentösen und medikamentösen Maßnahmen behandelt werden. Da Migräne sich individuell sehr unterschiedlich äußern kann, gibt es nicht den einen Behandlungsweg für alle Betroffenen. Jeder Patient muss für sich und entsprechend der individuellen Symptomatik, in Zusammenarbeit mit einem Arzt, die beste Therapie herausfinden. Dabei unterscheidet man die Akuttherapie während einer Attacke von der Prophylaxe.
Wichtig ist, dass die medikamentöse Behandlung immer mit einem Arzt, der die geeignetsten Mittel für den jeweiligen Schweregrad der Migräne auswählen kann, abgesprochen werden sollte, damit die möglichen Nebenwirkungen und die Belastung für den Körper durch das Medikament möglichst klein gehalten wird.
Akuttherapie
nicht-medikamentösen Maßnahmen
Bereits bei Einsetzen einer Vorbotenphase aber auch noch währender Kopfschmerzphase können Migräneattacke abgemildert werden durch
Entspannungsübungen
Ruhe
Dunkelheit
Wärme oder Kälte
ausreichender Schlaf und
eine kohlenhydratreiche Mahlzeit direkt vor dem Schlafen.
Bei Menstruations-assoziierter Migräne kann dieses Vorgehen auch helfen, wenn es ab einem Tag vor dem Menstruationsbeginn durchgeführt wird.
medikamentösen Maßnahmen
Paracetamol
Ibuprofen
Acetylsalicylsäure (z.B. Aspirin)
Diclofenac
Naproxen
Triptane (sind sog. Serotoninrezeptorantagonisten; diese sollten jedoch erst bei schweren Attacken verwendet werden)
Antiemetika (Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen, wie z.B. Metoclopramid (MCP) oder Domperidon)
Prophylaxe
nicht-medikamentösen Maßnahmen
Auslöser vermeiden
regelmäßiger Tagesrhythmus (auch an Wochenenden!)
feste Zeiten für Mahlzeiten
leichter Ausdauersport
Entspannungstraining
Akupunktur
Biofeedback
medikamentösen Maßnahmen (indiziert bei > 3 Attacken pro Monat oder prolongierten Attacken > 48 Stunden)
Betablocker (z.B. Propranolol, Metoprolol)
Flunarizin (sog. Calcium-Antagonist)
Amitryptilin (sog. Trizykisches Antidepressivum)
Naproxen
Valproat
Topiramat
Antidepressiva
hochdosiertes Magnesium
Therapie bei Kindern
Bei Kindern stehen neben nicht-medikamentösen Maßnahmen verschiedene Schmerzmittel zur Verfügung. Als migränespezifisches Medikament ist allerdings nur eines der Triptane in Form eines Nasensprays für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen
FAKT 8: DURCH MIGRÄNE FALLEN JÄHRLICH ETWA 5 MILLIARDEN EURO KOSTEN AN – ÜBERWIEGEND DURCH ARBEITSAUSFÄLLE.
Für Deutschland wurden bislang keine exakten Berechnungen über die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Migräne entstehen, erstellt. Es gibt jedoch eine Modellrechnung. Diese setzt sich aus den direkten Kosten (Behandlung und Vorbeugung) und den indirekten Kosten (Arbeits- und Produktivitätsausfall) zusammen.
Bei den direkten Kosten schlagen zum einen die verschreibungspflichtigen Migränemedikamente zu Buche, die in mittelschweren bis schweren Fällen vom Arzt verschrieben werden. Die Kosten bei den Krankenkassen durch diese Medikamente belaufen sich jährlich auf ca. 70 Millionen Euro. Dies umfasst noch nicht die nicht-verschreibungspflichtigen Medikamente wie Paracetamol, Ibuprofen oder das frei erhältliche Nanatriptan. Für Migräne wird ein Marktanteil von 4-16% der verkauften rezeptfreien Schmerzmittel geschätzt. Dies würde weitere Kosten von 100-500 Millionen Euro entsprechen. Dies schließt aber noch immer nicht die Medikamente ein, die gegen die Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen verschrieben werden. Die Kosten der stationären Behandlung liegen jährlich bei etwa 30 Millionen Euro und die der ambulanten Behandlung zwischen 40 und 150 Millionen.
Den größten Teil machen die indirekten Kosten aus. Diese können jedoch nur grob geschätzt werden, da keine empirischen Daten dazu vorliegen. Geht man davon aus, dass 10% der Deutschen unter Migräne leidet, von denen mindestens 50% erwerbstätig sind und die durchschnittliche Anzahl an Migränetagen pro Monat 2,8 Tagen beträgt, ergeben sich 130 Millionen Migränetage pro Jahr. Prozentual entfallen davon über 75 Millionen auf Arbeitstage. 50% entfallen dabei auf vollständige Arbeitsausfälle und 50% auf verminderte Produktivität. Daraus ergeben sich Kosten in Höhe von etwa 4 Milliarden Euro (entspricht 80% der Gesamtkosten).
Es gibt aber auch noch tertiäre Kosten als Folgekosten falscher Behandlungen oder Invalidität. Diese betragen weitere 300 Millionen Euro.
Rechnet man diese Kosten zusammen, kommt man auf ca. 5 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten allein durch Migräne.
Direkte Kosten
Kosten der ärztlich rezeptierten Migränemedikamente: 70 Mio. €
Kosten frei verkauften Migränemedikamente: 100-500 Mio. €
Kosten der ambulanten ärztlichen Behandlung wegen Migräne: 40-150 Mio. €
Kosten der stationären Behandlung wegen Migräne: 30 Mio. €
Indirekte Kosten
Fehltage und eingeschränkte Produktivität am Arbeitsplatz: 4 Mrd. €
Tertiäre Kosten
Folgekosten durch falsche Behandlung oder Invalidität: 300 Mio. €
Mehr Infos auf: www.Bomedus.com