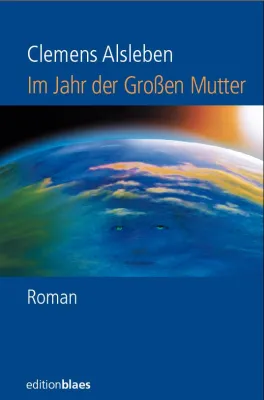(openPR) Bonn/Berlin – Hin und wieder tut eine radikale Renovierung gut. Das dachten sich auch die Macher der Fachzeitschrift Internationale Politik (IP) http://www.internationalepolitik.de und legen jetzt eine aufgepeppte Version der renommierten Publikation vor, die schon 1945 als Europa-Archiv ins Leben gerufen wurde. Nicht viele Zeitschriften halten so lange durch. Und noch weniger sehen so frisch aus wie die neue IP. Chefredakteurin Sabine Rosenbladt, früher unter anderem bei der Woche, beruft sich in ihrem Editorial auf anglo-amerikanische Vorbilder. Dort sei es möglich, "zugleich wissenschaftlich präzise und sprachlich elegant zu schreiben". Mit dem aktuellen Heft ist ihr dieser ehrgeizige Versuch gelungen. Fast alle Autoren halten sich an das Versprechen, das im Vorwort ausgedrückt wird. Rosenbladt wörtlich: "Auch vor journalistischen Formaten – Interview, Porträt, Reportage – scheuen wir nicht zurück." Ein solches Vorhaben würde manchem Verantwortlichen verstaubter Fachzeitschriften aus der Historikerzunft den Angstschweiß ins Gesicht treiben. Die Angehörigen der deutschen Historikerzunft scheuen ja bisweilen die Verquickung von Wissenschaft und Publizistik – um ein altes Klischee zu bemühen – wie der Teufel das Weihwasser.
Die IP besticht durch Themenreichtum und –vielfalt und scheut auch keine Übergänge in die Innenpolitik. Bei den Autoren handelt es sich um eine gelungene Mischung aus älteren und jüngeren Leuten sowie rechten, linken und mittigen Vertretern, die eins gemeinsam haben: Sie langweilen nicht. Ein gutes Beispiel liefert der mittlerweile 70-jährige Politikwissenschaftler Hans-Peter Schwarz, der eine Kostprobe aus seinem im März erscheinenden Buch zur Verfügung gestellt hat. Seine Diagnose: Das größer gewordene Deutschland hat seine Rolle noch nicht gefunden und den Kompass verloren. Anspruch und Wirklichkeit stehen in scharfem Kontrast. Zum einen erhebt die rot-grüne Bundesregierung den gar nicht unbescheidenen Anspruch, Europa müsse Weltmacht werden. Und ein wenig wie die Herren der Welt möchten sich Fischer und Schröder dabei auch fühlen. Zum anderen aber ist Deutschland in den Worten von Schwarz "ein Sanierungsfall(...), von dem nur die Regierung und deren Claqueure sagen, man dürfe das Land ‚nicht schlecht reden‘".
Was fehlt der "Zentralmacht Europas"? Diese Frage treibt den Autor um. Und er ist sich sicher: Es fehlen die Staatsräson, der kalte Blick auf die eigenen nationalen Interessen und die nüchterne Erkenntnis, dass Fantasien vom europäischen Super- oder Bundesstaat vielleicht nur noch in Berlin, Luxemburg und Belgien geträumt werden. "Europa bauen, die deutsche Staatsräson eher vergessen, das ist schon seit einigen Jahrzehnten der neue deutsche Sonderweg". Die Demokratie gerät bei dieser Entwicklung aus dem Blick. Denn schon Ralf Dahrendorf – so Schwarz – habe richtig beobachtet, dass alles, "was in Europa entschieden wird, demokratischer Kontrolle entzogen ist. Mehr Europa heißt immer auch weniger Demokratie."
Scharz ist nicht parteiisch. Für ihn ist klar: Weder Regierung noch Opposition haben den richtigen Schimmer, wie es mit Deutschland weiter gehen soll. Gerhard Schröder träumt von einem neuen deutschen Weg. Ob darunter die Abkehr von den Vereinigten Staaten und die Kumpanei mit Halbdemokraten wie Putin sowie der Ausverkauf der deutschen Interessen beim EU-Beitritt der Türkei verstanden wird, sei dahin gestellt. Doch auch die Union weiß nicht weiter. Wäre sie mutig, so müsste sie feststellen: "Europa als weiterhin hervorragend wichtiges, aber doch der wohlverstandenen deutschen Staatsräson logischerweise nachgeordnetes Interesse. Funktionales Verständnis der EU, aber nicht mehr die Fata Morgana des ‚unvollendeten Bundesstaates‘ Europa."