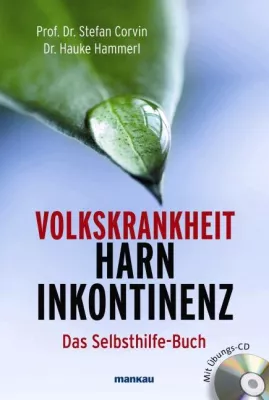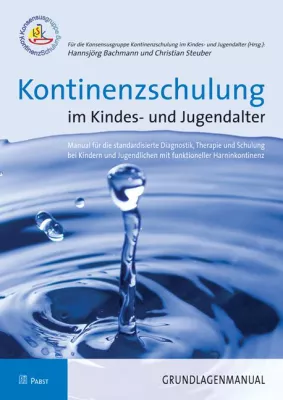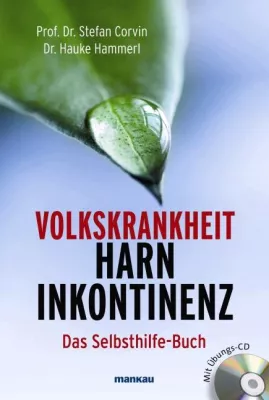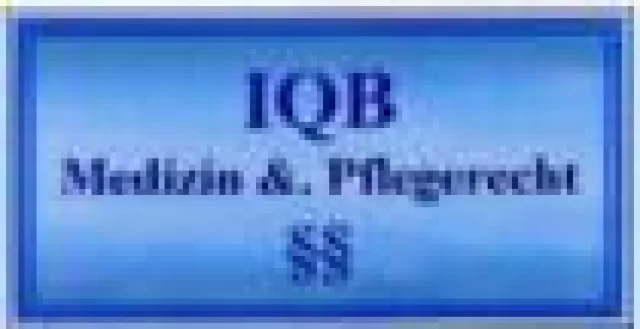(openPR) Kassel, im Februar 2012. Vielen Betroffenen von Inkontinenz ist nicht bewusst: Harninkontinenz ist in den meisten Fällen heilbar – neben Medikamenten und Krankengymnastik werden dabei auch zunehmend operative Möglichkeiten genutzt.
Rund neun Millionen Menschen leiden in Deutschland an Harninkontinenz – und die Dunkelziffer ist hoch: Aus Scham sprechen rund 30 Prozent der Betroffenen das Problem nicht einmal im engsten Familienkreis oder in der Arztpraxis an und leiden im Stillen. Dabei kann dem, der einen Mediziner aufsucht, geholfen werden: Ein erfahrener Arzt kann Ausmaß, Anlass und Begleitumstände des unkontrollierten Harnverlustes richtig einordnen und auf Grundlage von speziellen Diagnoseverfahren wie Messungen des Blasendrucks eine geeignete Therapie festlegen. Neben den sogenannten „konservativen“ Therapiemöglichkeiten wie Medikamenten, die hemmend auf die Harnblase wirken, und Krankengymnastik mit Übungen zur Stärkung des Beckenbodens, werden dabei zur Behandlung von Harninkontinenz zunehmend auch operative Möglichkeiten genutzt – die technische Revolution der vergangenen Jahre macht es möglich. Inzwischen stehen über 300 verschiedene Verfahren zur Verfügung, so Prof. Dr. Heinz Kölbl, Zweiter Vorsitzender der Deutschen Kontinenz Gesellschaft und Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er rät allerdings erst zu einer Operation, wenn die konservative Behandlung fehlschlägt. Auch mahnt der Experte zur Vorsicht: „Die optimale Operationsmethode gibt es nicht. Wichtig ist, eine genau auf den Patienten abgestimmte Therapiemöglichkeit zu finden – Voraussetzung dafür ist eine sorgfältige Diagnose.“ Im Zweifelsfall sollte deshalb ein Spezialist für Harnwegserkrankungen vor der Operation zurate gezogen werden.
„Schuld“ an einer Harninkontinenz können zumeist zwei ganz unterschiedliche Erkrankungen der Harnblase sein, die entsprechende Behandlungsarten erfordern: Bei der sogenannten „Belastungsinkontinenz“ ist die Beckenbodenmuskulatur geschwächt, sodass der Schließmuskel-Mechanismus der Harnröhre gestört ist. Bei einer „Dranginkontinenz“ hingegen ist die Harnblase überaktiv – dies lässt sich in den meisten Fällen mit Medikamenten behandeln, konstatiert Prof. Heinz Kölbl. Ist diese Therapie allerdings nicht erfolgreich, kommen vor allem zwei Operationsmethoden in Betracht:
Eine Therapieform ist die „Neuromodulation“ – eine schmerzfreie elektrische Stimulierung der Blase und der den Schließmuskel versorgenden Nervenfasern, die für die fehlgesteuerte Blasenfunktion verantwortlich sind. Dazu werden nach einer siebentägigen Testphase dauerhaft dünne Kabel an die Nerven im Steißbein-Bereich implantiert. Zusätzlich wird auch ein „Blasenschrittmacher“ eingesetzt, der es den Patienten per Fernbedienung ermöglicht, das Wasserlassen gezielt auszulösen oder auch zu unterdrücken – je nachdem, ob und wie stark die Stimulation eingestellt ist.
Und auch Botulinum Toxin A, im Volksmund als Botox bekannt, hat nicht nur in der Schönheitschirurgie seine Berechtigung, sondern auch bei der Behandlung von Inkontinenz: Stark verdünnt während einer Blasenspiegelung mit einer feinen, flexiblen Nadel in den Blasenmuskel injiziert, hilft das muskellähmende Nervengift binnen kurzer Zeit, den Muskel zu beruhigen und die Beschwerden der Patienten damit zu lindern. „Aufgrund der langen Wirksamkeit und unproblematischen Handhabung stellt für mich Botulinumtoxin sozusagen das ´Viagra der Harnblase`dar“, erläutert Prof. Klaus-Peter Jünemann, Direktor der Klinik für Urologie am Universitäts-Klinikum Schleswig-Holstein und Erster Vorsitzender der Deutschen Kontinenz Gesellschaft. „Botox hat und wird auch weiter zu einem Paradigmenwechsel in der Behandlung unkontrollierter Blasenfunktionen führen.“
Bei einer Beckenboden-Schwäche hingegen können sogar schon sehr kleine Eingriffe das Problem beheben: Bei Korrekturoperationen an den verschiedenen inneren Geschlechtsorganen (Gebärmutter, Blase und Scheide) sind zumeist nur kleine Schnitte am Unterbauch fällig – wenn überhaupt, denn auch über die Scheide können die Operationen durchgeführt werden. Zu den sogenannten „minimalinvasiven“ Methoden zählt zum Beispiel die Einführung von Netzbandschlingen, auch Kontinenzbändchen genannt. Diese werden um die Harnröhre gelegt und verhindern, dass diese unter Belastung absinkt – in neun von zehn Fällen führt das zu einer Heilung der Inkontinenz, weiß Prof. Heinz Kölbl. Ein längerer Krankenhausaufenthalt ist so heutzutage nur noch in den wenigsten Fällen nötig: Liegt aber beispielsweise ein permanenter Urinverlust (zum Beispiel durch eine Fehlbildung des Harntraktes) vor, kommen komplexere operative Techniken zum Einsatz – bei extremen Ausnahmen kann sogar der Einsatz einer künstlichen Ersatz-Blase notwendig werden.
Durch die Vielzahl unterschiedlicher Therapieformen, die sich in den vergangenen Jahren herausgebildet hat, ist Inkontinenz also in den meisten Fällen heil- oder zumindest linderbar – die Betroffenen müssen nur von dieser Hilfe wissen, gibt der Zweite Vorsitzende der Deutschen Kontinenz Gesellschaft zu bedenken. Die Deutsche Kontinenz Gesellschaft bemüht sich aus diesem Grund seit über zwanzig Jahren, die Volkskrankheit Inkontinenz aus seinem Schattendasein zu befreien, um die Lebensqualität möglichst vieler Menschen mit Kontinenz-Problemen zu verbessern. Aktuelle Schätzungen gehen dabei davon aus, dass jede vierte Frau und jeder zehnte Mann an Inkontinenz erkrankt ist.
Mehr Informationen befinden sich auf der Website der Deutschen Kontinenz Gesellschaft.