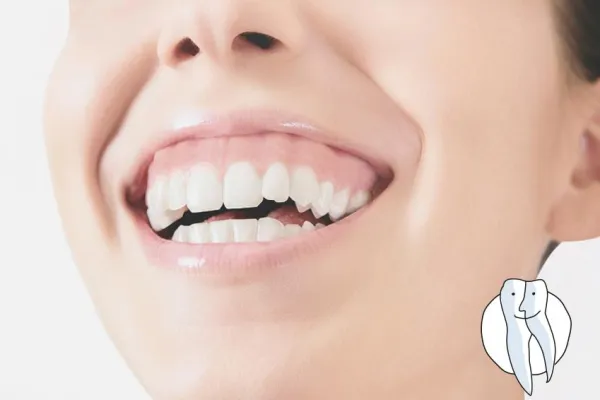(openPR) Schnabelkürzen ist für die Tiere mit furchtbaren, lebenslangen Schmerzen verbunden. Deshalb lehnt die "Arbeitsgemeinschaft für artgerechte Nutztierhaltung" e.V. diesen praxisüblichen, extrem tierschutzwidrigen Eingriff ab und fordert vom Gesetzgeber das Verbot. Der Vorsitzende der AGfaN, Eckard Wendt, begründet diese Forderung in einer "Stellungnahme zum Kürzen der Schnabelspitze bei Nutzgeflügel" am Beispiel von Mastputen:
1. Grundlagen
Der Schnabel ist das wichtigste Tastorgan der Vögel und aufgrund der Fülle der in ihm befindlichen sensorischen Rezeptoren bei der Nahrungssuche unerlässlich zur Unterscheidung und Bewertung der Eigenschaften der zur Prüfung aufgenommenen Objekte. Nahe der Spitze des Oberschnabels befindet sich das „Bill Tip Organ“, das aus einer sehr großen Zahl sensorischer Rezeptoren besteht. Es hat deshalb eine besondere Bedeutung.
Mastputen der konventionellen Wirtschafts-Hybridlinien, in Deutschland vorwiegend BUT BIG 6, werden fast ohne Ausnahmen die Oberschnäbel gekürzt (kupiert), um dem Federpicken sowie dem daraus resultierenden Kannibalismus unter den Tieren vorzubeugen. Es wird in der Diskussion immer wieder darauf verwiesen, dass mit den kupierten Schnäbeln Federn nicht mehr festgehalten und ausgerissen werden können, weil der Schnabelschluss nicht möglich ist. In der öffentlichen Diskussion wird seitens der Geflügelhalter betont, dass doch „nur die Schnabelspitze“, die doch lediglich wie ein Fingernagel aus Horn bestehe, entfernt werde. Verschwiegen wird fast immer, dass es sich um einen Eingriff in lebendes, das heißt durchblutetes Gewebe handelt und durch die Amputation des „Bill Tip Organs“ etwa 80% der sensorischen Rezeptoren entfernt werden. Deshalb ist nicht nur die Maßnahme sehr schmerzhaft, sondern es muss auch ein fortdauernder Phantomschmerz angenommen werden, der vergleichbar dem von Beinamputierten ist, die vor der Operation keiner Desensibilisierungstherapie unterzogen wurden (was z. B. auf Amputationen nach Unfällen oder durch Kriegseinwirkung zutrifft).
Zum Kupieren der Schnäbel werden bei Puten sogenannte „Laser“ verwendet. Beim älteren Gerätetyp wird mittels eines Lichtbogens (wie bei einem Schneidbrenner) ein Loch in den Oberschnabel gebrannt, so dass die Spitze nach etwa acht Tagen abfällt. Das modifizierte neuere Verfahren verwendet Infrarotlicht, dessen Hitzeeinwirkung den Schnabel schädigt, ohne dass ein Loch hineingebrannt wird, aber letztlich dieselbe Wirkung für das Tier zeitigt. Das nach der AVV rechtlich mögliche Kupieren bis zum 10. Lebenstag mittels eines heißen Messers oder einer zweiseitig schneidenden Schere ist nicht mehr üblich, weil bei dem zuvor beschriebenem, unmittelbar nach dem Schlüpfen noch in der Brüterei vorgenommenem Eingriff kein zusätzliches Handling erforderlich ist. Die Prozedur, bei der es sich um eine Amputation im Sinne des Tierschutzgesetzes (§6[3]1) handelt, erfolgt bei allen Verfahren ohne Betäubung. Im Gegensatz zum Knochengewebe und Knorpel sowie Horn werden nach der Entfernung des „Bill Tip Organs“ keine neuen Nerven-Rezeptoren gebildet.
Hinsichtlich negativer Begleiterscheinungen beim und nach dem Schnabelkürzen verweisen wir auf die Ausführungen von S. Petermann und H.-H. Fiedler (Tierschutzdienst Niedersachsen), die hierüber ausführlich berichteten (Tierärztlichen Umschau 54, 8 – 19 [1999]).
2. Wirtschaftliche Bedeutung des Schnabelkürzens
Die Putenmast erfolgt meistens in Wirtschaftsbetrieben bei intensiver Aufstallung mit bis zu offiziell zulässigen 55kg Lebendgewicht / m²bei Hähnen entweder in (herkömmlichen) fensterlosen Dämmerlichtställen oder in Louisianaställen (mit Beton-Bodenplatte) bei ggf. durch Vorhänge gedämpftem Tageslichteinfall, der irreführend auch als „Naturstall“ bezeichnet wird.
Bedingt durch die enge Aufstallung von ca. 5 Puten bzw. 2,5 Putern je Quadratmeter sind die Tiere nicht in der Lage, Individualabstände einzuhalten, bei Rangordnungskämpfen können sie einander nicht ausweichen. Gegen Ende der Mast sind sie aufgrund der Enge im Stall sowie insbesondere auch wegen der unnatürlichen Gewichtszunahme und der daraus resultierenden Auswirkungen auf den Organismus (Skelettschäden, Überlastung des Herz-Kreislauf-Systems) nicht mehr imstande, bei Pickattacken auszuweichen und einen geschützten Platz aufzusuchen.
Die Putenwirtschaft begründet die enge Aufstallung mit dem ökonomischen Wettbewerbsdruck. Sie wiegt die Beeinträchtigungen der Tiere, die sich bei der Engstaufstallung durch das Schnabelpicken und den Kannibalismus ergeben, gegen die des Schnabelkürzens ab und verweist darauf, dass die „Mastleistung“ (Performance) letztlich keine Unterschiede zwischen kupierten und nicht-kupierten Tieren ausweist. Der Eingriff wird letztlich mit der geringeren Zahl von Verlusten gerechtfertigt.
3. Tierschutzrecht
Der in § 1 des Tierschutzgesetzes formulierte „Grundsatz“, „aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen“ gilt auch für Nutztiere.
Damit unterliegt die Nutztierhaltung prinzipiell auch dem § 2, wonach „ wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat … das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen (muss), (nicht ) die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung … so einschränken (darf), dass ihm Schmerzen, vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden …“.
Außerdem stehen die Tiere seit dem 17.05.2002 auch unter dem Schutz von Art. 20a des Grundgesetzes. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der erneuten Güterabwägung,
4. Güterabwägung
Auch Puten sind als landwirtschaftliche Nutztiere leidensfähige Mitgeschöpfe, die unter gesetzlichem Schutz stehen. Wenn wir sie aus wirtschaftlichen Gründen nutzen, dann ist es gemäß Tierschutzgesetz unsere gesellschaftliche Pflicht, ihnen Schmerzen und Leiden zu ersparen, wann immer dies möglich ist.
Die Versuche der Rechtfertigung des schmerzhaften, die Tiere während ihrer Lebensspanne stark beeinträchtigenden Schnabelkürzens mit der Begründung, nur so könnten gegenseitige Verletzungen zu verhindert werden, weisen wir als untauglich zurück, solange sich die
Putenwirtschaft weigert, für die Tiere erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen. Vorrangig ist deshalb zu sorgen für
- ein größeres Platzangebot (von maximal 40 kg Lebendgewicht / m²)
- angereicherte Haltungsumwelt (durch Beschäftigungsmaterial und Ergänzung des Futterkonzentrats durch Raufutter wie Stroh in Körben, bepickbares Futter wie Rüben)
- Rückzugsmöglichkeiten durch Schaffung mindestens einer zweiten Ebene
- Einbau von der jeweiligen Körperentwicklung angepassten Sitzstangen
- Unterteilung des Stalls durch Strukturelemente, durch die kleinere Sozialgruppen entstehen.
Da Puten tagaktive Vögel sind, ist Tageslicht zu gewähren. Ergänzendes Kunstlicht muss flackerfrei sein (Hochfrequenzlampen), damit die Tiere nicht durch den Stroboskop-Effekt (vergleichbar mit flackernder Disco-Beleuchtung) beunruhigt werden. Auch muss das Licht über einen hohen UV-Anteil verfügen, damit die Tiere normal sehen können.
5. Zusammenfassung
Das Schnabelkürzen stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das Wohlbefinden des Vogels dar, weil er seines wichtigsten Tastorgans beraubt wird und sehr schmerzhaft ist. Da Federpicken und Kannibalismus auch durch verbesserte Haltungsbedingungen verhindert werden können, wie sie bei der Mast von Kelly Bronze Puten, die einen wesentlich wehrhafteren Schnabel haben, üblich sind. lehnt die Arbeitsgemeinschaft für artgerechte Nutztierhaltung e.V. (AGfaN) das Schnabelkürzen strikt ab.
Eckard Wendt, Vorsitzender der AGfaN e.V.
***