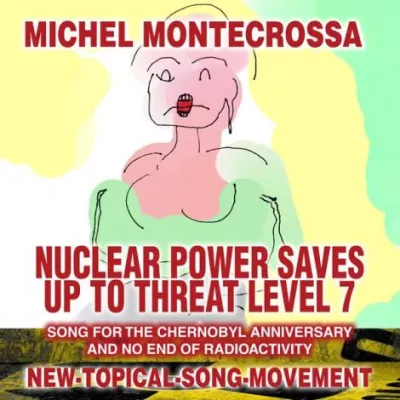(openPR) Botschaft der Republik Belarus in der Bundesrepublik Deutschland
Pressemitteilung ¹ 28
Berlin, den 25. April 2005
Zum 19. Jahrestag der Tschernobylkatastrophe
Am 26. April 2005 jährt sich die Katastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl zum 19 Mal. Ungeachtet der Tatsache, dass der Super-GAU fast zwei Jahrzehnte zurückliegt, sind seine Folgen ein Faktor, welcher die sozial-wirtschaftliche Entwicklung der Republik Belarus, des am meisten von dem atomaren Unglück betroffenen Landes, nach wie vor stark beeinträchtigt.
Etwa 21% des Territoriums der Republik sind mit Radionukliden verseucht. Der Gesamtschaden für das Land wird auf 32 Bruttoinlandsprodukte oder umgerechnet 235 Mio. USD geschätzt. Fast 2 Mio. Einwohner der Republik Belarus wurden von der Tschernobylkatastrophe direkt oder indirekt betroffen. Heutzutage wohnen in den vom Fallout betroffenen Gebieten ca. 1,6 Mio. Menschen, darunter 420 Tsd. Kinder und Jugendliche. Vor allem sehen sich diese Regionen mit der Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur, Abwanderung der Arbeitskräfte und demographischen Problemen konfrontiert.
Neben den Maßnahmen, die durch den belarussischen Staat getroffen werden, spielt die ausländische Hilfe eine wichtige Rolle bei der Linderung der Katastrophenfolgen. Im Laufe der Jahre hat die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich eine neue Dimension gewonnen. Der Ausgangspunkt dafür war der 2002 veröffentlichte UNO-Bericht "Humanitäre Folgen der Havarie im Atomkraftwerk von Tschernobyl. Strategie der Rehabilitation". Die im Dokument formulierten Empfehlungen beinhalten die Notwendigkeit eines Übergangs von der rein humanitären Hilfe zur sozial-wirtschaftlichen Rehabilitation und Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung der betroffenen Regionen. Diese Herangehensweise wurde in den Resolutionen der 56. und 58. Tagungen der UNO-Generalversammlung bekräftigt.
Neue Tschernobylprogramme wurden von der Weltgemeinschaft ins Leben gerufen. Das Internationale Forschungs- und Informationsnetz für Tschernobyl hat seine Arbeit im Juni 2003 unter der UNO-Schirmherrschaft aufgenommen. Es stellt ein Koordinierungsmechanismus für umfassende Forschungen von Folgen der Katastrophe dar, die durch die UNO-Institutionen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern (Belarus, die Ukraine, Russland) durchgeführt werden.
Das Internationale Wissenschaftliche Forum für Tschernobyl wurde im Februar 2003 gegründet. Das Hauptziel der Organisation ist es, die Erfassung und Systematisierung der Daten über die Havariefolgen vorzunehmen sowie einheitliche Herangehensweisen an die Folgeneinschätzung auszuarbeiten. Daran beteiligen sich sowohl die betroffenen Staaten als auch viele internationale Organisationen wie z.B. die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) u.a.m.
Die Republik Belarus hat als erstes unter den in die Mitleidenschaft gezogenen Ländern mit der Ausarbeitung und Umsetzung von internationalen Tschernobylprogrammen einer neuen Generation begonnen, die auf eine komplexe Rehabilitation und Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung der kontaminierten Regionen gerichtet sind. So wurde im Oktober 2003 in Minsk die Deklaration des von Belarus erarbeiteten Programms CORE (Zusammenarbeit für die Rehabilitation) unterzeichnet, das in Übereinstimmung mit den Prinzipien der neuen Strategie der internationalen Zusammenarbeit in Tschernobylfragen und den nationalen Prioritäten steht.
Das Programm sieht eine umfassende Problemlösung auf solchen Gebieten wie Gesundheitswesen, Umweltschutz, wirtschaftliche Entwicklung, nuklearer Schutz, Bildung, Erhaltung des Kulturerbes vor. Das Ziel von CORE ist es, die Lebensstandards der betroffenen Bevölkerung durch Realisierung von zusammenhängenden Projekten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu erhöhen. Die dabei eingesammelten Erfahrungen werden allen Interessenten zur Verfügung stehen.
Einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der langfristigen Folgen der Katastrophe leistet die Europäische Union im Rahmen des Programms TACIS sowie einzelne Länder.