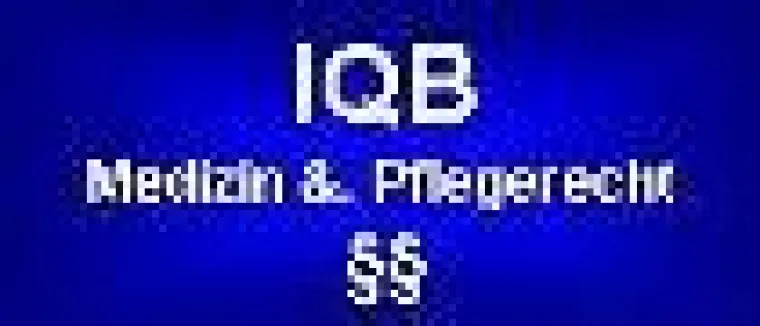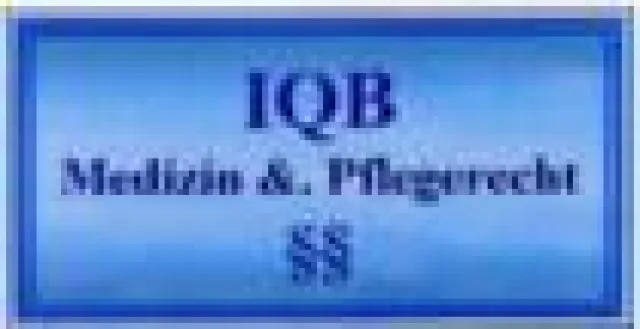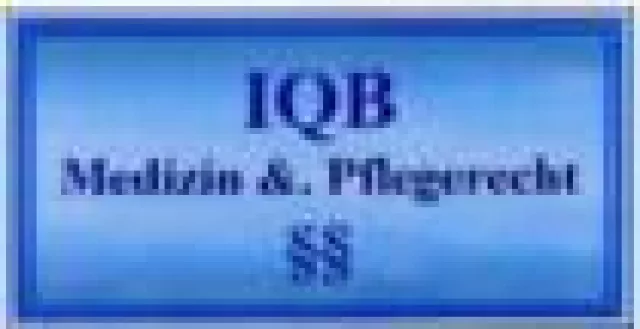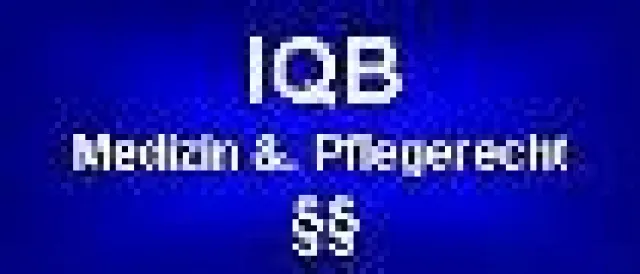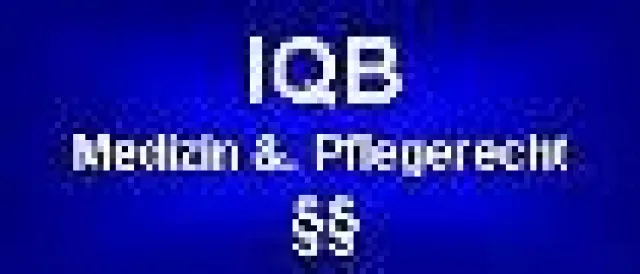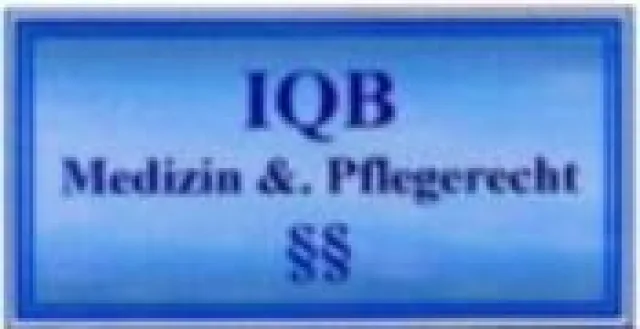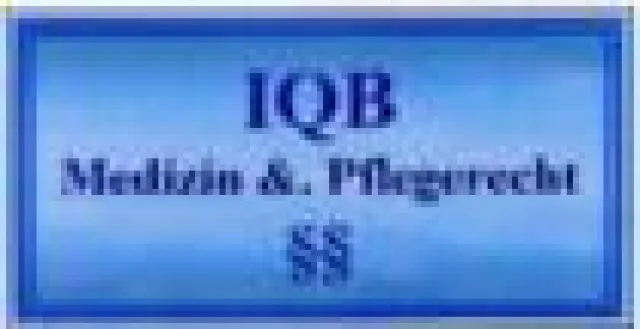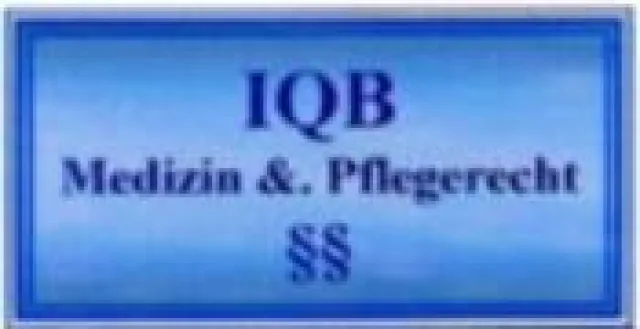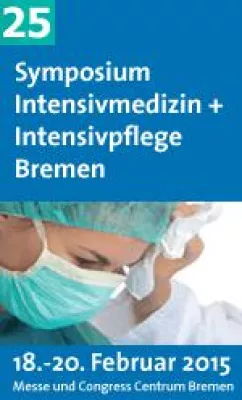(openPR) In der andauernden Debatte über das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger sehen wir uns unvermindert mit dem Vorwurf namhafter Medizinethiker konfrontiert, ggf. unser Selbstbestimmungsrecht überzustrapazieren und ihm eine Dominanz beizumessen. Es wird der „Verkürzung“ des Selbstbestimmungsrechts das Wort geredet und einige Medizinethiker adressieren daher wohl an die eigene Zunft die Forderung, solchen Sichtweisen keinen Vorschub mehr zu leisten.
Paradigmatisch hierfür steht das unverminderte Bemühen des Medizinethikers Axel W. Bauer, der uns in regelmäßig erscheinenden Statements und Beiträgen von seiner Sicht der Dinge zu überzeugen versucht, ohne hierbei vielleicht zu erkennen, dass eben aus der Sicht der Verfassungsrechtswissenschaft das Selbstbestimmungsrecht der Patienten weniger ein philosophischer, denn mehr ein Verfassungsbegriff ist, den zu interpretieren in erster Linie nicht den Philosophen aufgegeben ist, sondern den ambitionierten Juristen, die ihre Exegese von bedeutsamen Grundrechten tunlichst frei von höchst individuellen, ethischen und moralischen Botschaften halten sollten.
Das die Dominanz der Verfassungsrechtswissenschaft in der Debatte eine ungleich höhere Bedeutung einnimmt, schließt zwar einen Dialog mit anderen Wissenschaftsdisziplinen nicht aus, rückt aber einige Maßstäbe und damit auch Grenzen zurecht, die nicht selten von den Medizinethikern – so scheint es jedenfalls – als „lästig“ empfunden werden.
Ist schon das Verhältnis zwischen Juristen und Mediziner nicht ganz „stressfrei“ – gelegentlich wurde behauptet, das Arztstrafrecht treibe seltsam hässliche Blüten“ - so sieht sich nunmehr offensichtlich auch die Verfassungsrechtswissenschaft in Teilen jedenfalls mit einem ähnlichen Vorwurf seitens der Medizinethiker konfrontiert, in dem eben dem Selbstbestimmungsrecht einen verfassungsnormativer Rang eingeräumt wird, von dem nicht ohne Bedacht behauptet wird, es sei im Zweifel neben der „Würde des Menschen“ ein weiterer Höchstwert in unserer Verfassung, der zugleich über das „Lebensrecht“ steht.
Dass ein solche verfassungsrechtliche „Bewertung“ des Selbstbestimmungsrechts zu nachhaltigen Irritationen führen muss, liegt zwar auf der Hand, aber ändert freilich nichts an den damit verbundenen Folgen – die, wie im Übrigen hier betont werden soll, durchaus auch mit der These eines Kantschen Verbots der „Selbstentleibung“ brechen.
Und in der Tat: dass Verfassungsrecht und hier freilich näher die Grundrechte treiben in einem freiheitlichen Verfassungsstaat Blüten, die weder hier auf Erden noch im Himmel welken werden und sofern Gefahren einer Denaturierung drohen, werden wir uns zu Worte melden müssen – auch auf die Gefahr hin, dass die Debatte in der Auseinandersetzung mit den Medizinethikern etwas vitaler als bisher zu führen ist.
Aufklärung erscheint mehr denn je erforderlich zu sein, denn auch die Medizinethik erfährt ihre unmittelbaren und in Anbetracht der Bedeutung unserer Grundrechte in einem säkularen Verfassungsstaat gelegentlich unübersteigbaren „Grenzen“ aus der Verfassung, die nicht zur Disposition stehen.
Nicht die ständig wiederholte Rede von einem selbstbestimmten Reden muss uns irritieren, sondern vielmehr die gebetsmühlenartig vorgetragenen Bedenken gegenüber einem überragenden Grundrecht, namentlich dem Selbstbestimmungsrecht, dass erkennbar aus der Sicht einiger Medizinethiker mit einem „neuen Programm“ versehen werden soll.
In diesem Sinne möchte ich denn auch auf einen Beitrag von Axel W. Bauer verweisen, der zum weiteren Nachdenken und Diskussion anregen könnte:
Grenzen der Selbstbestimmung am Lebensende: Die Patientenverfügung als Patentlösung?, in Zeitschrift für medizinische Ethik 55 (2009), S. 169-182.
Besonders problematisch erscheint mir dabei allerdings auch der Umstand, dass der dort vorgetragene Fall aus der Praxis der klinischen Ethikberatung (!) (Bauer, aaO., S. 181) als „nicht gelöst“ erscheinen muss, da insoweit ein ganz maßgeblicher Umstand nicht in die Bewertung eingeflossen ist: die Sichtweise der Klinik, in der dann der Patient verstorben ist!
Dies in einem Artikel mitzuteilen, wäre allerdings wünschenswert gewesen, bevor der Autor sich zu einem doch bedenklichen Resümee hinreißen lässt, wonach der Patient in „Folge einer Beendigung der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr nach wenigen Tagen starb, dank der viel gepriesenen, aber in diesem Falle verhängnisvollen Kombination aus Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.“
Hier wäre es schon von nicht unbedeutendem Interesse gewesen, den LeserInnen die „ethische Entscheidung“, besser noch die Entscheidung über die medizinische Indikation des Krankenhauses mitzuteilen, in das der Patient verlegt wurde.
Dass es gelegentlich zu unterschiedlichen Sichtweisen kommt, in deren Folge Patienten gelegentlich auch auf „Reisen“ geschickt werden müssen, hat uns zumindest der von Öffentlichkeit wahrgenommene Fall einer Wachkoma-Patientin aus Italien drastisch vor Augen geführt.
Ungeachtet dessen ist der Beitrag uneingeschränkt zum Lesestudium zu empfehlen, lässt er uns doch an der Sichtweise eines Medizinethikers über das Verfassungsrecht teilhaben, die nicht unwidersprochen bleiben darf.
Wenn Sie mögen, können Sie gerne hierzu einen in unserem BLOG einen Kommentar verfassen >>> http://patientenverfuegung-patientenautonomie.iqb-info.de/2009/07/21/grenzen-der-%e2%80%9emedizinethik%e2%80%9c-am-lebensende-medizinethische-%e2%80%9ebotschaften%e2%80%9c-als-patentlosung/