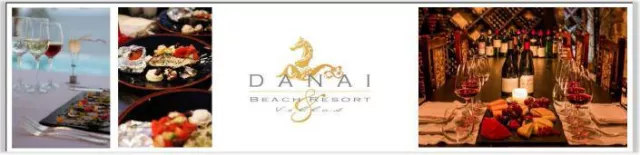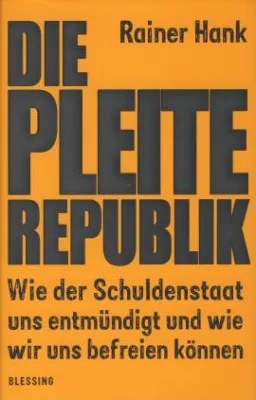(openPR) Gestern gab es aus Berlin und Paris einen mehr oder weniger überraschenden Vorschlag: die Staatseinnahmen und die europäischen Hilfen sollen zukünftig auf ein Sperrkonto überwiesen werden, dass dann zur Rückführung von Schulden verwendet werden soll. Griechenland würde so den Zugriff auf einen beträchtlichen Teil der Einkünfte verlieren.
Die Verweise auf die europäische Solidarität klingen vor diesem Hintergrund fast zynisch, denn dieses Sperrkonto soll zuerst die ausländischen Kapitalforderungen bedienen und erst dann die Wirtschaft im eigenen Land ankurbeln. Was bedeutet das in der Praxis?
Das Kapital wird nicht zur Schaffung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen verwendet, sondern es werden nur Kredite bedient und umgeschichtet. Der Wirtschaft Griechenlands wird noch mehr Kapital entzogen und die Rezessions-Spirale dreht sich weiter. Die Steuereinnahmen sinken weiter und noch mehr Arbeitsplätze gehen verloren.
Das Modell „Erst die Schulden abbauen, dann investieren“ hat bisher noch nicht funktioniert. Wenn ein Betrieb oder ein Land aus dem regulären Geschäftsbetrieb nicht genügend Gewinne erwirtschaftet, um die Kredite zurückzuzahlen, bringt es wenig, demnächst kein Material mehr einzukaufen und vorrangig Schulden zurückzuführen. Ohne Investition kein Wachstum, ohne Produkte kein Verkaufserlös.
Was wäre geschehen, wenn in der ehemaligen DDR kein Kapitaltransfer stattgefunden hätte und stattdessen die ohnehin zu geringen Steuereinnahmen zur Schuldenrückführung an ausländische Gläubiger verteilt worden wären?
Dieses System minimiert ausschließlich die Abschreibungen der Banken und Gläubiger, die vorher oft ohne Sinn und Verstand Kredite vergeben haben. Die Zeche zahlt wie immer die Mehrheit der Bevölkerung, und das europaweit.
In Griechenland wächst die Not in der breiten Bevölkerung immer mehr, die Arbeitslosigkeit steigt und in Zukunft sollen weitere Arbeitsplätze abgebaut werden. Dazu kommt eine Senkung der Mindestlöhne. Gleichzeitig schaffen die reichen Griechen ihre Euros gleich kofferweise aus dem Land. Jeder Wirtschaftspolitiker weiß, dass damit eine Staatskrise ausgelöst werden wird, die seit dem zweiten Weltkrieg in Europa beispiellos ist.
Und auch im Rest von Europa wird es eher den kleinen Mann treffen. Die Banken haben ihre Anlagen lange wertberichtigt und konnten mit Staatshilfen rechnen, die jüngsten und zukünftigen Kredite an Griechenland werden von Staatsbanken wie beispielsweise der KfW sowie der EZB, mittlerweile Hauptgläubiger Griechenland, vergeben – und für diese Banken haftet praktischerweise gleich der Steuerzahler direkt. Immerhin sparen wir uns hier die lästigen Umwege über Bankenhilfsprogramme.
Machen wir uns nichts vor: Griechenland ist faktisch pleite.
Die Regierung Griechenlands ist quasi handlungsunfähig, weil weitere Sparmaßnahmen nur mit weiteren Generalstreiks beantwortet werden. Und auch Europa ist handlungsunfähig, weil ein Investitionsprogramm für Griechenland politisch nicht durchsetzbar ist. Im Endeffekt stehen die Staatspleite und das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro außer Frage, denn es wird in absehbarer Zeit weder eine Fiskalunion noch eine Zentralregierung für alle Eurostaaten geben.
Die Folgen für den Euro lassen sich heute überhaupt noch nicht absehen. Je geordneter der Konkurs Griechenlands wird, desto geringer werden zunächst die Auswirkungen auf die Gemeinschaftswährung sein. Die Frage bleibt, was wir in Zukunft noch zu erwarten haben.
Spanien, Irland und Portugal stehen zumindest bereits einen Fußbreit über dem Abgrund und es bleibt abzuwarten, was in Zypern durch die Staatspleite Griechenlands geschehen wird. Und wer wird die EZB, mittlerweile Hauptgläubiger Griechenlands, stützen?
Aber lassen Sie uns optimistisch sein und davon ausgehen, dass wir die Krise in den nächsten Jahren irgendwie überstehen und wir uns in die nächste Wachstumsphase hineinretten. Wer wird dann die ungehemmte Kreditaufnahme von Ländern der Eurozone überwachen? Die Politik hat es leider schon nach der Bankenkrise versäumt, Maßnahmen gegen die weltweite Finanzspekulation zu ergreifen.
Wird es dieses Mal wirklich geeignete Programme zur langfristigen Entschuldung geben, ohne dass die Konjunktur abgewürgt wird? Und werden die Politiker dann Maß halten und nicht wieder das Geld mit vollen Händen für den nächsten Wahlerfolg verteilen?
Eine gesunde Skepsis dürfte zumindest bei diesen Fragen angebracht sein. Die Zukunft unserer Gemeinschaftswährung steht in den Sternen und daher raten immer mehr Experten mittlerweile zur Investition in Sachwertprodukte wie Edelmetalle und Immobilien.
Bei Industriemetallen muss die Frage erlaubt sein, wie sich die Preise bei einer weltweiten Wirtschaftskrise entwickeln, aber Gold und Immobilien galten schon immer als Fels in der Brandung bei Krisen.
Das Investment eines Teiles des Vermögens in diese Anlageklassen ist heute fast schon eine Pflicht.