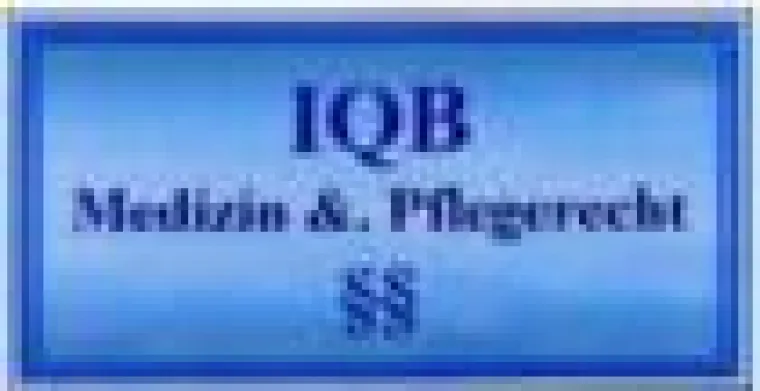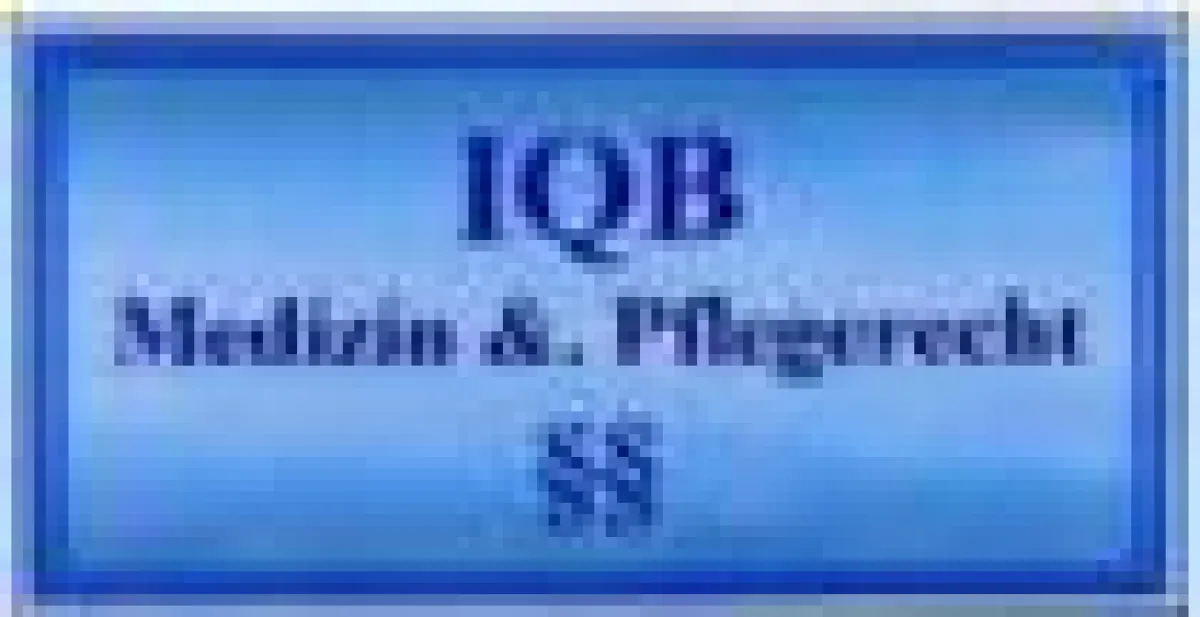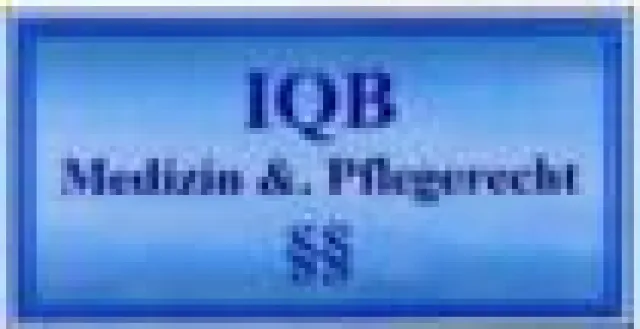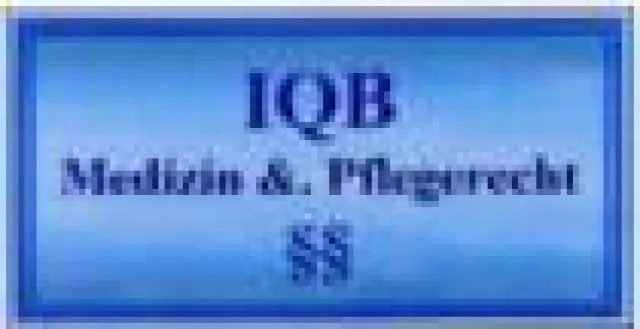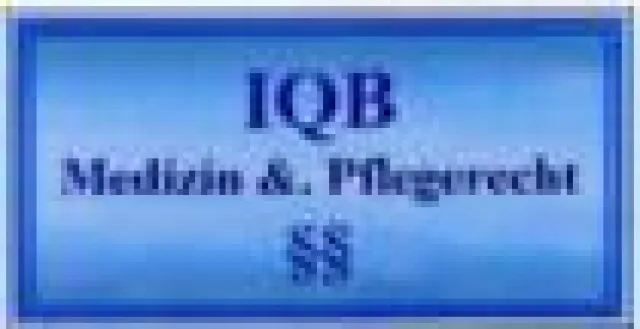(openPR) Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass zunächst Expertinnen und Experten sich bedeutsamen Fragen der Versorgung schwersterkrankter Menschen widmen und in diesem Zusammenhang stehend bemüht sind, ggf. ihr Vorhaben ethisch und sicherlich auch moralisch mit einer entsprechenden Legitimation zu versehen.
Der innere Beweggrund ergibt sich wohl aus dem Umstand, dass auch die „Würde des schwerkranken und sterbenden Menschen“ mit Blick auf Art. 1 des Grundgesetzes zu wahren ist und dem ist in der Tat so.
Gleichwohl müssen auch die Experten darauf achten, dass in ihrer Expertise zugleich sich auch die „Werte“ derjenigen schwerkranken und sterbenden Menschen widerspiegeln, die für sich ein anderes Verständnis über den eigenen Tod und damit von ihrem Abschied aus einem Leben entwickelt haben und ggf. den Wunsch nach einer ärztlichen Suizidbeihilfe äußern; dies ist insofern geboten, weil ansonsten die Charta im Begriff ist, einen Patienten mit seinem individuellen Willen und Wünschen (auch mit einer entsprechenden Erwartungshaltung an die Palliativmedizin) auszugrenzen und so den Leitideen der Charta einen Vorrang einzuräumen – einer Charta, die selbstverständlich auch dem Willen der Träger und Initiatoren entsprechend in der Folge umgesetzt werden soll.
Allerdings bleibt die Frage, ob die Träger der Charta „gut beraten“ sind, ihr lobenswertes Ansinnen bewusst ethisch und moralisch dahingehend zu verengen, in dem es derzeit wohl nicht beabsichtigt ist, aufgrund der Legaldefinition der Palliativmedizin ggf. die ärztliche Suizidbeihilfe (auch und gerade in Form eines aktiven Tun) als ethisch auch im Sinne der palliativmedizinischen Betreuung zu deklarieren.
„Nur wenn der Charta-Prozess tatsächlich im Sinne einer umfassenden Beteiligung partizipativ angelegt ist, wird die Charta am Ende auch in ihrer Umsetzung erfolgreich sein“, so die Träger der Charta auf Ihrer Homepage und dem kann in der Tat nur beigepflichtet werden. Der Charta-Prozess muss zwingend alle (!) schwerkranken und sterbenden Patienten auf ihrem Weg zu einem Konsens mitnehmen und hierbei zuvörderst berücksichtigen, dass der Patient auch eine individuelle Entscheidung treffen darf, die nicht (!) ohne Weiteres immer mit der ethischen Intention der Träger der Charta übereinstimmen muss.
Die Träger einer Charta sind m.E. in der ethischen und moralischen Verpflichtung, auch die Einzelsckicksale hinreichend mit ethisch vertretbaren Handlungsoptionen auszustatten, die ihrem individuellen Leid trotz palliativmedizinischer Möglichkeiten durch einen assistierten Suizid entfliehen wollen und gerade aufgrund eines gewachsenen Vertrauensverhältnisses zu ihrer Ärztin oder Arzt darauf hoffen, dass diese sie dabei ärztlich begleiten – wohlwissend darum, dass die schwerkranken und sterbenden Patienten keinen Druck auf die Gewissensentscheidung der Ärzte ausüben (können und vor allem wollen).
Nach der Definition des Konsensusprozesses im Sinne der Charta bedeutet dieser, dass alle Entscheidungen und Vereinbarungen einvernehmlich getroffen werden und es demzufolge keine Mehrheitsentscheidungen gibt und gerade hierin liegt eine besondere Gefahr begründet: Es gibt keine Alternativen aus der Sicht zumindest derjenigen Patienten, die im Zweifel ihrem schweren Leid zu entfliehen gedenken und um ärztliche Suizidbeihilfe nachsuchen; sie wären gleichsam gehalten, der Charta ihre Unterstützung zu versagen, auch wenn diese doch gerade darauf angelegt ist, ihre Würde und Selbstbestimmungsrecht zu wahren.
Folgendes Szenario ist daher durchaus denkbar: Im Rahmen des Konsensprozesses wurde vielleicht auch die Frage diskutiert, ob die ärztliche Suizidbeihilfe eine ethisch vertretbare Handlungsoption ist. Wenn auch nur einer der beteiligten ExpertInnen sich dieser Option verschließt, bleibt die Frage schlicht unbeantwortet, weil eine einvernehmliche Entscheidung nicht getroffen werden kann. Die Charta verbürgt also in ihrem Kern im Zweifel einen ethischen und moralisch vertretbaren Minimalkompromiss, der nun allerdings eine bedeutsame Frage (!) schlicht ausblendet (vielmehr ausblenden muss) und im Übrigen die Frage provoziert, ob im Zweifel die Experten sich auch über das Ob und Wie des Selbstbestimmungsrecht der schwerkranken und sterbenden Patienten im Rahmen eines Konsens verständigt und geeinigt haben, der nun allerdings notwendigerweise in einer Verkürzung der Grundrechte (nicht nur) der Patienten bestehen muss?
Auch wenn die „Selbstverpflichtung“ nicht im Sinne eines strikten (Rechts-)befehls normativ verbindlich ist, so ist doch mit ihr ein partieller Verzicht auf fundamentale Werte und Freiheiten verbunden, die gerade aus Art. 1 GG folgend „unverhandelbar“ sind und nach stetiger Beachtung streben, und zwar auch und gerade im Rahmen eines Konsensprozesses, der sich einer demokratischen Legitimation durch Mehrheitsentscheidungen verschließt und nach einvernehmlichen Lösungen und Botschaften sucht, die (scheinbar) unverfänglich sind.
Der demokratische Konsens kann nur darin bestehen, dass es mit Blick auf das frei verantwortliche Sterben auch eines schwerkranken und sterbenden Menschen keinen (!) Konsens bedarf, wollen wir uns nicht entscheidender Grundrechte begeben - es sei denn, wir reden einer besonderen gattungsethischen Inpflichtnahme des Individuums das Wort, dass mit moralischen Pflichten belegt wird.
Die Charta zur Betreuung schwerkranker und sterbender Menschen enthält einen moralischen Konsens, der sich zuvörderst durch die prozedurale Festlegung des Konsensverfahrens gegenüber der Individualethik, die ihre maßgeblichen Perspektiven aus einer rechtsethischen Betrachtung schöpft, auf ewig zementiert wurde und hieraus kein Entrinnen mehr gibt. Dies deshalb, weil es wohl auch in der Folge ausgeschlossen ist, in einem demokratischen Verfahren darüber zu befinden, ob ggf. Änderungen am verfahrenstechnischen Aspekt des Konsensusprozess selbst oder der Philosophie der Charta als solche erforderlich sind, um etwa der Bedeutung der Grundrechte der schwerkranken und sterbenden Menschen gerecht werden zu können. So gesehen eröffnet sich für die Träger der Charta die exklusive Möglichkeit, einer ärztlichen Suizidbeihilfe dauerhaft eine Absage zu erteilen und letztlich darauf zu verweisen, dass es jedem Einzelnen überlassen bleibt, sich auf den Text der Charta und dem sich dahinter stehenden Werteverständnis einzulassen und ggf. im Wege einer „Selbstverpflichtung“ mitzutragen.
Und in der Tat: Dem könnte nicht sinnvoll widersprochen werden, wenn wir es mit unserem Selbstbestimmungsrecht ernst nehmen wollen, so dass uns zugleich auch die hohe Last der Eigenverantwortung auferlegt ist.
Nun – ich nehme meine Eigenverantwortung dahingehend wahr, mich nicht einem Konsens zu unterwerfen, bei dem sich mir mit meinen individuellen Vorstellungen gerade am Lebensende keine Handlungsalternativen bieten und ich gehalten wäre, von vornherein auf die Inanspruchnahme einer ärztlichen Suizidbeihilfe für den Fall eines übermächtigen Leids durch eine unsägliche Krankheit entfliehen zu können.
Denn eines sollte bedacht werden: Auch eine „Selbstverpflichtung“ sollte freien Willens und vor allem bewusst eingegangen werden und wenn ich mich aufgrund eines individuellen Erlebens oder einem Erkenntniszuwachs dazu entscheiden sollte, doch für eine ärztliche Suizidbeihilfe zu plädieren, dann müsste ich redlicherweise auch dafür Sorge tragen, dass ich meine Unterstützung für einen Text der Charta dergestalt revidiere, in dem ich dieses öffentlich bekannt gebe.
Dieser „Befund“ ist nicht ohne, sprechen doch gute Gründe für die Liberalisierung der ärztlichen Suizidbeihilfe und nun stelle ich mir einfach mal vor, dass vielleicht irgendwann der Gesetzgeber seinen grundrechtlichen Schutzpflichten nachkommt und hierbei das Selbstbestimmungsrecht auch der schwerkranken und sterbenden Menschen gebührend berücksichtigt.
Ließe sich in einem solchen Fall eine bereichsspezifische Sonderethik noch aufrechterhalten oder wäre vielleicht der Gesetzgeber nicht auch gehalten, jedenfalls die öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften an die Bedeutung der Grundrechtsbindung zu erinnern?
Lutz Barth