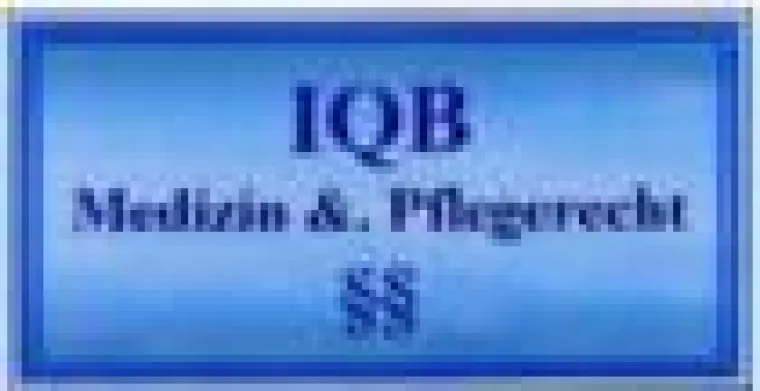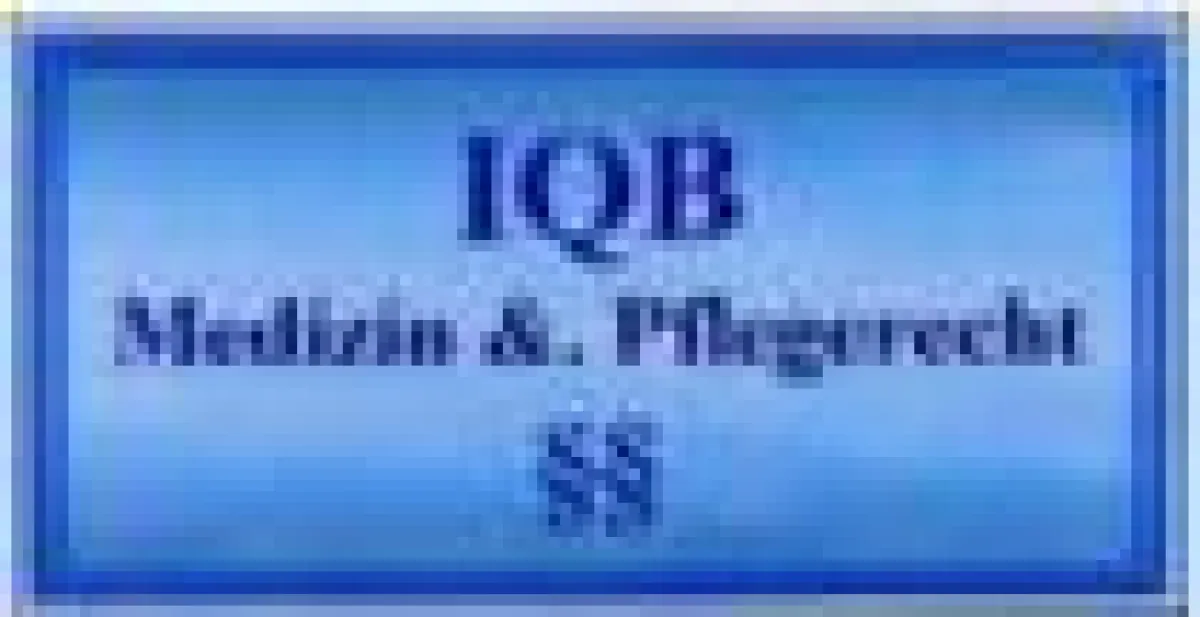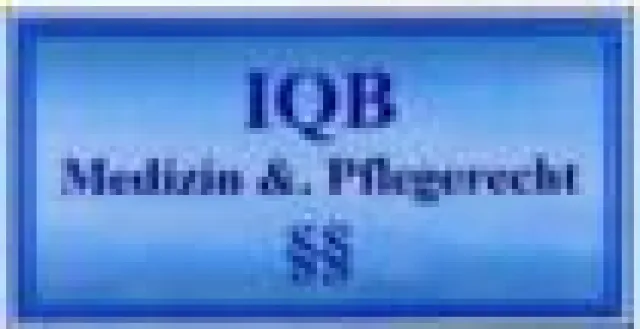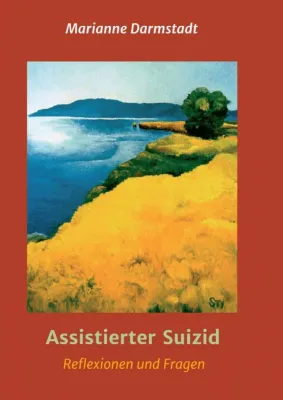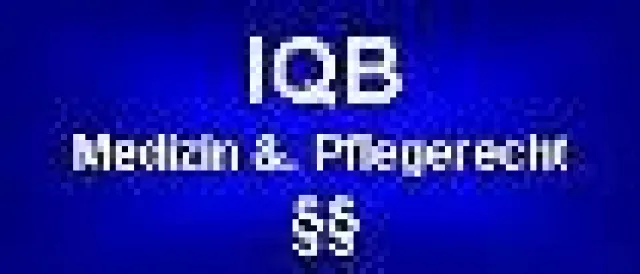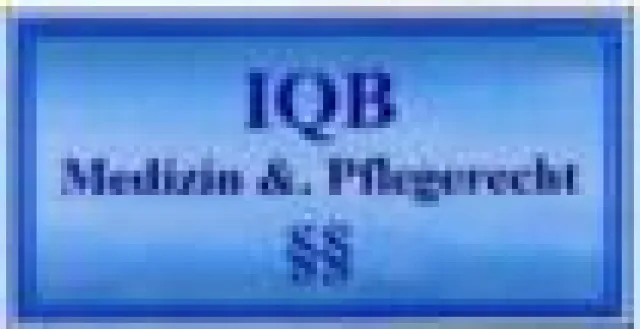(openPR) Die Frage, ob „Mediziner Schuld auf sich laden“, konnte freilich auch in dem Interview mit dem evangelischen Theologen Wolfgang Huber und dem Internisten Michael de Ridder über Suizidwünsche von Patienten und die Grenzen der Fürsorge nicht geklärt werden,
vgl. dazu „Die Mediziner laden Schuld auf sich“ - Der evangelische Theologe Wolfgang Huber und Internist Michael de Ridder über Suizidwünsche von Patienten und die Grenzen der Fürsorge im Gespräch mit Charlotte Frank und Nina von Hardenberg (in Süddeutsche Zeitung v. 28.08.10, Nr. 224, S. 8
bleibt dies doch letztlich einer individuellen Gewissensentscheidung vorbehalten, deren Legitimität angesichts von Art. 4 GG außer Frage stehen dürfte und im Übrigen davon abhängt, ob der Gesetzgeber angesichts von – zugegebenermaßen - Einzelfällen gehalten ist, jenseits von ethisch-moralischen Kategorien der „Schuldfrage“ die strafrechtliche Schuld dergestalt zu beseitigen, in dem eben in diesen Einzelfällen, hinter denen sich individuelle Schicksale offenbaren, die Tötung auf Verlangen und damit die aktive Sterbehilfe für rechtlich zulässig erklärt wird.
Ich persönlich neige denn auch dazu, der Bitte des Herrn Huber in aller Deutlichkeit nachzukommen: Ja, wir sollten im Diskurs nicht nach weichgespülten Worten ringen, sondern den Diskurs mit Begriffen führen, die insbesondere unter strafrechtlichen Aspekten betrachtet Eingang in das Gesetz gefunden haben und da ist es denn in erster Linie aufrichtig, auch den Begriff des „Tötens“ zu verwenden.
Nun will ich damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass Michael de Ridder „unaufrichtig“ sei – eher das Gegenteil ist mit seiner offensiven Kritik an der Arztethik anzunehmen -, aber es scheint den Mitdiskutanten erkennbar schwer zu fallen, nachzuvollziehen, dass er aus seiner Sicht nicht der aktiven Sterbehilfe das Wort redet, da er davon ausgeht, dass die „Tatherrschaft“ auch bei einem assistierten Suizid einzig beim selbstbestimmungsfähigen Patienten liegt, der in seinen Entscheidungen „frei“ ist.
Es geht nach Michael de Ridder nicht um „Tötung“ als aktives Moment, sondern darum, schwersterkrankten Menschen, die keine andere Möglichkeit sehen, aus dem Leben zu scheiden, um ihrer Würde willen eben diese Möglichkeit zu eröffnen und ggf. dabei zu helfen.
Ich als Jurist habe es da sicherlich einfacher: In der ärztlichen Suizidbeihilfe erblicke ich ein aktives Tun, wenn und soweit ein Dritter die Tathandlung ausführt, weil der Suizident nicht eigens dazu in der Lage ist. Ohne meine Hilfe, ohne meinen originären Tatbeitrag rückt der Tod zunächst noch in die Ferne und „nur“ weil ich ein todbringendes Mittel verabreiche, wird das Leben ausgelöscht. Und in diesem Sinne handelt es sich dann um den Straftatbestand der Tötung auf Verlangen, denn die Finalität meines Handeln soll ja vordergründig darin bestehen, dass Leben (auf Wunsch eines schwersterkrankten Patienten) endgültig und damit unwiderruflich zu beenden.
Der Patient ist tot und der „Täter ist der Arzt“, der diese Handlung für den Patienten in Ermangelung eigener Handlungsmöglichkeiten vollzogen hat.
Zu fragen also ist, ob wir diese Handlung durch die Ärztin oder Arzt ermöglichen wollen, wenn und soweit ein schwersterkrankter Patient meint, sein Leid nicht länger ertragen zu wollen?
Das Handeln des Arztes – also die Suizidbeihilfe – muss dann auch von einem dolus directus getragen sein, denn Ziel der ärztlichen Assistenz beim Suizid ist der zu bewerkstelligende Tod des schwersterkrankten Menschen. Der „Tod“ ist also der Erfolg, der sich bei einer ärztlichen Suizidassistenz einstellen muss und dass dieser sich auch tatsächlich einstellen wird, steht aufgrund der medizinischen resp. pharmakologischen Kenntnisse des handelnden Dritten (vorzugsweise der Ärztin oder Arzt) nicht zu bezweifeln an. Dem Wunsch des schwersterkrankten Patienten, seinem individuellen Leid ein Ende zu bereiten und damit der unsäglichen Krankheit zu entfliehen, wurde erfüllt und wir alle müssen für uns zunächst selbst die Frage stellen, ob wir diesen Geschehensablauf als solchen zu akzeptieren gedenken.
Sollte dies der Fall sein, dann könnte der Gesetzgeber die entsprechenden Rahmenbedingungen regeln, zumal das „Sterben“ entgegen einer weitläufigen Ansicht sehr wohl „normierbar“ ist, zumal das „Leben“ wahrlich nicht das „höchste Gut“ ist.
Aber auch in diesem Zusammenhang stehend darf darauf hingewiesen werden, dass selbstverständlich aus moraltheologischer Perspektive eine andere Bewertung erfolgen kann, die allerdings in einem säkularen und damit zur ethischen und religiösen Neutralität verpflichteten Staat nicht zum „allgemeinen Gesetz“ erhoben werden darf.
Entscheidend ist und bleibt bei der Frage bei der ärztlichen Suizidassistenz das Selbstbestimmungsrecht, dass nicht zur Fremdbestimmung über die Ärzteschaft führt und der Gesetzgeber ist dazu berufen, für sich die Frage zu beantworten, ob er auch bereit ist, den Einzelschicksalen die Möglichkeit zu eröffnen, der „Pflicht zum Weiterleben“ sich auch dadurch entziehen zu können, in dem diese mangels eigener Handlungsmöglichkeiten sich der Hilfe eines Dritten bedienen dürfen und können.
Der gesetzgeberische Beurteilungsspielraum ist freilich ein großer und da könnte es dann in der Folge Sinn machen, sich in die Lage der bewegenden Einzelschicksale zu versetzen (sofern dies überhaupt möglich ist) und sich selbst die Frage zu stellen: wollen wir zu einem solchen „Leben“ verdammt sein, wie es uns als Einzelschicksal auferlegt worden ist?
Die Frage kann also auch dahingehend formuliert werden, ob im Zweifel „Mediziner, Theologen und Ethiker Schuld auf sich laden“, wenn diese nicht erkennen wollen, dass das Selbstbestimmungsrecht neben der Würde des Menschen das höchste Rechtsgut ist und so gesehen dem Toleranzprinzip eine konsequente Absage erteilen, da es vornehmlich darum gehen dürfte, seiner eigenen Gesinnung ein tugendhaftes Gepräge verleihen zu können, um so den hohen Wert der selbstbestimmten Entscheidung gerade des schwersterkrankten Patienten „leugnen“ zu können?
Die Frage nach der „Schuld“ wird nicht zur Befriedung der Wertedebatte beitragen, sind wir doch alle „Täter“ – zumindest in der Rolle als „Überzeugungstäter“ und wenn wir uns hierzu bekennen, dann ist der freiheitliche Rechtsstaat gefordert, aufgrund zentraler Verfassungsmaximen den Konflikt widerstreitender Ethiken und Moralen zu neutralisieren.
Mehr – aber eben auch nicht weniger ist gefordert und ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass es einzig darauf ankommt, zumindest den Versuch zu unternehmen, die „Innenperspektive“ des schwersterkrankten Patienten einzunehmen, dessen „Sterben“ aufgrund der Errungenschaften der modernen Medizin in die weite Ferne gerückt ist, er aber sein Leben beenden möchte und dazu aber nicht mehr eigens in der Lage ist.
Das „Recht“ kann hier einen – wenn nicht gar den entscheidenden – Beitrag leisten, in dem es den Weg für eine Legalisierung der ärztlichen Suizidbeihilfe auch in Form der aktiven Sterbehilfe ebnet, die – um hier im Beitrag auch konsequent zu bleiben – in dem „Töten“ eines schwersterkrankten Menschen besteht, um die der Patient selbstbestimmt und frei von kognitiven Einbußen nachsucht.
Dass dies auch möglich ist, zeigt uns ein unbefangener Blick in andere Rechtsordnungen, in denen die „aktive“ Sterbehilfe zulässig ist und wer von uns will da einen „Stab brechen“ und diese Rechtsordnungen zu den Schlusslichtern in Europa in Sachen Rechts- und Lebensschutz degradieren?
Lutz Barth