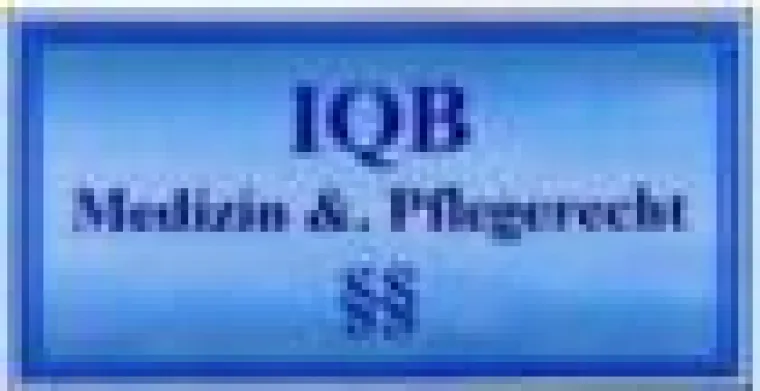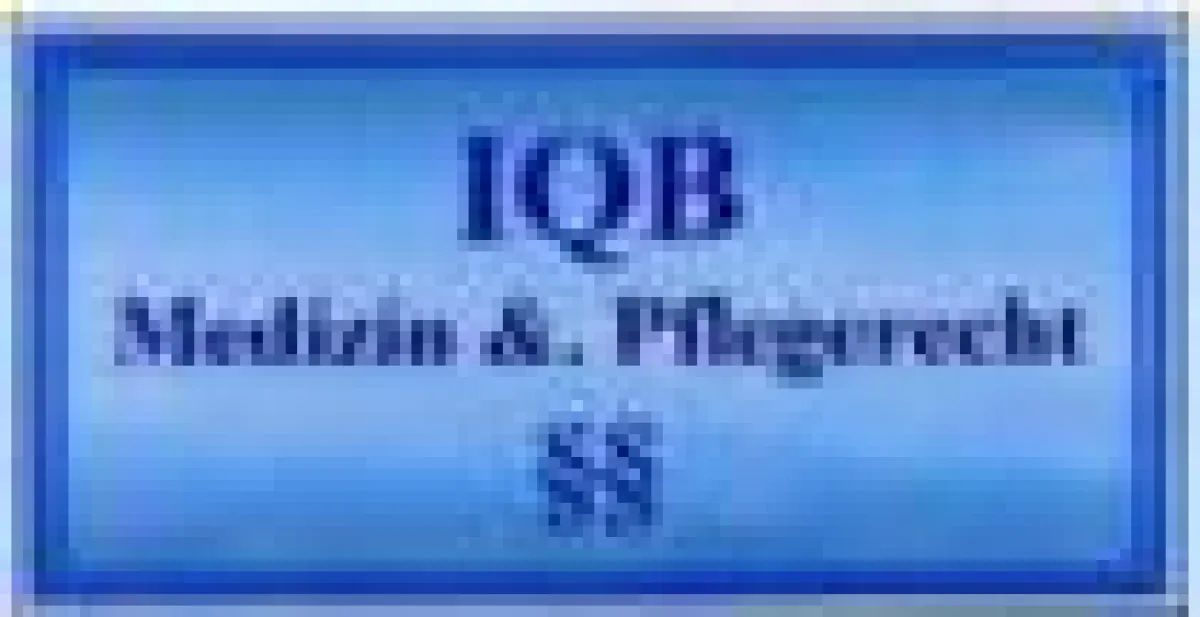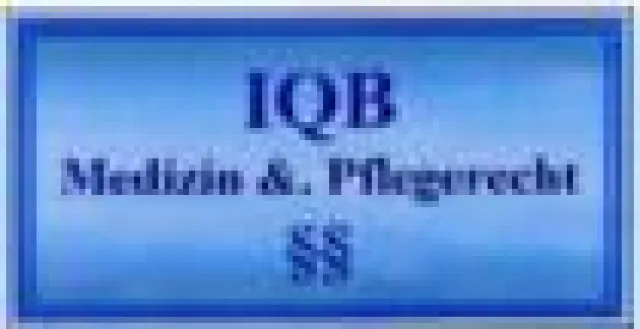(openPR) In einer aktuellen Pressemitteilung (15.01.08) weist die Deutsche Hospiz-Stiftung darauf hin, dass im vergangenen Jahr rund 20.500 Mal fachkundige Hilfe geleistet wurde. Das sind rund 1.200 Anfragen mehr im Bereich Patientenberatung und Schmerz- und Hospiztelefon als im Jahr 2006. „Diese Zahl zeigt, wie groß der Bedarf an fachkundiger Information und vor allem an persönlicher Unterstützung bei Fragen rund um Patientenschutz, Pflege und Sterbebegleitung ist“, erklärt der Geschäftsführende Vorstand der Deutschen Hospiz Stiftung, Eugen Brysch. »»»
Quelle: Deutsche Hospiz-Stiftung (PM v. 15.01.08)
Kurze Anmerkung (L. Barth):
Wie allgemein bekannt, plädiert die Deutsche Hospiz-Stiftung für ein striktes Tötungsverbot. Dazu gehört nicht nur die Ablehnung der aktiven Sterbehilfe, sondern auch des assistierten Suizids. Mit Blick auf den reklamierten gesetzgeberischen Reformbedarf hält die Deutsche Hospiz-Stiftung die seinerzeitigen Signale des 66. Deutschen Juristentages (2006) für verfehlt, wonach insbesondere der Strafrechtler Verrel in seinem Gutachten für eine „Relativierung des Tötungsverbots“ eingetreten sei (so die Auffassung der Deutschen Hospiz-Stiftung in ihrer >>> Stellungnahme zum Gutachten).
Von ihrem Selbstverständnis her ist diese Positionierung der Deutschen Hospiz-Stiftung durchaus nachvollziehbar, wenngleich die Argumentation mit Blick auf den ärztlich assistierten freiverantwortlichen Suizid nach diesseitiger Auffassung nicht verfängt. Auch die Deutsche Hospiz-Stiftung koppelt letztendlich die selbstbestimmte Entscheidung des Patienten an den Ausbau der palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung, die die Schmerztherapie einschließt, an und verkennt so m.E. den Stellenwert einer patientenautonomen Entscheidung, die eben auch in der Ablehnung palliativmedizinischer Bemühungen bestehen kann. Der Patient ist nicht gehalten, sich in den „Dienst“ der Palliativmedizin zu stellen und unabhängig davon, ob die Palliativmedizin derzeit noch eine „Randexistenz“ ist, bleibt daher die Frage nach einem ärztlich assistierten Suizid durchaus virulent. Etwas anderes annehmen zu wollen, bedeutet letztlich, dass der Patient einstweilen in die Rolle als ein „Objekt“ einer sich etablierenden Wissenschaft hineinwächst, ohne dass seine subjektiven Vorstellungen vom eigenen Sterben hinreichend berücksichtigt werden. Der neuralgische Punkt in der Debatte besteht also vielmehr darin, dass der Patient zugunsten der Etablierung der Palliativmedizin instrumentalisiert wird. Ohne Frage ist es außerordentlich begrüßenswert, wenn die Angebote palliativmedizinischer Betreuung weiter ausgebaut werden, nicht aber um den Preis, dass einstweilen dem Patienten vorgehalten wird, dass er mit seinem Wunsch nach assistierter Sterbehilfe einem egozentrischen Individualismus frönt und er im Übrigen einen Beitrag dazu leistet, dass die Palliativmedizin nicht weiter ausgebaut werde. Hier wird die Würde des Patienten nebst seinem Selbstbestimmungsrecht um der Wissenschaft willen zur „kleinen Münze“ geschlagen.
Lutz Barth