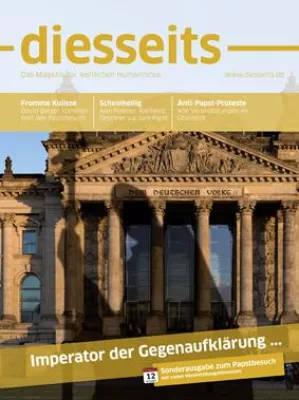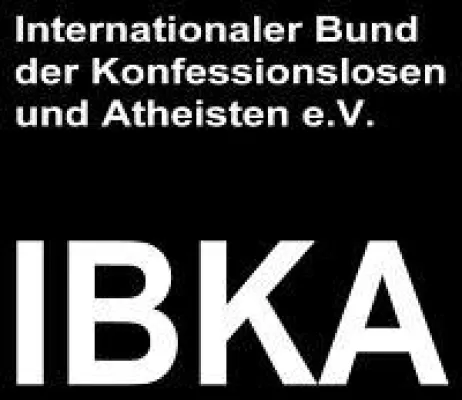(openPR) Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Umgang mit dem Islam in Forschung und Lehre (Januar 2010) haben offenbar den Anstoß für etwas gegeben, was schon lange gärt. Fast ein Dutzend Universitäten in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, u.a. in München, Heidelberg, Münster, Osnabrück und Frankfurt a.M. haben inzwischen Konzepte für die Einrichtung von Studiengängen zur Ausbildung von islamischen Religionslehrern, Imamen und Theologen an deutschen Hochschulen vorgelegt. Der Wissenschaftsrat hatte in seinen Empfehlungen im Januar ursprünglich von zwei bis drei Standorten gesprochen.
In dieser Dynamik wird erkennbar, dass das staatskirchenrechtliche Quasi-Monopol der Kirchen in unserer heutigen Gesellschaft keine Grundlage mehr hat. Der Islam kennt keine Kirchen und auch keine kirchlich geprägte Konfessionalität. Daher spiegeln sich weltanschauliche Sichtweisen in den islamischen Ausbildungsangeboten sehr viel offener, als dies in den dogmatischen Lehren der christlichen Kirchen der Fall ist. Das diesen Projekten zugrunde liegende ‚Beiratsmodell’ beweist, dass auch ohne kirchliche Konfessionalität – und auch ohne Einschränkungen der grundgesetzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre – eine authentische Präsenz weltanschaulicher Positionen in der Ausbildung weltanschaulich gebundener Lehrkräfte gesichert werden kann.
Die heute in Berlin zu Ende gehende Konferenz „Vielfalt der Religionen – Theologie im Plural“ möchte dies aber nicht hinreichend akzeptieren: Wieder einmal ist übersehen worden, dass in Deutschland keineswegs nur eine Vielfalt von Religionen existiert, die mehrheitlich nicht ‚kirchlich’ geprägt sind, sondern auch eine – schon vom Grundgesetz geschützte – Vielfalt von Weltanschauungen, unter denen die nicht-religiösen, säkularen Weltanschauungen eindeutig schon rein quantitativ gewichtiger sind als die nicht-christlichen Religionen.
Die Formel der „Theologie im Plural“ ignoriert diese gesellschaftliche Wirklichkeit: Die nicht-christlichen Religionen haben keine Theologie mit offiziellem, machtgestütztem ‚Lehramt’, und die lebhafte weltanschauliche Verständigung, die unter den Anhängern und Vertretern säkularer Weltanschauungen stattfindet, ist ganz sicherlich nicht unter den Hut der ‚Theologie’ zu bringen. Ganz im Gegenteil, kommt doch in den säkularen Debatten zum Ausdruck, wie sich durch wissenschaftliche Entdeckungen und gesellschaftliche Emanzipationsprozesse in der Moderne traditionell Autoritäten aufzulösen begonnen haben – einschließlich einer Entmythologisierung religiöser und kirchlicher Lehren.
Leider ist es noch ein ordentliches Stück Weg zu einer gesellschaftlichen Debatte auf der Höhe dieser soziokulturellen Wirklichkeit der Weltanschauungsvielfalt in Deutschland. Die Einführung. Humanistische Lebenskunde als nichtreligiöses Unterrichtsangebot an das säkulare Drittel unserer Gesellschaft hat keinen Wettlauf der Universitäten um entsprechende Angebote ausgelöst, sondern wird immer noch hinhaltend bekämpft. Das lässt erkennen wie nach dem Säkularisierungsschub der Deutschen Einheit die zwar lautstark propagierte, aber nicht den Tatsachen entsprechende angebliche ‚Rückkehr der Religion’ die Realitätswahrnehmung großer Teile der Öffentlichkeit und der Politik beeinträchtigt hat.
Es ist zu begrüßen, dass in dieser Hinsicht eine bessere Wahrnehmung des deutschen und europäischen Islam angestrebt wird, um die antiislamischen Reflexe und damit die überproportionale Bedeutungsbeimessung des Religiösen in unseren Gesellschaften zu reduzieren. Dies wird dann zwangsweise zu einer Wiederannäherung an die weltanschauliche Realität führen. Es wäre aber noch sehr viel besser, wenn bei dieser Gelegenheit auch wieder erkannt würde, dass unsere Gesellschaft in ihrer weltanschaulichen Vielfalt immer noch vor allem ein Erbe der europäischen Aufklärung ist, Als Konsequenz dessen sind gleichwertige zivilgesellschaftliche Formen der Beteiligung und Einbindung des gesamten Spektrums der Weltanschauungen in das öffentliche Bildungswesen zu entwickeln und die längst unzeitgemäßen staatskirchenrechtlichen Privilegien abzubauen.