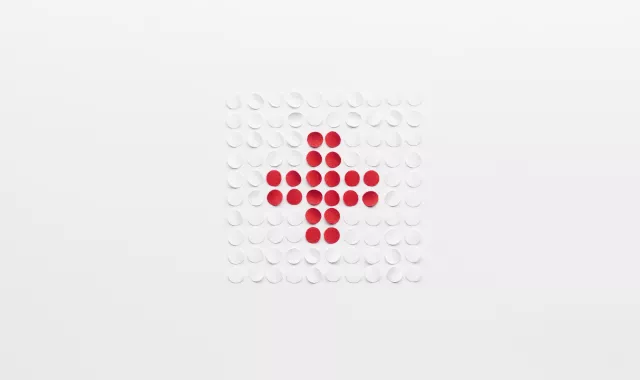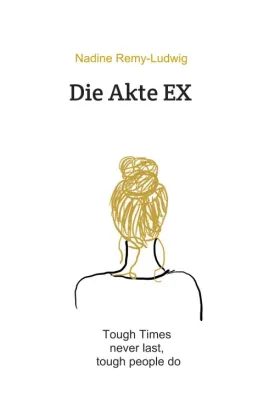(openPR) Geschiedene Eheleute wollen, dass bei ihrem Tod keine Vermögenswerte an den Ex-Partner oder dessen Verwandte fallen. Wie lässt sich das verhindern?
Wird das eigene Kind zunächst Erbe und verstirbt dann, ohne selbst Kinder zu hinterlassen, wird bei gesetzlicher Erbfolge der geschiedene Ehepartner entweder Alleinerbe oder, wenn noch Geschwister vorhanden sind, Miterbe. Darauf weist Rechtsanwältin Karin M. Schmidt aus Freiburg hin und führt weiter aus:
Selbst wenn das eigene Kind ein Testament hinterließe: Der geschiedene Ehepartner habe gegenüber seinem Kind einen Pflichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils; das sei das Problem.
Eine vergleichbare Problematik gebe es auch bei einer intakten Ehe, die aber kinderlos geblieben ist, und zwar mit den Kindern aus früheren Verbindungen.
Auch hier sollen Verwandte des länger lebenden Ehepartners, jedenfalls im Regelfall, ebenso wenig erben wie die erstehelichen Kinder, die schon allein über das Pflichtteilsrecht am Vermögen teilhaben.
Aus diesem Grund scheidet, so Rechtsanwältin Schmidt, ein sog. „Berliner Testament“ mit gegenseitiger Erbeinsetzung regelmäßig aus.
Was ist der Rat der erfahrenen Praktikerin?
Es gibt zwei Lösungswege: Entweder werden die eigenen Kinder nur Vorerben, also Erben auf Zeit, oder sie werden Vollerben und mit einem sog. Herausgabevermächtnis beschwert.
Die Nacherbfolgeanordnung ist der sicherste Weg, aber für den Vorerben auch mit starken Einschränkungen verbunden, wegen der Verfügungs- und Verwaltungsbeschränkungen sowie Sicherungs- und Kontrollrechten des Nacherben.
Zwar sei es möglich, den Vorerben von den Beschränkungen weitestgehend zu befreien, dem sind aber durch das Gesetz Grenzen gesetzt; so sind z.B. keine Schenkungen zulässig.?
Der geschiedene Erblasser wolle aber in der Regel seine Kinder nicht in irgendeiner Weise einschränken und sie insbesondere auch keiner Kontrolle unterstellen, sondern vorrangig verhindern, dass der geschiedene Ehepartner Erbe oder Pflichtteilsberechtigter wird.
Hier eröffnet ein sog. Herausgabevermächtnis die Möglichkeit, beide Ziele, Sicherung und Verfügungsfreiheit, miteinander zu verbinden:
Das Kind wird Erbe und darf zu Lebzeiten über das Ererbte frei verfügen, aber im Falle seines Todes geht der Rest des dann noch nachweislich vorhandenen Nachlasses, den er vom geschiedenen Elternteil erworben hat, an wen auch immer, außer an den geschiedenen Ehepartner und seine Verwandten; Begünstigter kann auch der vom Kind in einem Testament bestimmte Erbe sein.
Dieser Weg ist jedoch mit einem Restrisiko behaftet: mangels einschlägiger Rechtsprechung ist nicht zweifelsfrei gesichert, ob ausnahmsweise ein erst mit dem Tod des Kindes anfallendes Herausgabevermächtnis bei der Berechnung von Pflichtteilsansprüchen des anderen Elternteils den Wert des Nachlasses des verstorbenen Kindes mindert.
Daher muss das Herausgabevermächtnis mit dem ersten Erbfall bereits "anfallen", das ist wichtig; "fällig" gestellt wird es aber erst mit dem Tod des Kindes, d.h. dass der Begünstigte erst dann die Erfüllung verlangen kann. Diese Gestaltung ist insoweit „pflichtteilsfest“.