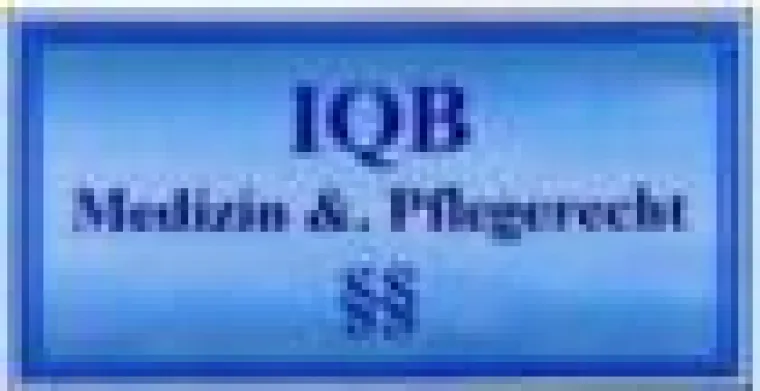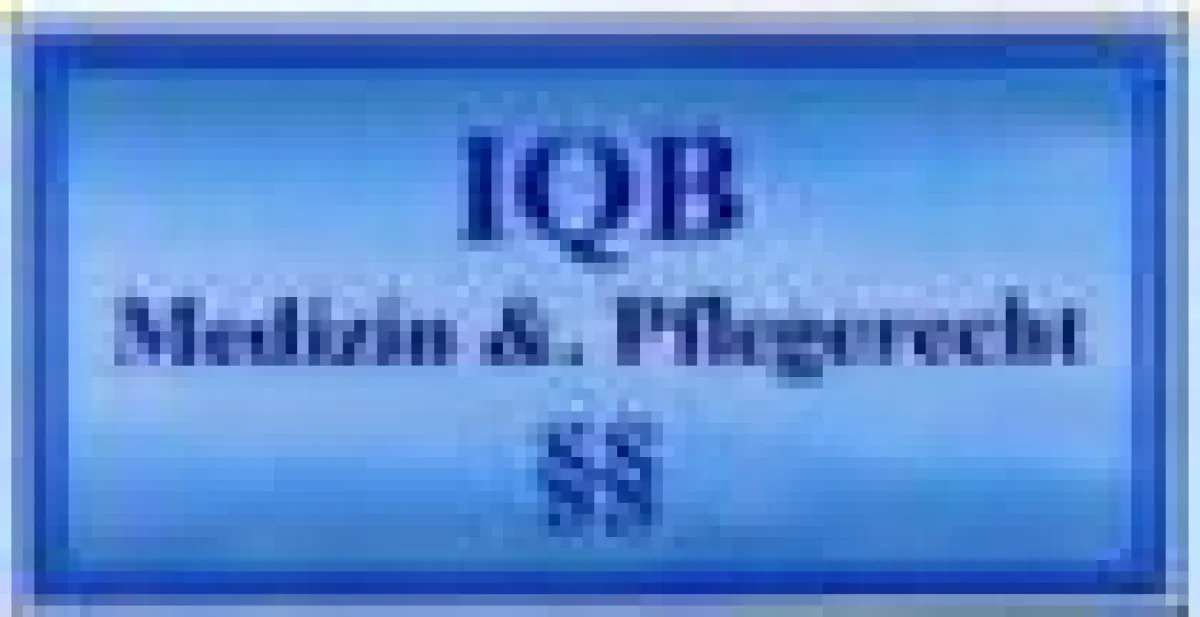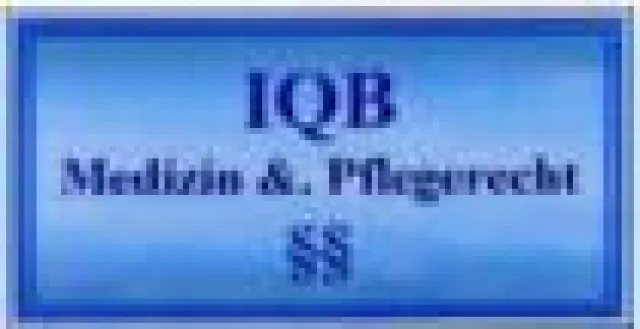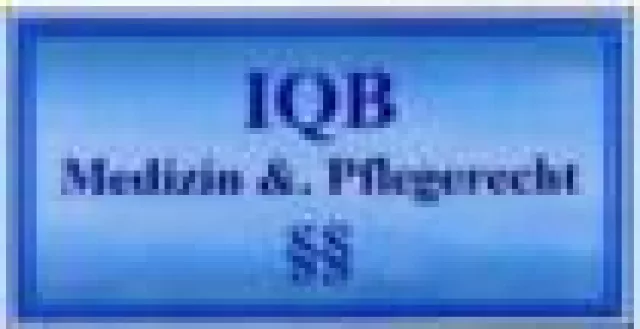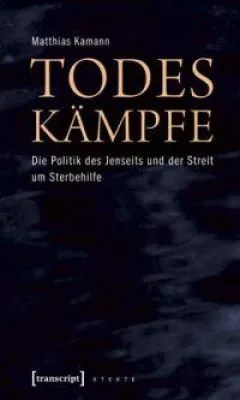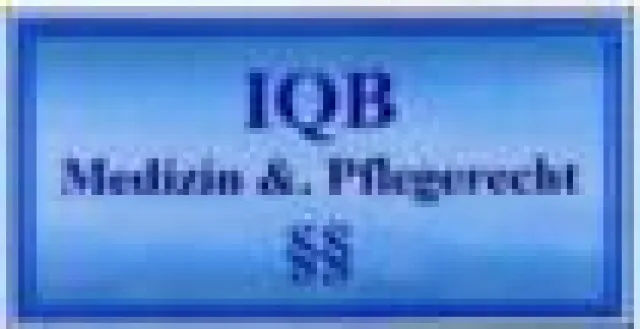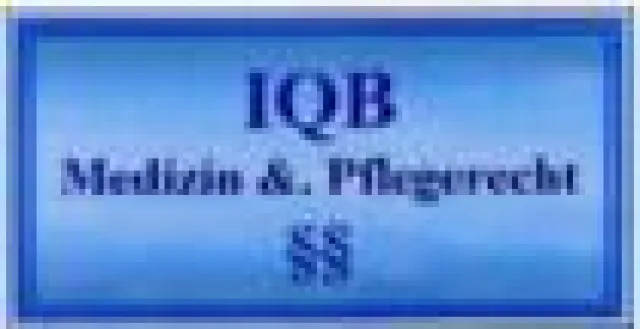(openPR) Mit einer aktuellen Pressemitteilung v. 07.10.10 kommentiert der Geschäftsführende Vorstand der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung, Eugen Brysch die aktuelle Entscheidung des BGH zur „Tötung auf Verlangen“ und lässt sich hierbei von der folgenden Vorstellung leiten:
„Einzelfallethik kann nicht die Rolle des Gesetzgebers sein, sondern bleibt allein den Gerichten überlassen. Deshalb muss all denjenigen widersprochen werden, die glauben, durch das Streichen des Straftatbestandes der Tötung auf Verlangen Einzelfallethik herzustellen.“
Quelle: Erklärung des Geschäftsführenden Vorstands Eugen Brysch zur aktuellen Entscheidung des BGH v. 07.10.10 in Sachen "Tötung auf Verlangen" >>> http://www.hospize.de/servicepresse/2010/mitteilung412.html
Mit Verlaub – es ist weder die Aufgabe des Gesetzgebers noch die der Gerichte, eine „Einzelfallethik“ zu betreiben, sondern in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass die einzelnen Normen im Einklang mit dem geltenden Verfassungsrecht stehen! Die „Einzelfallethik“ spiegelt vielmehr die individuelle Entscheidung des zur Selbstbestimmung berufenen Patienten wider und mit Blick auf diese Entscheidung ist er im wahrsten Sinne des Wortes frei, ohne dabei auf eine „ethische Entscheidung“ des Gesetzgebers noch des Richters angewiesen zu sein. In erster Linie wird der Gesetzgeber dafür Sorge tragen müssen, dass die von ihm zu erlassenen Regelungen verfassungskonform sind und sofern sich diesbezüglich ein rechtspolitischer Reformbedarf im Hinblick auf die Legalisierung der Sterbehilfe aufdrängt, wird er sich dieser eminent wichtigen Aufgabe nicht (!) entziehen können und gleichsam das Problem an die staatlichen Gerichte einfach „durchzureichen“. Auch der BGH ist in letzter Instanz nicht dauerhaft dazu berufen, „Recht“ zu produzieren; ihm werden wir derzeit allenfalls eine „Notkompetenz“ zubilligen müssen, wenngleich in der Sache der Gesetzgeber mehr denn je gefordert ist, endlich einer unsäglichen Ethikdebatte über das selbstbestimmte Sterben ein Ende zu bereiten.
In der Tat gilt es, durch entsprechende Gesetzgebungsaktivitäten die „Sandkasten-Diskussion“ zu beenden, wobei hier ausdrücklich nicht der Frage nachgegangen werden soll, wer mit wem hier im „Sandkasten“ spielt.
Die politisch Verantwortlichen werden erkennen müssen, dass in der „Ethikdebatte“ keine nennenswerten Erkenntnisse zu erwarten sind, die über den bisherigen Stand der Debatte hinausragen. Das gebetsmühlenartige Betonen allhergebrachter Argumente sollte für den Gesetzgeber Anlass genug sein, endlich auch im Strafrecht für eine transparente Regelung Sorge zu tragen, nach der in Ausnahmefällen eine „Tötung auf Verlangen“ straffrei bleibt.
Auch wenn der Deutsche Ethikrat Anfang letzten Jahres angekündigt hat, sich des Themas der ärztlichen Suizidassistenz annehmen zu wollen, besteht angesichts der fortschreitenden Klerikalisierung der Palliativmedizin und der Hospizbewegung aktueller Handlungsbedarf, zumal es keiner großen Phantasie bedarf, zu welchen Erkenntnissen die Mitglieder des Deutschen Ethikrats gelangen werden. Prominente Mitglieder des Deutschen Ethikrats lassen uns vermehrt an ihren individuellen (!) Gewissensentscheidungen teilhaben und da würde es gleichsam verwundern, wenn eine(r) der Damen und Herren einen Richtungswechsel vollziehen würden. Freilich werden wir diese individuellen Gewissensentscheidungen zu akzeptieren haben, aber es dürfte ein Fehlschluss aller ersten Ranges sein, wenn der Gesetzgeber meint, auch nur eine dieser Expertenmeinungen zum Anlass nehmen zu wollen, eine künftige Regelung zur ärztlichen Suizidassistenz mit einem hierauf ausgerichteten und versehenen Inhalt zu verabschieden (oder eben in der Gänze davon Abstand zu nehmen, weil eben das „Sterben nicht normierbar“ sei).
Die grundrechtlichen Schutzpflichten gebieten lediglich eine gesetzgeberische Regelung, die unabhängig von einem ethischen und moralischen Grundkonsens über eine wie auch immer zu definierende ars moriendi in unserer Gesellschaft ist. Der schwersterkrankte Patient darf sterben und es ist allein durch den Gesetzgeber zu entscheiden, ob er diesem humanitären Anliegen eines sterbenden Patienten durch die Legalisierung der ärztlichen Suizidbeihilfe auch in Form eines aktiven Tuns Rechnung zu tragen gedenkt, wenn und soweit der Patient selbst aufgrund seiner Krankheit nicht zur „Tat“ schreiten kann.
Lutz Barth