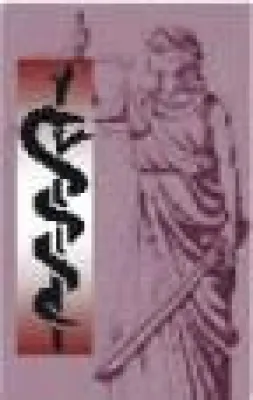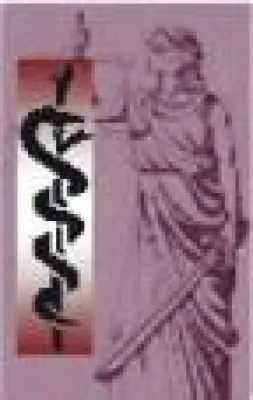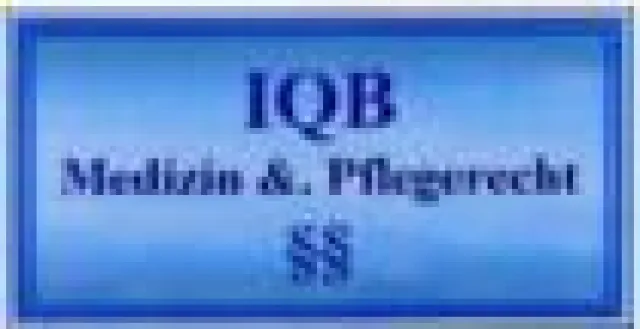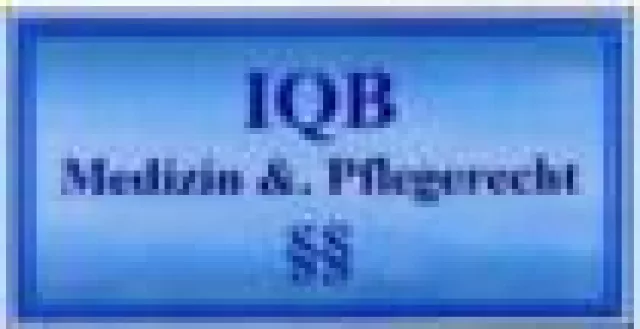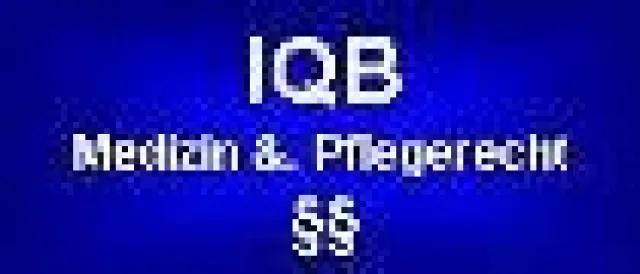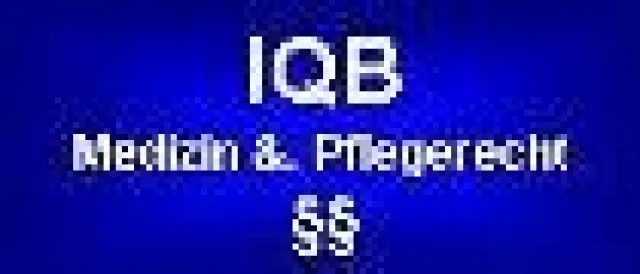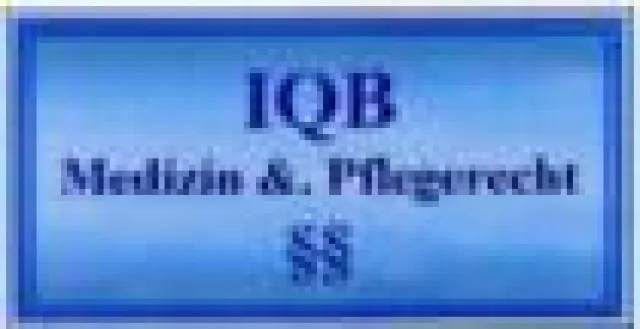(openPR) „Modellversuche“ nach § 63 Abs. 3c SGB V in stationären Alteneinrichtungen
Die Verabschiedung des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes „feiert“ nunmehr am 01.07.2009 sein einjähriges Bestehen und ist an der Zeit, die mit den Modellversuchen nach § 63c Abs. 3 SGB V eröffnete prinzipielle Möglichkeit zur Übertragung genuin ärztlicher Tätigkeiten auf die beruflich Pflegenden einer zuvörderst rechtlichen Risikobeurteilung zu unterziehen.
Zwar liegen derzeit noch immer nicht die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses vor, bei welchen Tätigkeiten eine Übertragung von Heilkunde auf die Angehörigen des Kranken- und Altenpflegeberufs im Rahmen von Modellvorhaben erfolgen kann; dies hindert allerdings nicht, eine grundsätzliche Risikoanalyse vorzunehmen, bei der das ökonomisch intendierte Prozessmanagement sowohl in Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen eher eine „untergeordnete Rolle“ spielen dürfte.
Rechtliche „Risikopotentiale“ erschließen sich zuvörderst aus dem Recht de lege lata und ein modernes Prozessmanagement in stationären Einrichtungen wird sich hieran u.a. auszurichten haben, so dass es in dem Seminar vorliegend darauf ankommt, Schnittstellen zu identifizieren, an denen das „wirtschaftlich Gebotene“ eines modernen arbeitsteiligen Zusammenwirkens verschiedener Berufe und die ggf. sich aus dem Recht ergebenden Grenzen aufeinander abgestimmt werden.: einzelnen Tätigkeiten, Primärpflichten der Ärzteschaft und der beruflich Pflegenden, Folgen einer vertikalen (?) oder doch eher horizontalen Arbeitsteilung, horizontale oder vertikale Substitution und haftungsrechtliche Zuweisung einzelner Kompetenzbereiche, Instruktionspflichten im Rahmen eines „Modellversuchs“, Möglichkeiten zur therapeutischen Intervention im Gegenseitigkeitsverhältnis (?).
Mit der Einführung der Modellversuchs-Klausel sind bis dato wesentliche Rechtsfragen nicht gelöst worden, zumal gute Gründe dafür streiten, dass die Pflichtenmaßstäbe insbesondere aus der Perspektive der Ärzteschaft nicht modifiziert wurden, andererseits dieser Befund aber für die beruflich Pflegenden und vor allem der Träger nicht ohne Weiteres angenommen werden kann:
• Primärpflichten der Ärzteschaft und der beruflich Pflegenden, Folgen einer vertikalen (?) oder doch eher horizontalen Arbeitsteilung, horizontale oder vertikale Substitution und haftungsrechtliche Zuweisung einzelner Kompetenzbereiche, Instruktionspflichten im Rahmen eines „Modellversuchs“, Möglichkeiten zur therapeutischen Intervention im Gegenseitigkeitsverhältnis (?), Organisationspflichten des Trägers im Rahmen des „Modellversuchs“; weitergehende Dokumentationspflichten; Folgewirkungen für den medizinischen Standard (?)
• Zudem sind die „Modellversuche“ an den Erfordernissen eines modernen Patientenschutzes auszurichten; hieraus ergeben sich weitere gewichtige Fragen, wie etwa die der Aufklärungs- und Einwilligungsproblematik des Patienten in Heileingriffe, die künftig von beruflich Pflegenden vorgenommen werden.
Eine Fülle von Rechtsfragen, denen wir auf unserer Veranstaltung nachgehen und hierbei ganz zentral in Fachgesprächen vertiefen wollen.
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an das Leitungsteam und damit über die Heimleitung hinaus auch an leitende Pflegefachkräfte in stationären Alteneinrichtungen.
Im Übrigen halten wir es für zwingend geboten, hier deutlich zwischen den einzelnen Versorgungssektoren (mit Blick auf die Abgrenzung zum Krankenhaus) zu differenzieren, da nach wie vor fundamentale Unterschiede nicht nur im Hinblick auf den Versorgungstyp bestehen, sondern vornehmlich auch bezüglich der zu betreuenden und pflegenden Bewohner resp. Patienten.
Mehr Informationen hierzu nebst der Möglichkeit zur Anmeldung erfahren Sie auf dem nachfolgenden Link
>>> http://www.nursing-health-events.de/veranstaltungen.htm