(openPR) Nachdem dem Sturm der „moralischen Entrüstung“ über die Entwicklung in der Schweiz („Züricher Vereinbarung“) ist auch hierzulande eine offene Debatte über die ärztliche Assistenz beim Suizid anzumahnen.
Die unsägliche Kritik der Deutschen Hospiz Stiftung an der „Züricher Vereinbarung“ steht paradigmatisch für eine Tabuisierung der ärztlichen Assistenz beim Suizid mit alten Argumentationsmustern, wonach die „Entsolidarisierung“ mit den sterbenden und schwerstkranken Menschen vorangetrieben werde, die davor Angst haben, anderen zur Last zu fallen.
Unsere Gesellschaft wird eine solche Diskussion aushalten müssen, zumal auch diesbezüglich ein Wertewandel festzustellen ist, der ganz entscheidend auf die subjektiven Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger zurückgeführt werden kann.
Ungeachtet dessen verbleibt es im Übrigen auch bei der nüchternen Feststellung, dass ein
Jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er „jemanden“ zur Last fallen möchte oder nicht. Eine Verpflichtung zum Sterben wird es nicht geben, während demgegenüber aber der selbstbestimmte Patient für sich durchaus die Entscheidung treffen kann, dass er sein Leben nicht fortzuführen gedenkt und sofern er sich bei seiner Entscheidung auch davon leiten lässt, dass er z.B. seiner Familie nicht „zur Last fallen“ will, haben wir diese Entscheidung zu akzeptieren.
Der einzelne Patient ist nicht verpflichtet, sich mit einer „Sterbekultur“ zu solidarisieren und insofern bestimmt er individuell, ob und mit welchen Motiven er sich von dieser Sterbekultur abzugrenzen gedenkt. Die denkbar schlechteste Alternative wäre wohl darin zu erblicken, dass der Patient buchstäblich eine „Fahrkarte ins Jenseits“ zu lösen hätte, um in unseren europäischen Nachbarländern selbstbestimmt sterben zu können.
Aber vielleicht denken die Kritiker bereits über ein „Ausreiseverbot“ nach …
Lutz Barth
Presseinformation
Sterbehilfe - „Gefährliche Diskussion“ muss geführt werden
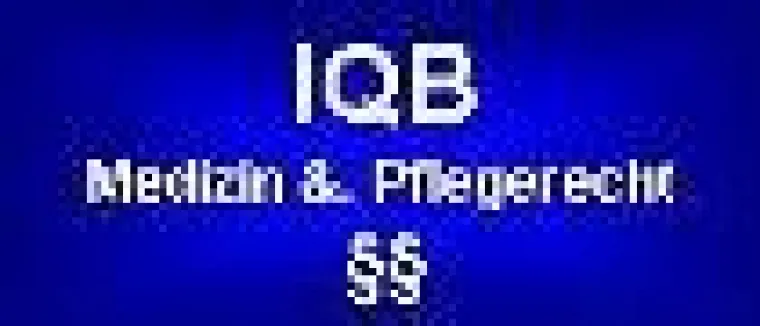
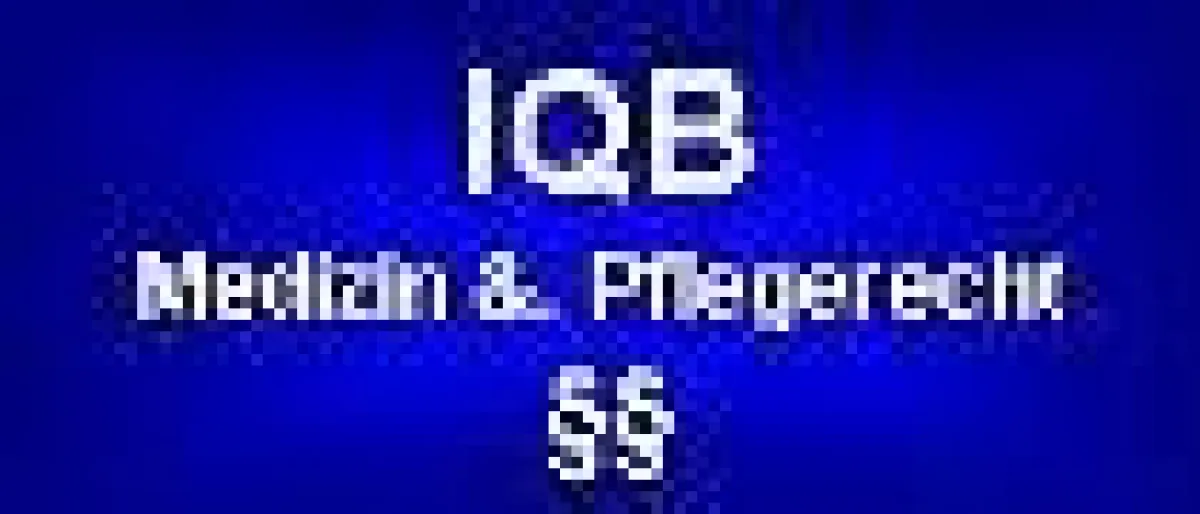
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:IQB - Lutz Barth
Debstedter Str. 107, 27607 Langen
Tel. 04743 / 278 001
Internetportal: www.iqb-info.de
E-Mail: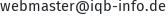
Debstedter Str. 107, 27607 Langen
Tel. 04743 / 278 001
Internetportal: www.iqb-info.de
E-Mail:
Über das Unternehmen
Das Internetportal rund um das Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht. Wir möchten mit unserer Webpräsenz einen Beitrag nicht nur zum Recht leisten, sondern auch gelegentlich kritisch zu den Themen unserer Zeit Position beziehen. Es geht nicht immer um die "ganz herrschende Meinung und Lehre", denn auch diese ist weitestgehend eine Illusion und Ausdruck verschiedenster Interessen - auch und gerade im Recht!
Pressebericht „Sterbehilfe - „Gefährliche Diskussion“ muss geführt werden“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von IQB - Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht - Lutz Barth


Wir sollen nicht sterben wollen
Der „Diskurs“ (?) über das frei verantwortliche Sterben eines schwersterkrankten und sterbenden Menschen ist nach wie vor nicht nur soziologisch unterbelichtet, sondern zeichnet sich insbesondere durch Glaubensbotschaften der selbsternannten „Oberethiker“ und deren „Geschwätzigkeit“ aus.
„Lebensschützer“ meinen zu wissen, was die Schwersterkrankten und Sterbenden wünschen und welcher Hilfe diese am Ende ihres sich neigenden Lebens bedürfen.
Mit Verlaub: Es reicht nicht zu, stets die Meinungsumfragen zu kritisieren, in denen die Mehrheit der…


Sterbehilfedebatte - Der Kreis der ethischen Überzeugungstäter ist überschaubar
Es scheint an der Zeit, in einer hoch emotionalisierten Debatte „Ross und Reiter“ zu benennen, die sich fortwährend um den „Lebensschutz“ scheinbar verdienstbar gemacht haben und unbeirrt auf ihrer selbst auferlegten Mission fortschreiten.
Einige politisch Verantwortlichen sind gewillt, die „Sterbehilfe“ gesetzlich zu regeln und wie es scheint, besteht das Ziel in einer strikten Verbotsregelung.
Auffällig ist, dass es sich um eine handverlesene Schar von Ethiker, Ärztefunktionären, freilich auch Theologen und Mediziner handelt, bei denen ber…
Das könnte Sie auch interessieren:


Anne Will - Kritik an Absetzung der Debatte um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern
… Themenwechsel erscheint mir persönlich nicht angebracht, wurde doch mit der angestrebten Debatte über den Freitod und damit verbunden die Diskussion um die (aktive) Sterbehilfe ein sehr aktuelles und brisantes Thema aufgegriffen, für das die Öffentlichkeit angesichts der demnächst im Bundestag anstehenden Lesung über ein Patientenverfügungsgesetz zu …

Sterbehilfe-Diskurs: Deutscher Ethikrat sollte kurzfristig eine öffentliche Plenarsitzung veranstalten
… Jungen angenommen hat und diesbezüglich einen Beitrag zur Versachlichung des Diskurses hat leisten wollen.
Angesichts der derzeitigen Bemühungen des parlamentarischen Gesetzgebers, die kommerzielle Sterbehilfe unter Strafe zu stellen, erscheint es sinnvoll, dass der Deutsche Ethikrat dieses Thema ebenfalls kurzfristig auf die Agenda setzt, um so einen …
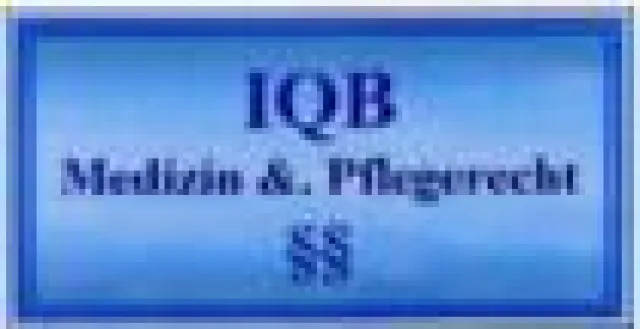
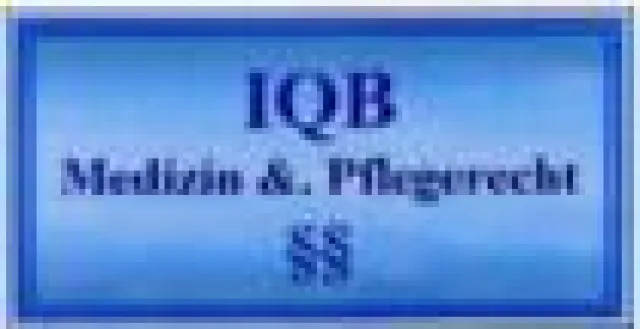
Palliativversorgung statt aktiver Sterbehilfe - kein Widerspruch
„Die Palliativmedizin muss fester Bestandteil der heutigen Medizin werden“, forderte Klaschik im Hinblick auf die Diskussion der vergangenen Jahre zum Thema aktive Sterbehilfe. Palliativ¬medizin habe sich zum Ziel gesetzt, Menschen in ihrer Ganzheit¬lichkeit zu betreuen, d.h. in ihrer physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimension, um so …
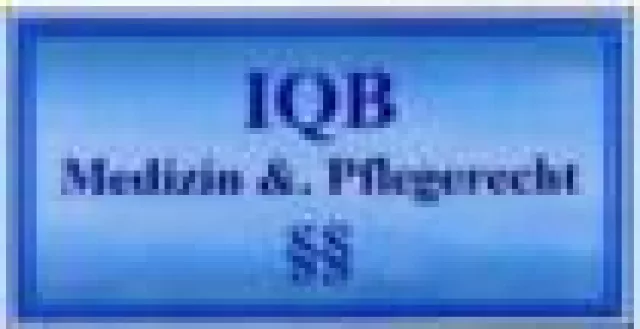
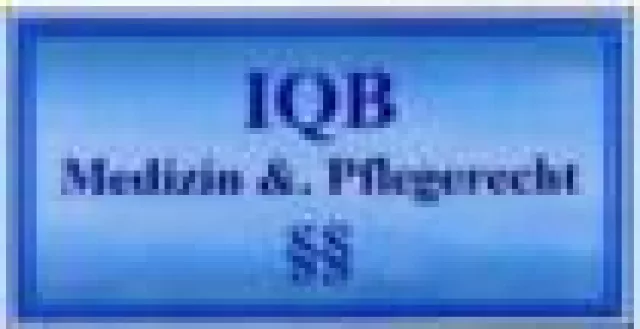
Das „Schweigen“ der Bundesärztekammer
Wir haben hier bei openPR öfters über die Sterbehilfe-Debatte berichtet – zuweilen kritisch und nachfragend und auch gegenwärtig konfrontieren wir die ethische Berufsseele der Ärztefunktionäre mit unangenehmen Fragen.
Innerhalb der Ärzteschaft, die ihre ethischen Grundsatzfragen zunächst selbst identifiziert, scheint die „Ruhe“ im wahrsten Sinne des …

Der neopaternalistische Ethikkurs der Bundesärztekammer ist zwingend zu stoppen
… der Selbsttötung zu kurz greift: Es wird einem generellen Verbot das Wort geredet und da drängt sich der Verdacht auf, dass die Gegner der Liberalisierung der Sterbehilfe im Kern auf eine Regelung drängen, wie sie in Österreich besteht.
Die ethische Basta-Politik wird zunehmend unerträglicher und es wird dringend der Appell an den parlamentarischen Gesetzgeber …
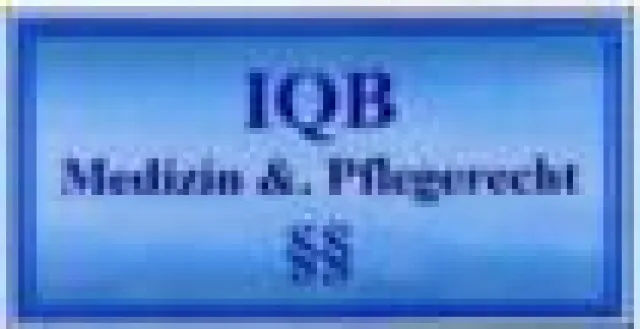
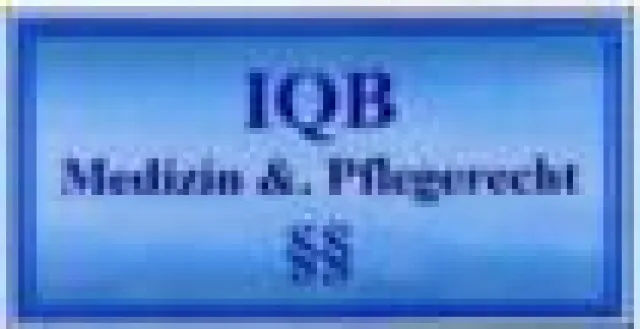
Bundesärztekammer und Telematik – Aufruf zur Diskussion
… der Kollegen verständlich ist.
Dem wird man/frau ohne weiteres beitreten können und das gleiche Engagement dürfte von den Kammern mit Blick auf die Debatte in der Sterbehilfe-Diskussion zu erwarten – eher wohl anzumahnen – sein! Auch hier ist eine innerärztliche Diskussion dringend erforderlich, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass die Funktionäre …

Agenda 2011-2012: Gesundheitsminister verhindert Sterbehilfe
… Medienberichten hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entsprechende Maßnahmen des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen auf Sterbehilfe abgelehnt. Einen positiven Bescheid habe es in keinem einzigen Fall gegeben, 22 suizidwillige Patienten seien in der Wartezeit verstorben.
Eigentlich hatte …


Pro Sterbehilfe – ein Solidaritätsaufruf
… Organisationen und Verbände, die ihn unterstützen möchten.
„Wir fordern in Deutschland nicht die Freigabe der Tötung auf Verlangen bzw. der direkten aktiven Sterbehilfe. Wir bekennen uns jedoch zu der empirisch nachweisbaren Tatsache, dass Leidlinderung, Schmerztherapie, Sterbehilfe und -begleitung als ärztliche Aufgaben nicht schematisch voneinander …
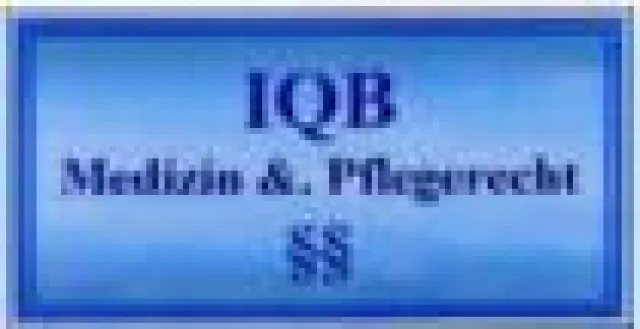
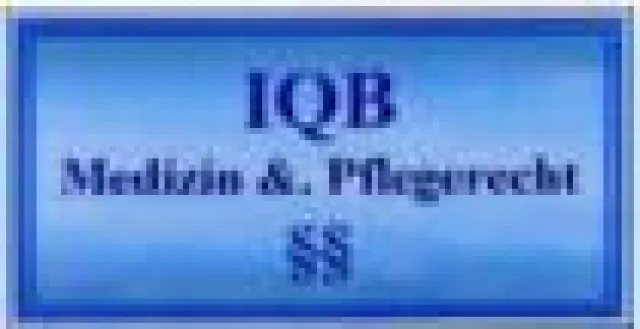
Debatte um Sterbehilfe in Belgien – wird durch Sterbehilfe dem Tod seinen Sinn genommen?
Kardinal Godfried Danneels hat mit kritischen Bemerkungen zur Sterbehilfe eine heftige Debatte in Belgien ausgelöst. Ihm wird in der Diskussion vorgeworfen, dass dieser möglicherweise ein „überholtes Weltbild“ habe und er offenbar davon ausgehe, dass man durch Leiden seine Seele retten könne, so der der Freidenker-Präsident Pierre Galand.
In einer Osterpredigt …
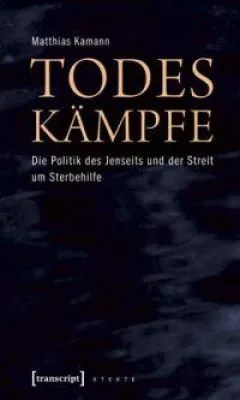
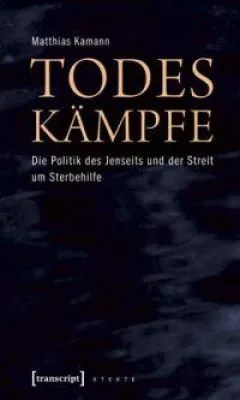
„Todeskämpfe“ - Die Politik des Jenseits und der Streit um Sterbehilfe
Vortrag und Buchpräsentation mit
Dr. Matthias Kamann (»Die Welt«) und Dr. Svenja Flaßpöhler:
„Todeskämpfe“
Die Politik des Jenseits und der Streit um Sterbehilfe
In der Kontroverse um Sterbehilfe geht es nicht nur um Gesetze. Weit mehr als das stehen neue Bilder von Tod, Jenseits und Individualität in der alternden Gesellschaft zur Debatte, die an den …
Sie lesen gerade: Sterbehilfe - „Gefährliche Diskussion“ muss geführt werden