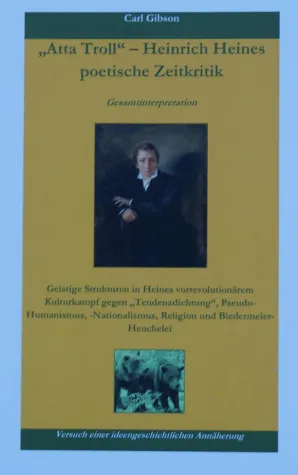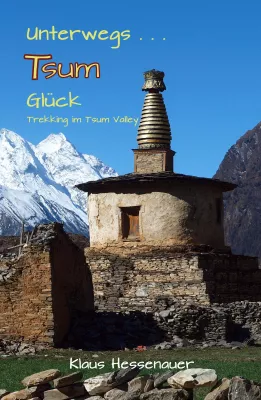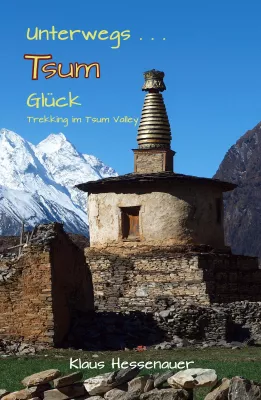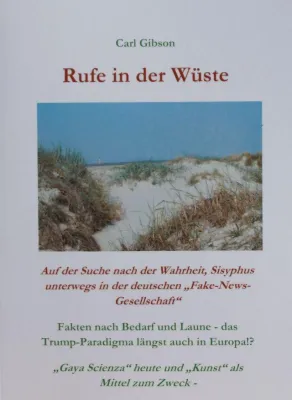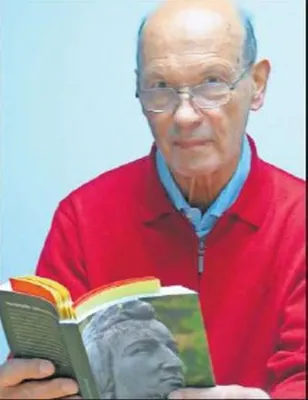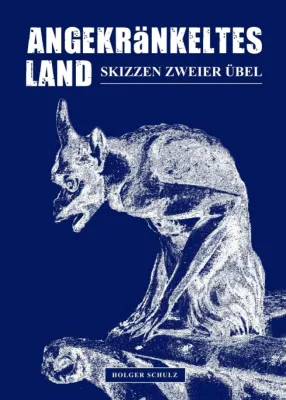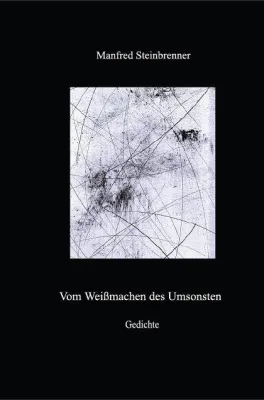(openPR) Eine Gesamtinterpretation im Geist Heines:
Auszug, aus dem
Nachwort:
Randglossen … und „Polemik“ für den „Giftschrank“ !?
Ohne, dass es mir bewusst gewesen wäre, ging ich beim Verfassen dieses Werkes vor wie einer meiner Lieblingsschriftsteller, wie La Bruyère, als dieser die „Charaktere“ des Theophrast rezipierte: Der aufgeklärte Franzose machte sich bei der kritischen Lektüre seine Notizen zu dem, was er an Beobachtungen vorfand und seine Gedanken. Aus den Randglossen und Kommentaren zu dem zweitausendjährigen Vermächtnis eines klassischen Griechen wurde dann etwas Neues, ein literarisch wie psychologisch wertvolles, richtungweisendes Buch, das mehr ist, als unterhaltsame Lektüre.
Auch meine „Randglossen“, die sich auch nicht entfernt mit dem vergleichen dürfen, was La Bruyère, erschuf, wuchsen an und formten sich - ohne dass dies intendiert gewesen wäre - zu einer umfassenderen Interpretation, die ich hiermit, nach halbjähriger Arbeit, als Buch“ vorlege.
Weitestgehend „textimmanent “ vorgehend, präsentiere ich hier das, was mir zu Heines „Spaßdichtung“ spontan einfiel, ohne besondere Rücksicht auf die Erkenntnisse der Forschung, die ich in dieser Materie seit einiger Zeit aus den Augen verloren habe und auf die Gefahr hin, dass meine lieben und hochgeschätzten Mitstreiter in Sachen Wahrheitsfindung an der deutschen Hochschule mir wieder einmal ein „polemisches Werk“ bescheinigen!
Wohlan! Heine und „Polemik“ - das verträgt sich!
Wer schreibt also hier - ein Literaturwissenschaftler, dessen Beruf darin besteht, Werke, die andere geschaffen haben, zu „interpretieren“, Verborgenes mäeutisch aus der Versenkung zu heben, um dann alles Wichtige - zu Gehalt und Gestalt - den Lesenden näher zu bringen, im hermeneutischen Prozess?
Ein Philosoph , der nach Essenzen, nach speziellen anthropologischen, die Zeiten überdauernden Gewissheiten und Wahrheiten sucht?
Oder doch nur ein „Schriftsteller“, der das niederschreibt, was ihm gerade einfällt, methodisch stringent oder auch nicht, einer der alles sagen darf, nicht nur an sich, weil ein Dichter frei ist zu sagen, was er leidet und was er will, sondern auch, weil die Zeit, in der er lebt, das Mittelmaß zum Maß schlechthin erhoben hat und – nicht nur aus meiner Sicht – „problematische“, kontrovers diskutierte „Literatur“ höchste Ehrungen erzielen?
Wer eine akademische Laufbahn noch vor sich hat, der sollte aufpassen, was er aussagt und wie er es aussagt, damit nicht - wie Heine es ausdrücken würde - eventuell die „Hühneraugen“ konventionell agierender Kollegen in Amt und Würden tangiert werden. Sonst ist die in mühsamer Fleißarbeit diszipliniert vorbereite Karriere an der Alma Mater schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Am besten der angehende „Forscher“ passt sich an - wie Heines „tugendhafter Hund“ - und frisst sich satt. Ohne anzuecken, bleibt er brav und schreibt - das Ideal von freier Forschung und Lehre ignorierend - gefügig brave Bücher, opulente Werke, die die Wissenschaft zwar nicht weiterbringen, aber die deutsche Universität vor Rebellion und Ketzerei bewahren. Die Konvention regiert immer noch und bestimmt, was gelehrt werden darf, während Außenseiter, die über Außenseiter schreiben, wie zu Heines Zeiten ausgegrenzt, stigmatisiert, verfolgt, ja, sogar – dem materiellen Elend überantwortet - existenziell bedroht. Die Zeitkritik freier Geister ist selbst heute in den Bildungseinrichtungen der liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht gefragt.
Gleich Antipode Lenau im Wien Metternichs, der dort um 1836 Philosophie dozieren wollte, hat selbst Heine seinerzeit den Versuch unternommen, deutsche Literatur zu lehren und ein anständiger deutscher Professor zu werden, sogar in München.
Es sollte nicht sein. Die Menschheit kann für diese weise Entscheidung der Vorsehung über König Ludwig I. nur dankbar sein – denn die Deutschen verloren zwar einen tüchtigen Akademiker, der sicher auch ein paar höchst geistreiche Bücher geschrieben und sicher auch gute Schüler geformt hätte, aber die echte Literatur wäre wahrscheinlich ausgeblieben. So aber wurde der Welt ein großer Schriftsteller geschenkt, ein erstrangiger Dichter, dessen Werke auch heute, wo namhafte Akademiker, Persönlichkeiten aus jener Zeit längst vergessen sind, die breite Schar der Leser immer noch beglücken und selbst die träge „Forschung“ noch am Leben halten.
Doch nicht immer und vor allem nicht überall. Musste ich doch selbst es immer wieder aufs Neue erfahren, dass, wenn ich ein literatur- oder zeitkritisches Werk herausbrachte, eines, nach Heines Geschmack, man am liebsten die ungeliebte Kreation „Giftschrank“ verwahrte, neben anderen Preziosen, die seit Jahrhunderten den Index zieren:
Ein „Polemik“-Vorwurf genügt - und alles ist zunichte! Das Werk, die jahrelange Arbeit, die Investition in den Druck, die der kleine Autor ohne Mäzene und Seilschaften selbst stemmen muss.
Die „Wissenschaftlichkeit“ ist dahin, weil der „Ton“ missfällt, in dem vorgetragen wurde, weil der „Stil“ missfällt, der nicht ganz dem entspricht, den der deutsche Bildungsphilister in seiner Amtsstube an der Hochschule für angemessen hält.
Heine - noch vor Nietzsche - Endpunkt einer langen Reihe kritischer Satiriker in der deutschen und europäischen Literatur - eine Provokation, damals wie in diesen Tagen! Und alle, die über Heine frivol schreiben, die in gleicher Tonlage und stilistisch - dem Poet aus der „Matratzengruft“ vergleichbar - Literatur oder Wissenschaft produzieren, gelten auch heute noch, weil der Ton die Musik bestimmt, als Provokateure, Unruhestifter, selbst schaffend auch in der Interpretation.
Ergo lese man das hier Vorgelegte - ganz dem Witz und Geist Heines verpflichtet - nicht als akademische Abhandlung eines Literaturwissenschaftlers, der nach akademischem Lorbeer strebt, sondern als eine mit Lust verfasste Deutung eines Wahlverwandten, eines kritischen Geistes, der frei denkt und schreibt.
ISBN 978-3-947337-10-1