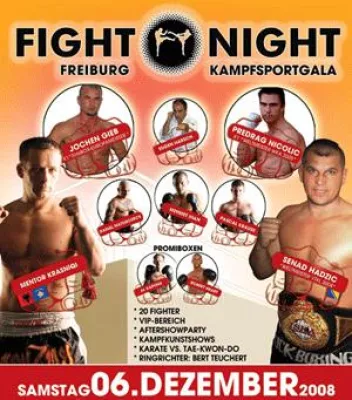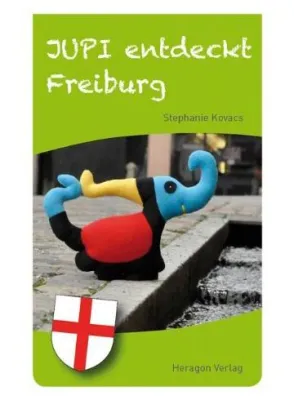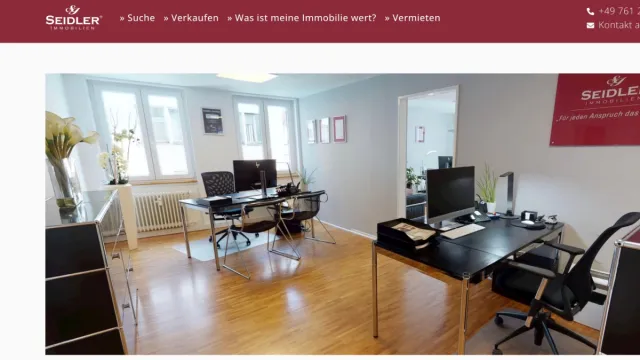(openPR) Ein Kurs initiiert vom Lebensdorf Freiburg und Dipl.-Ing. (FH) Oliver Heizmann von casa-tatu auf dem Gelände der ULOG, zugleich Bauherr Dipl.-Päd. Rolf Behringer im Haierweg 27 in Freiburg. Stattgefunden hat das ganze von Donnerstag, 23.08. 17 Uhr bis Sonntag, 26.08. 16 Uhr.
Erster Tag.
Kennenlern Phase. Viel gelernt. Aus den unterschiedlichen Gebieten, wie Landschaftsplaner, Maler und Lackierer, Maurer, Grundstücks Wertermittlerin, Architekten, Bautechniker, und viele mehr. Die Quintessenz an diesem Abend war, Leute kennen lernen, Kontakte knüpfen, Standpunkte verstehen, Vorlieben erkennen, Lebenseinstellungen kennen lernen, Gleichgesinnte suchen und finden. Ein ganz neues Erlebnis.
Tag Zwei.
Gleich sehr praxisnah. Herr Heizmann einer der Strohballenexperten begann sofort mit der Praxis an einer „lasttragenden“ Strohballenwand, immer mit Informationen bestückt, immer offen für alle Fragen, sehr kompetent, sehr informativ. Man lernt Techniken wie: Gründung und Fundamentierung und deren Varianten, Abstand zum Boden, Nagerschutz, Fixierungsmöglichkeiten wie Stahlpins, Bambuskorsagen, Stahl- oder Holzverbund zur Aussteifung, halbieren von Ballen, stopfen, vorkomprimieren etc. Über Fragen wie Statik, Wärmekoeffizient und Materialeigenschaften wurde, kann und wird noch philosophiert werden müssen, vor allem über Statik. Im Verbund sehr stabil aber im Einzelnen nicht berechenbar, weil jeder etwas anders ist. Hier am Workshop Ort wird mit Holzständern gebaut. Stabiler. Die Zimmerleute arbeiten bis zur Mittagspause durch. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, immer wieder nieselt es. Deshalb bauen Sie unter der Anleitung von Ulrich Schmidt, Zimmerermeister und Bautechniker aus Mühlacker, das Holzgerüst und das Trapezblechdach, damit wir später mit der Dämmung beginnen können, denn Strohballen dürfen nicht nass werden, auch das eine sehr wichtige Regel. Dem Pilzbefall vorbeugen. Wer baut schon gern den Übeltäter gleich mit ein. Mittagspause vorbei, starker Regen. Draußen wird immer noch an der Hütte gebaut. Das Trapezblechdach wird aufgesetzt. Die Hälfte ist also geschafft. Der Regen will nicht aufhören. Macht aber nichts, Herr Heizmann macht einen Theorieteil, aus seinem langjährigen Fundus. Wir schauen uns Beispiele aus Spanien, Frankreich und Brasilien an. Lasttragende Bauten. In diesem Beispiel werden Fundament Streifen aus Steinplatten gelegt, dann eine Lage Holzdielen, Eckelemente die die Außenwände begrenzen, die später wieder entfernt werden. Unten auf die Holzdielen kommen Stahl oder Holz oder Bambuspins, auf die die Strohballen aufgesteckt werden. Man beginnt in den Ecken und arbeitet sich zur Mitte durch. Als Fenster oder Türen dienen zunächst ausgekreuzte Holzrahmen in die später die Fensterprofile „schwimmend“ eingebaut werden. Die Strohballen werden bündig drum herum gebaut. Oben auf kommt ein einfacher Ringanker, der mit den Bodendielen verspannt wird um Setzungen zu vermeiden. Nachdem diese Arbeit erledigt ist, kommen Fußpfetten und Firstpfette, Sparren und Schalung. Fertig. Eine andere Möglichkeit ist eine Rahmenkonstruktion, die später mit Strohballen ausgefüllt werden, passend. Danach werden die Schnüre gekappt und dadurch noch dichter. Weit gefehlt. Ich war mir doch schon fast sicher, dass nur wenige vom Strohballenbau wissen. Schaut man aber über den Tellerrand hinaus, zum Beispiel nach Frankreich oder Spanien oder noch weiter ins nichteuropäische Ausland wie Brasilien, stellt man fest, dass dort der Strohballenbau schon (fast) Tradition hat. Wunderschöne Konstruktionen sowohl aus der Not heraus, als auch beabsichtigt, chic, legal, als Wohnung oder Tagungsraum. Nur in Deutschland brauchen wir noch mehr davon. Ein Dachverband für Strohballenbau treibt es voran. Noch mehr und vielleicht noch viele Workshops müssten gemacht werden, vielleicht auch mit Studenten an Hochschulen aktiv und interaktiv und handwerklich mit den eigenen Händen.
Das Dach ist drauf. Der Ulrich Schmidt, der schon einige Strohballenhäuser gebaut hat leitet die Gruppe an. Nun müssen die Strohballen in die Holzständer. Nach bestimmten Regeln werden die Strohballen in die Ständer gedrückt um eine möglichst hohe Dichte zu erreichen. Die ersten Zwei gehen noch leicht, aber die andern Vier müssen eingekeilt, vertikal gepresst und mit einem dicken, überdimensionalen Holzhammer eingehämmert werden.
Wir haben 5 Schotts zu dämmen. Nach nur einen halben Stunde ist das erledigt. In einer weiteren Stunde werden dann mit Stopfhölzern die Hohlräume mit Stroh gefüllt. Eine sehr anstrengende und zeitraubende Arbeit. Der weitere Aufbau wird später eine Folie und Holzdielen sein. Jetzt die Wände. hochkannt aber im selben System. Das Problem ist die Vertikale. Man kann die Kräfte nicht so effektiv einsetzen wie in der Horizontalen. Man muss kreativ sein um das möglichst effektiv einzubauen. Es gibt zwar eine Aufsicht der Meister, probiert muss aber selbst. Nach und nach entwickelt sich ein reger Ehrgeiz.
Tag Drei.
Auf die mit Stroh gefüllten Wände kommt eine vertikale Lattung und darüber eine Diagonale. Dann haben kleine Gruppen die Möglichkeit an verschiedenen Workshops teilzunehmen. In meinem Fall, Lehmputz anrühren. Mit Stroh vermischt ergibt das ein leichten Lehmputz, der auf das Stroh aber auch zwischen die Diagonalen eingebaut oder besser „reingeschmiert“ wird. Handarbeit. Ein sehr Zeitaufwendiges Unterfangen. Andere Gruppen lernen etwas über transluzente Wärmedämmungen. Auf der Südseite kommen rechts und links vom Eingang eben diese Dämmungen zum Einsatz. Die geknickte Seite des Strohballens wird abgeschnitten, so dass auf beiden Seiten in Halmrichtung bei Sonneneinstrahlung Wärme gespeichert werden kann. Als Deckschicht kommt dann kein Putz an die Wand, sondern eine Glasscheibe.
Tag Vier.
Theoriestunde. Mehr ein Event, dass von anderen Teilnehmern Projekte zeigt, welche aber nicht weniger interessant sind. Jutebau von Axel Schultz, Strohballenbau von Oliver Heizmann (www.casa-tuta.org) und Ulrich Schmidt (www.natürlich-schmidt.de), Lebensdorf vom Ronny Müller (www.lebensdorf.net).
Wir schauen uns wieder einige Bilder an und nehmen auch hier die letzten Informationen mit und bauen in lockerer Atmosphäre an unserer Hütte weiter. Am Nachmittag ist "Tag der offenen Tür".
Es kommen immer mehr Besucher und lassen sich von den neuen und alten Fachmännern die Welt erklären. Man fühlt sich selbst als solcher und alle haben sichtlich Spaß. Langsam verabschieden sich alle und es wird ruhiger. Aufbruchstimmung. Fertig geworden sind wir leider nicht. Aber Oliver Heizmann und Ulirich Schmidt sind in 3 Wochen wieder auf der Baustelle und vollenden nach und nach den „Coontainer“. Vielleicht komme ich auch wieder.
Rolf Behringer
gegründete 1993 die ULOG Freiburg. Seitdem hat er vor allem mit anderen Experten in einigen afrikanischen Ländern an einer Umsetzung auf dem Gebiet des solaren Kochens gearbeitet. Von 2000 bis 2003 arbeitete er für den Deutschen Entwicklungsdienst in Namibia. Neben seiner Haupttätigkeit unterstützt er das Solar-Kocher Projekt Valombola im „Vocational Training Center in Ongwediva“. Im Jahr 2005 initiierte er das „International Solar Food Processing Network“, während er am „ISES Headquarter“ (Intertnational Solar Energy Society: www.ises.org) tätig war. Das Ergebnis aus mehreren Workshops und Schulungen die stattgefunden haben entwickelte sich die erste internationale Konferenz, welche sich ausschließlich auf solare Lebensmittelverarbeitung konzentriert. Sie fand in Indore (Indien) im Januar 2009 in Zusammenarbeit mit dem „Barli Development Institute for Rural Women“ statt.
Sein langfristiges Ziel ist es, das „Solar-Food Network“ zu erweitern und „Solar-Food Processing Units“ rund um den Globus zu implementieren. In Freiburg i.B. produziert er Solarbox Herde, die über Seinen Internet-Shop vertrieben werden. Neben der Arbeit im Bereich der Solarkocher lehrt er „Renewable Energy and Energy Awareness“ an Schulen und Universitäten.
Oliver Heizmann,
Dipl.-Ing. (FH) Architektur und Stadtplanung an der HS Karlsruhe. Im mittleren Schwarzwald geboren und schon als Kind in Baulaune, Hütten und Burgen aus Strohballen. Die wachsende Unzufriedenheit mit der konventionellen Bauweise und der zunehmenden ökologischen und sozialen Verarmung der Gesellschaft veranlasste Ihn 1999, nach neun Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Architekturbüros, den Job zu kündigen. Es war an der Zeit nach Alternativen zu suchen. Gemeinsam mit Seiner Partnerin bereiste er 2000 Spanien und Südamerika, wo er die populären und traditionellen Bauweisen der verschiedenen Regionen studierte und schließlich in Peru den 'modernen' Strohballenbau kennen lernte. Den ersten Praxis-Workshop Strohballenbau machte er bei Martin Oehlmann auf dem „european strawbale gathering 2002“ in Österreich. Durch den Erfahrungsaustausch mit dem „european strawbale network“, dem Studium von Fachliteratur und Baustellenpraktika und Seminarbesuche in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien und Brasilien hat er sich auf die Beratung und Planung für Biokonstruktion und bioklimatischer Architektur nach Permakultur-Gestaltungs-Prinzipien "spezialisiert". 2005 studierte er in Brasilien: Arquitetura, Urbanismo und Antropologia an der UFRGS - Universität Porto Alegre. Im Vordergrund steht für Ihn: "VIELFALT" statt Einfalt! Durch sein Studium 2007 der Regionalwissenschaft und Raumplanung am IfR - Universität Karlsruhe legt er den Fokus auf eine ganzheitliche, generalistische Zukunftsplanung.
Lebensdorf e.V.
hat zum Ziel, Impulse für nachhaltige, heilsame und zukunftsfähige Lebensweisen zu schaffen und zu fördern. Dieses Ziel soll insbesondere durch eine integrative Lebensgemeinschaft ("Lebensdorf"), mit der Vision eines respektvollen Miteinanders von Menschen, Tieren, Pflanzen und allen anderen Erscheinungsformen der Natur, verwirklicht werden. Der Verein verfolgt in diesem Kontext insbesondere folgende gemeinnützige Zwecke - Umwelt- und Naturschutz, Bildung und Forschung, Hilfe für bedürftige Personen. Zur Umsetzung dieser Ziele wird der Verein insbesondere die Planung, den Aufbau und die Verwirklichung einer die oben genannten Ziele verfolgenden Arbeits- und Lebensgemeinschaft durchführen, Seminare, Workshops, Foren und sonstige Veranstaltungen durchführen und Forschungsprojekte initiieren und durchführen. Aktionen und Forschungsprojekte zu den oben genannten Zielen von anderen gemeinnützigen Vereinen oder Körperschaften öffentlichen Rechts unterstützen
mit anderen Organisationen ähnlicher Zielsetzung zusammenarbeiten, sich vernetzen und Wissensaustausch pflegen. Möglichkeiten der Integration von aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung bedürftigen Menschen anbieten.
Weitere Infos:
www.ttfreiburg.de/event/workshop-strohballenbau
www.solarfood.de Webseite von Rolf Behringer
www.casa-tatu.org Webseite von Oliver Heizmann
www.fasba.de Webseite des Fachverband Strohballenbau
www.bau-Raum.com Webseite von Paolo Scarpetta, Lehmfachwerker
www.natürlich-schmidt.de Ulrich Schmidt, Zimmermann