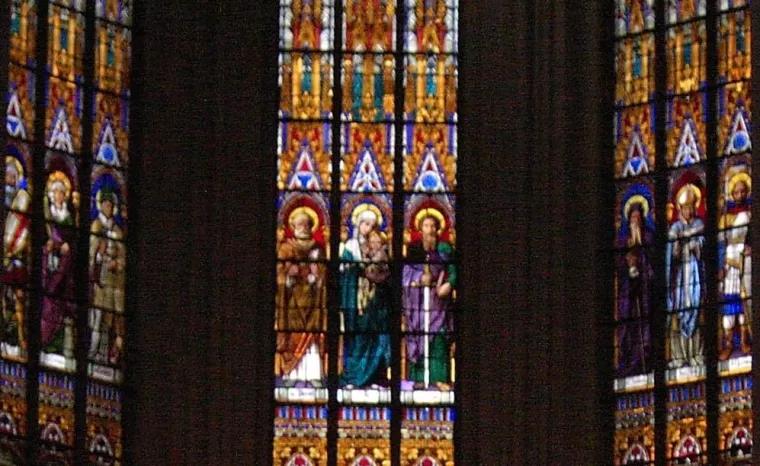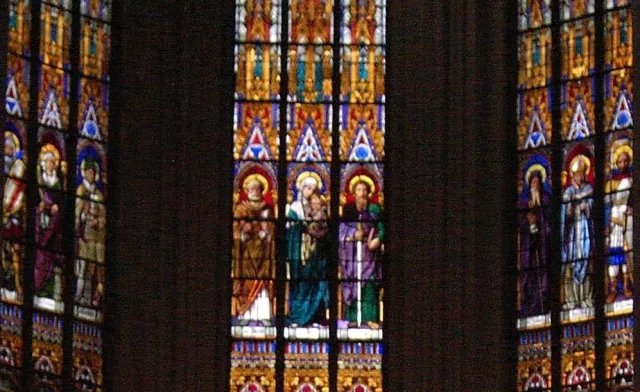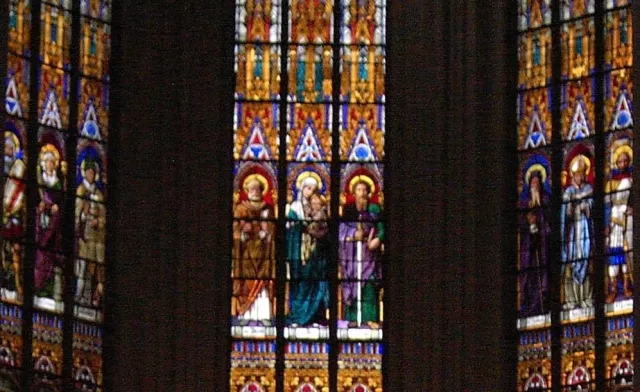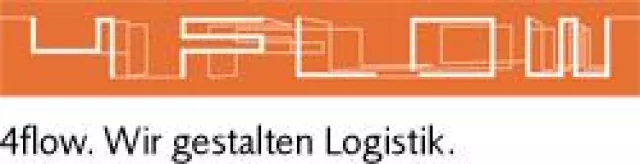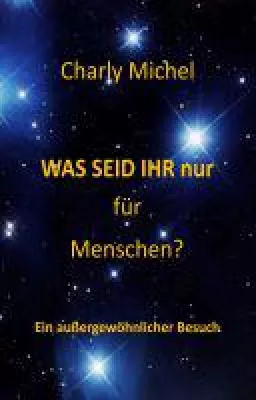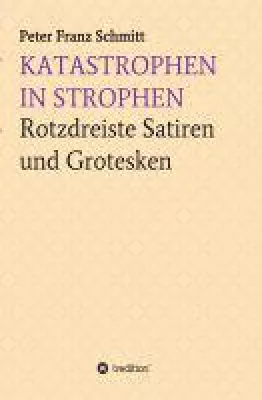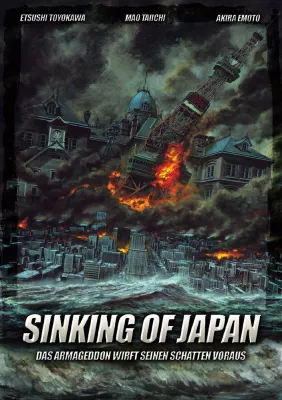(openPR) Katastrophen in Natur und Technik - Erdbeben, Tsunami und Atom-GAU in Japan
Japan wurde von einem sehr starken Erdbeben und Tsunami erschüttert. In den letzten Stunden bebt die Erde immer wieder nach. Dabei gab es Tote und Verletzte, deren genaue Zahl vermutlich erst in einigen Wochen genannt werden kann. Die Erschütterungen haben einen oder mehrere Atomreaktoren beschädigt, es droht – kurz gesagt – eine nukleare Katastrophe, 25 Jahre nach dem „Super-GAU“ von Tschernobyl. Einige Gedanken dazu.
1. Seit es Menschen gibt erfahren sie Übel in Form plötzlich auftretender Schadereignisse – „Katastrophen“; das Wort steht heute für die „plötzliche Wendung“ zum Schlechten, nachdem es in der Antike noch wertneutral verwendet wurde, etwa, um die Kehre in der Dramaturgie eines Theaterstücks zu bezeichnen.
Mit der Katastrophe ist die Erfahrung verbunden, dass Natur und Technik für den Menschen nicht nur nützlich sind, sondern auch gefährlich werden können. Die Deutung dieser Gefahren ist ein Thema, das in immer wieder neuer Gestalt auftritt.
Können wir das Übel verstehen? Wir versuchen es, müssen es versuchen, im Rahmen unserer menschlichen Kontingenzbewältigungsstrategien, d.h. durch unsere schlichte Art und Weise, den Raum von Freiheit und Möglichkeit zu füllen, durch unsere Perspektive auf Welt und Wirklichkeit, unsere Position zu Leben und Sinn, unseren Glauben.
2. Die Katastrophe in Japan weist auf die Gefahren hin, die Natur und Technik in sich bergen, und die zu Übeln werden können: zu malum physicum und zu malum technologicum. Schlüssel für das malum physicum und das malum technologicum bleibt der Mensch und dessen malum morale, das einmal dafür sorgt, dass Gott die Natur strafend gegen den sündigen Menschen einsetzt oder – säkularisiert – dass die Natur selbst zur moralischen Instanz wird und „zurückschlägt“ – gegen den Menschen als „Umweltsünder“. Beim malum technologicum ist es erst recht der Mensch, der verantwortlich ist: Er bestellt, schafft, nutzt technische Systeme. Dazu gehören auch Großsysteme wie die Atomenergie.
3. Der Diskurs zur Deutung von Katastrophen wird unter den Stichworten „Theodizee“, „Technodizee“ und „Anthropodizee“ geführt. Zwar entwickeln sich die jeweils vorherrschenden Deutungsmuster historisch entlang der dominierenden weltanschaulichen Sinnzuschreibung, doch bedeutet dies keine Sukzession von Vorstellungswelten, sondern ihre tendentielle Favorisierung seitens der Mehrheit. Heute treten nach wie vor alle drei Konzepte im Katastrophendiskurs auf. Am deutlichsten ist eine Entwicklungsrichtung im Hinblick auf konkrete Bewältigungsformen erkennbar: Klagte man früher zu Gott, verklagt man heute den AKW-Betreiber. Letztlich stehen wir alle vor dem Gericht der Sittlichkeit. Anklagepunkt: Unser Verhalten als Verwender der Natur und Benutzer von Technik.
4. Für gläubige Menschen stellt sich angesichts des Übels der Sünde (malum morale) und des Übels in Gestalt von Naturkatastrophen (malum physicum) die Frage nach der Rechtfertigung eines gütigen, allwissenden und allmächtigen Gottes. Gottfried Wilhelm Leibniz unternimmt in seiner Theodizee (Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, 1710) den Versuch, die Freiheit des Menschen und die Güte Gottes angesichts des in der Welt erkennbaren Übels in Einklang zu bringen. Vgl.: http://jobo72.wordpress.com/2010/10/27/so-gut-es-geht-leibnizens-theodizee/
5. In einer Welt der vollständigen Technisierung wird nicht mehr der Schöpfer-Gott vor Gericht gestellt und zu rechtfertigen versucht, wie dies in der Theodizee der Fall war, sondern der Mensch als „Schöpfer der Technik“ hat sich zu verantworten. Der Philosoph Hans Poser hat dafür den Begriff Technodizee geprägt. In Analogie zu Leibnizens Argumentation in der Theodizee entwickelt Poser den Gedanken, dass das Übel unserer Zeit das malum technologicum sei, das heißt die Möglichkeit der Einschränkung menschlicher Freiheit durch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und die ständig virulente Gefahr von Katastrophen als Ergebnis von Technik. Kurz: Die Technik, die wir schufen, um freier zu werden, schränkt uns zunehmend ein.
6. Die Strukturanalogie von Theodizee und Technodizee legt im Ergebnis nahe, nach bestem Wissen und Gewissen eine Bewertung von Technik jenseits der eindimensionalen ökonomischen Verwertungslogik vorzunehmen und nach einer Antwort auf die Frage nach „gut“ und „böse“ für den Menschen zu suchen. Nur eine solche Technik ist gerechtfertigt, bei der die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Folgen berücksichtigt sind. Die Strukturanalogie gebietet ferner, die für die Technikgenese Zuständigen – und das sind wir alle – stärker in die Verantwortung zu nehmen, mit dem Ziel, künftiges Technik-Übel zu verhindern.
7. Natur-Übel und Technik-Übel berühren sich zunehmend, wie auch die aktuelle Katastrophe in Japan zeigt. Malum physicum oder malum technologicum – das lässt sich nicht mehr trennen, zu sehr ist die Natur vergesellschaftet, zu umfassend ist die technologische Verfügungsmacht des Menschen. Die entscheidende Klammer ist also das malum morale, das moralische Übel. Verantwortlichkeit ist das zentrale Interpretament des aktuellen Katastrophendiskurses. Dazu gehört für den Christen die Rückbesinnung auf die schöpfungstheologische Herrschaftsverantwortung des Menschen, die zu Bewahrung der Schöpfung aufruft.
(Josef Bordat, http://jobo72.wordpress.com/)