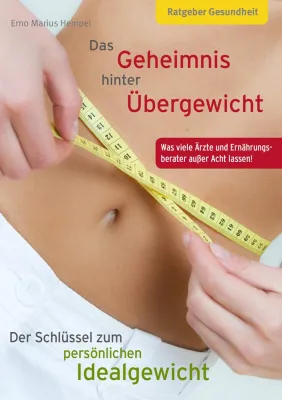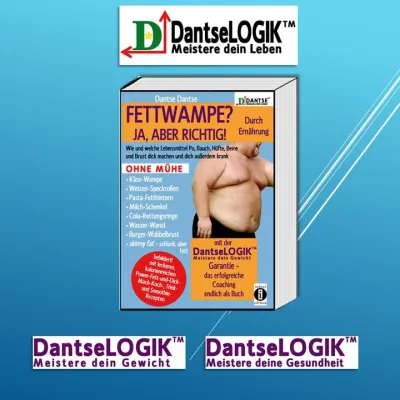(openPR) Rund und und gesund - das passt nicht unbedingt zusammen. Dass der Wohlstandsbauch beim Menschen ernst zu nehmende Krankheitsrisiken birgt, ist bekannt. Dass zu gut gefütterte Pferde der gleichen Gefahr ausgesetzt sind, wird dagegen noch oft ignoriert. Man spricht in diesem Zusammenhang häufig vom "Equinen Metabolischen Syndrom" (EMS). Was ist EMS eigentlich und welche Risiken bestehen für Ihr Pferd?
Bei Pferden ist ein Zustand bekannt, welcher Parallelen zu dem beim Menschen beschriebenen Komplex aufweist, das Equine Metabolische Syndrom (EMS). Pferde mit EMS haben in der Regel einen sehr hohen Body Condition Score. Die Fettverteilung ist zugunsten des Bauchraumes verschoben. Dieses "innere" (viszerale, abdominale) Fett ist hormonell besonders aktiv und grenzt sich damit qualitativ von anderen Fettkompartimenten des Körpers ab, wie z. B. dem Auflagen- oder Depotfett. Unbeschadet dessen weisen betroffene Pferde meist auch äußerlich typische Fettablagerungen auf, besonders häufig im Mähnenkamm, aber auch rund um den Schweifansatz, am Rumpf und bei männlichen Pferden in unmittelbarer Nähe des Schlauches.
Die Fettzellen des viszeralen Gewebes schütten freie Fettsäuren und bestimmte Stoffe (Adipokine) aus. Die Freisetzung der Substanzen geschieht ab einer kritischen Größe der Fettzellen in besonders hohem Maße. Diese Substanzen bewirken über einen sich selbst verstärkenden Prozess eine herabgesetzte Ansprechbarkeit des Fettgewebes auf Insulin. So wird es möglich, dass auch bei hohen Insulinblutspiegeln freie Fettsäuren und Adipokine aus den Fettzellen freigesetzt werden, über den Blutstrom zu insulinabhängigen Zielorganen (Skelettmuskulatur, Fettgewebe, Leber) transportiert werden und auch dort die Ansprechbarkeit auf Insulin herabsetzen. Dieser Zustand wird als Insulinresistenz bezeichnet. In der Anfangsphase versucht der Körper, vermehrt Insulin aus der Bauchspeicheldrüse abzugeben und so zu kompensieren. Wird der Kompensationsmechanismus überlastet, ist die Aufnahme von Glucose aus dem Blutstrom in Zellen insulinabhängiger Gewebe deutlich reduziert, trotz hoher Insulinspiegel. Bei Pferden mit Insulinresistenz werden erhöhte Blutinsulinspiegel je nach Kompensationsgrad von normalen oder überhöhten Blutglucosespiegeln begleitet.
Hohe Blutglucosespiegel führen dazu, dass Plasmaproteine durch Glucoseanlagerung verändert werden. Derartige Strukturen (AGE"s) sind in der Lage, die Durchlässigkeit und Elastizität von Blutgefäßwänden unvorteilhaft zu verändern, Ablagerungen an den Gefäßwänden zu begünstigen und das "schlechte Cholesterin" (LDL) durch Oxidation zu verändern, wobei aggressive Radikale entstehen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von "Glucotoxizität". Dieser Begriff ist aus der Diabetesforschung beim Menschen wohlbekannt. Insulin wiederum bewirkt eine Verengung der Blutgefäße dadurch, dass die Synthese von Stickoxid reduziert wird, welches für die Entspannung der Gefäßwand zuständig ist. Parallel dazu fördert Insulin die Produktion einer Substanz, die direkt gefäßverengend wirkt. So vorgeschädigte Blutgefäße können im feinen Kapillargebiet im Zehenendbereich des Hufes Prozesse auslösen, die für die Entstehung von Hufrehe (mit)verantwortlich sind. Dies trifft um so mehr zu, als AGE"s offenbar in der Lage sind Enzyme (Metalloproteinasen) zu aktivieren, welche die "Kittsubstanz" (Laminin etc.) zwischen Hufbein und Hufwand abbauen. In einem Experiment an gesunden Ponys wurde jedoch gezeigt, dass anhaltend hohe Insulinspiegel zur Auslösung von Hufrehe ausreichen, auch ohne die "Mithilfe" überhöhter Glucosespiegel.
Für die Praxis gibt es im Wesentlichen zwei Schlussfolgerungen. Pferde bzw. Ponys mit der beschriebenen metabolischen Neigung müssen schlank und körperlich aktiv bleiben. Sportliche Betätigung erhöht die Anzahl von Insulinrezeptoren an der Skelettmuskulatur, weshalb die Tiere wesentlich besser mit Insulin umgehen können. Selbst regelmäßige Bewegung geringer Aktivität vermag das metabolische Wohlbefinden zu steigern. Dies trifft auch und besonders auf alte Pferde zu. Das Entscheidende ist jedoch der Body Condition Score. Fette Tiere sind eindeutig Risikokandidaten. Pferde kann man einer Reduktionsdiät unterziehen, indem man die angestrebte Körpermasse festlegt (z. B. 73 MJ verdauliche Energie pro Tag für eine Zielmasse von 600 kg), und dann den Energiebedarf für diese Zielmasse um etwa 30 Prozent reduziert (73 - 22 = 51 MJ verdauliche Energie pro Tag). Solche energiereduzierten Rationen sind raufutterbasiert, mit der notwendigen Ergänzung an Vitaminen und Mineralstoffen. Ponys können nicht risikolos einer Reduktionsdiät unterzogen werden, da sie zur Fettmobilisation neigen und so eine leicht tödlich endende Hyperlipidämie entwickeln können. Zwar blieben Ponys in einer jüngeren Studie auch bei einer Körpermassereduktion von 1 Prozent pro Woche gesund, jedoch sollte dies vorsichtshalber (noch) nicht verallgemeinert werden. Ponys dürfen nur sehr vorsichtig "abgespeckt" werden, indem man zwar auch hier eine Zielmasse festlegt, den Energiebedarf für diese Masse aber zu 90 Prozent erfüllt.