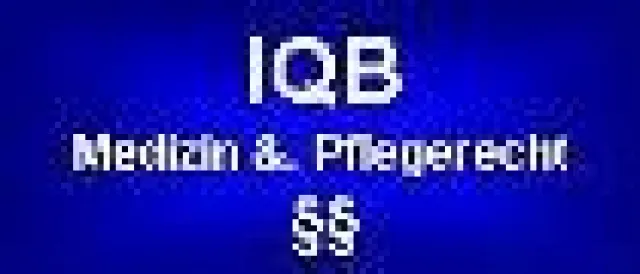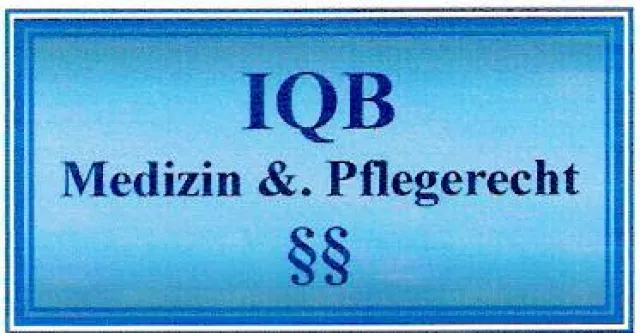(openPR) LIEBENAU – Die Beihilfe zur Selbsttötung – in der Fachsprache auch Assistenz beim Suizid genannt – soll in Deutschland künftig unter Strafe gestellt werden. An der aktuellen Diskussion über den Gesetzentwurf zum § 217 StGB beteiligt sich auch die Stiftung Liebenau. Eine Stellungnahme des Ethikkomitees der Stiftung befasst sich mit rechtlichen und ethischen Aspekten der Suizidbeihilfe.
Würdevoll leben bis zuletzt
In den Einrichtungen der Stiftung Liebenau werden allein in Deutschland mehr als 3 000 alte Menschen betreut. Die Begleitung in den letzten Lebenstagen, die Ermöglichung eines würdevollen Lebens bis zuletzt, ist eine wichtige Aufgabe in dieser Arbeit. Das geplante Gesetz zur Suizidbeihilfe ist daher für die Stiftung Liebenau von großer Bedeutung. Das Ethikkomitee der Stiftung hat im Auftrag des Vorstands die rechtlichen und ethischen Aspekte der Suizidbeihilfe eingehend erörtert und bewertet und eine Stellungnahme vorgelegt.
Sterbehilfe versus Sterbebegleitung
Notwendig erscheint dem Komitee zunächst eine Begriffsklärung. Es grenzt den assistierten Suizid ab von der Tötung auf Verlangen, wie von der passiven und der indirekten Sterbehilfe, aber auch von der Sterbebegleitung. Irreführend ist es nach Meinung des Ethikkomitees, bei einem Handeln gegen den Willen des Patienten von "Sterbehilfe" zu sprechen.
Verwaltungs- statt Strafrecht
Für die Stiftung Liebenau ist der Respekt vor der Autonomie des Menschen ein unbedingt zu wahrendes Gut. Entsprechend müssen – nach ethischer Bewertung – die Rechtsordnungen pluraler Gesellschaften die persönliche Autonomie des Einzelnen über seinen Entschluss zur Selbsttötung respektieren. Das Ethikkomitee schlägt daher vor, zu prüfen, ob auf das Instrument des Strafrechts verzichtet werden und stattdessen eine Regelung auf der Ebene des Verwaltungsrechts gefunden werden kann, die beispielsweise Bußgelder für organisierte Suizidunterstützer vorsieht.
Gleichzeitig sieht die Stiftung Liebenau die Gefahr, dass gesellschaftlicher Druck auf Schwerkranke entstehen könnte, das Angebot der organisierten Sterbehilfe anzunehmen. Das Menschenbild der Gegenwart, das zur optimalen Gestaltung auch der letzten Phase des Lebens motiviert, könnte eine solche Entwicklung begünstigen und etwa den "Sterbetourismus" befördern.
Prävention und Hospizarbeit statt Suizidbeihilfe
Christliche Träger befinden sich per se in einem Spannungsfeld. Einerseits lehnt die christliche Ethik die Selbsttötung grundsätzlich ab, weil sie das Leben als eine Gabe versteht, über die der Mensch nicht eigenmächtig verfügen soll. Andererseits muss sie dem, der sich selbst töten will, mit Respekt begegnen. Auch in den Einrichtungen christlicher Träger ist die Achtung des Willens der Bewohner für eine Vertrauensbeziehung grundlegend. Zum Umgang mit dieser Konfliktsituation gibt das Ethikkomitee konkrete Empfehlungen. Im Vordergrund stehen dabei die Suizidprävention, Hospizarbeit und Palliativpflege.
Eine aktive Beihilfe zum Suizid ist Mitarbeitern der Stiftung untersagt. Gleichzeitig soll jedoch einem entsprechenden Bewohnerwunsch mit Respekt begegnet werden. Sinnvoll ist es in jedem Fall, so das Ethikkomitee, mit Bewohnern schon vor dem Einzug über dieses Thema zu sprechen und die jeweiligen Positionen zu erläutern.
Aufgaben des Ethikkomitees
Das Ethikkomitee ist ein unabhängiges Gremium unter Leitung von Prof. Dr. Bruno Schmid. Es befasst sich mit den ethischen Aspekten der Entwicklung der Stiftung Liebenau, ihrer Gesellschaften und des politischen Umfeldes und reflektiert diese auf der Grundlage ihrer Satzung und ihrer Unternehmensphilosophie. Das Ethikkomitee stärkt die Ethikkompetenz der Mitarbeiter, erarbeitet Handreichungen zum internen Gebrauch und nimmt Stellung zu relevanten ethischen Diskussionen.
Info:
Mehr über das Ethikkommitee der Stiftung Liebenau sowie die Stellungnahme "Beihilfe zum Suizid in ethischer Bewertung" finden Sie unter http://www.stiftung-liebenau.de/stiftung-liebenau/ethikkomitee/index.html.
In gedruckter Form erhalten Sie die Stellungnahme unter der Telefonnummer 07542 10-1207.