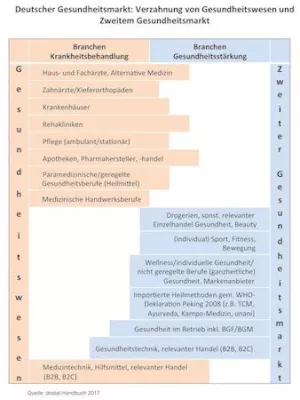(openPR) Mit der immer engmaschigeren Regulierung von Gesundheitsprodukten (siehe nur zuletzt die Health Claims Verordnung im Lebensmittelbereich) lohnt es sich für Unternehmen des Gesundheitssektors, solche Produktnischen zu erschließen, die zwar bislang eher abseitig waren, dafür aber noch einen vergleichsweise weitgehenden rechtlichen Spielraum bei der Gestaltung und Bewerbung von Produkten lassen. Eine solches spannendes Nischenprodukt sind Tierkosmetika.
Ähnlich wie im Humanbereich ist die Unterscheidung von (Tier-)Arzneimitteln und (Tier-) Kosmetika deshalb von überragender praktischer Bedeutung, weil beide Produktkategorien unterschiedlich stark reguliert sind: Während etwa die Herstellung von Tierarzneimitteln erlaubnispflichtig ist, das Inverkehrbringen grundsätzlich eine Zulassung voraussetzt und die Vertriebswege in aller Regel auf Apotheken und tierärztliche Hausapotheken limitiert sind, unterliegen Herstellung und Vertrieb von Tierkosmetika nur rudimentären Regelungen. Der Anreiz für Unternehmen, ein bestimmtes Produkt nicht als Tierarzneimittel, sondern als Tierkosmetikum in Verkehr zu bringen, ist daher noch wesentlich größer als im Humanbereich.
Unter den Begriff des"Tierkosmetikums" (auch"Tierpflegemittel" genannt) fallen nur Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die ausschließlich dazu bestimmt sind, äußerlich am Tier zur Reinigung oder Pflege oder zur Beeinflussung des Aussehens oder des Körpergeruchs angewendet zu werden, soweit ihnen keine Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen zugesetzt sind, die vom Verkehr außerhalb der Apotheke ausgeschlossen sind. Bei der Entwicklung solcher Produkte, insbesondere bei der Formulierung der"Claims", ist daher noch größere Vorsicht geboten als bei vergleichbaren Abgrenzungsproblematiken im Humanbereich.
Dies gilt umso mehr, da der Arzneimittelbegriff des § 2 Abs. 1 AMG, insbesondere der Funktionsarzneimittelbegriff des § 2 Abs. 1 Nr. 5 AMG, praktisch uferlos ist und bei wörtlicher Auslegung durchaus auch kosmetische Zwecke umfasst. Behörden und Instanzgerichte tendieren allerdings nicht selten zu einer eher weiten Auslegung des Arzneimittelbegriffs, die dann auf Kosten der Vertriebsfähigkeit einschlägiger Produkte als Tierkosmetikum geht. Exemplarisch hierfür mag eine Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen stehen, das eine Pferdesalbe mit einem Anteil von 0,5 % Kampher nicht als Tierkosmetikum, sondern als Tierarzneimittel eingestuft hat (Beschluss vom 26.04.2005, Aktenzeichen: 13 A 1010/03).
Dem ist das Bundesverwaltungsgericht zwischenzeitlich allerdings entgegen getreten und hat in einem aktuellen Urteil klargestellt, dass der Arzneimittelbegriff bei der Abgrenzung von Tierarzneimitteln und Tierkosmetika auszulegen ist (Urteil vom 16.05.2007, Aktenzeichen: 3 C 34.06). Die Einstufung als Arzneimittel setze voraus, so das Gericht, dass eine"nennenswerte" Einwirkung auf den Stoffwechsel oder eine"wirkliche" Beeinflussung der Funktionsbedingungen des tierischen Körpers vorliegt. Es müsse also eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschritten werden. Eingriffe in die Körperfunktion, die völlig unerheblich sind, könnten dagegen die Zuordnung zu Arzneimitteln nicht rechtfertigen.
Dieses Postulat des Bundesverwaltungsgerichts, Produkte nicht vorschnell als Arzneimittel einzustufen, verdient im Grundsatz Beifall. Allerdings trägt das vom Gericht herangezogene Kriterium einer"wirklichen" Beeinflussung der Funktionsbedingungen bzw. einer"nennenswerten" Einwirkung auf den Stoffwechsel eher den Charakter einer Faustformel und ist wenig geeignet, den Begriff des (Funktions-)Arzneimittels in praktisch handhabbarer Weise zu präzisieren.
Letztlich kommt es daher bei der Frage, ob ein Produkt als Tierarzneimittel oder Tierkosmetikum einzustufen ist, immer auf den konkreten Einzelfall an, insbesondere auf die Auffassung der pharmazeutischen- und Veterinärwissenschaft hinsichtlich der konkreten Verwendung eines bestimmten Stoffes in einem bestimmten Produkt. Für die bereits angesprochene Pferdesalbe mit einem Anteil von 0,5 % Kampher hat das Bundesverwaltungsgericht als Ergebnis einer solchen Einzelfallprüfung die Eigenschaft als Arzneimittel - anders als das OVG Nordrhein-Westfalen in der Vorinstanz - verneint, da ihm die Indizien für das Vorliegen einer erheblichen Beeinflussung der körperlichen Funktionsbedingungen nicht ausreichten. Ein Freifahrtschein für kampherhaltige Erzeugnisse ist damit allerdings nicht erteilt; je nach Zusammensetzung und Bewerbung des jeweiligen Produkts mögen andere kampherhaltige Präparate durchaus als Arzneimittel einzustufen sein.
Insgesamt kann daher festgehalten werden: Die Produktkategorie des Tierkosmetikums ist zwar besonders reizvoll, aber auch besonders schwierig gegenüber Tierarzneimitteln abzugrenzen ist. Es bedarf daher bei der Produktentwicklung nicht nur einer genauen Befassung mit dem vorhandenen wissenschaftlichen Datenmaterial, sondern auch besonderer Vorsicht bei der Formulierung der entsprechenden Werbe- und Wirkversprechen. Mit seinem"Pferdesalben"-Urteil vom 16.05.2007 hat das Bundesverwaltungsgericht zwar die Weichen in Richtung einer Liberalisierung im Sinne einer zurückhaltenden, maßvollen Anwendung des Tierarzneimittelrechts zu Gunsten der Kategorie der Tierkosmetika gestellt. Gerade Behörden tun sich aber erfahrungsgemäß schwer damit, solche von der Rechtsprechung angestoßenen Liberalisierungstendenzen im jeweiligen Einzelfall des Alltagsgeschäfts pragmatisch umzusetzen. Die Abgrenzung von Tierarzneimitteln und Tierkosmetika bleibt daher spannend.
Weitere unverbindliche und kostenfreie Informationen rund um das Arzneimittelrecht erhalten Sie unter www.juravendis.de