(openPR) Vom 13. Mai bis 3. Juni präsentiert das CAM (Casoria Contemporary Art Museum) im
Kunsthaus Tacheles Berlin die Ausstellung „MAY BE | CAM to Berlin“.
Die Ausstellung mit Arbeiten der neapolitanischen Künstler Monica Biancardi, Sergio Riccio, Mario Spada, Fulvio di Napoli und Sebastian Deva wird vom Leiter des Museums Antonio Manfredi kuratiert.
Eine außergewöhnliche Rauminstallation widmet sich, wie schon der Titel „They could live in Germany“ verrät, der Unterwanderung Deutschlands durch Mafiaorganisationen und basiert auf tatsächlichen hier stattgefundenen Ereignissen, deren Hauptakteure der Mafia angehörten.
Die dargestellten 15 Personen sind Flüchtlinge aus dem Mafia, Kamorra und 'Ndrangheta Untergrund, gegen die ein internationaler Haftbefehl vorliegt, und die durch diese fotografische Installation auf den Körpern von anonymen Passanten leben. Die Figuren verkörpern Menschen, die man auf den Straßen von Berlin treffen könnte, sie sind ein Spiegelbild der Mahnung des CAM Casoria an das deutsche Volk: Sie könnten in Deutschland leben.
Der Ausstellungsweg setzt sich fort mit der, in der Sprache der zeitgenössischen Kunst wiedergegebenen Analyse einiger typischer Elemente der organisierten Kriminalität Italiens ins Besondere Neapels.
Die Ausstellung ist eine Reise in das komplexe Phänomen der Camorra, sie konfrontiert den Betrachter mittels einer zu diesem Zweck geschaffenen Rauminstallation mit kriminellen Unterwanderung Deutschlands durch Mafiaorganisationen.
(Casoria Contemporary Art Museum)
Presseinformation
Maybe CAM in Berlin - They could live in Germany
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:Kunsthaus Tacheles
Über das Unternehmen
"Über die Jahre seiner Existenz ist das Kunsthaus Tacheles zu einem komplexen Gesamtkunstwerk gewachsen. Dafür spricht, dass weit über Berlin hinaus das Kunsthaus Tacheles ein Symbol für die Situation des wiedervereinigten Berlins und den Aufbruch in eine frische, von merkantilen Gesichtspunkten weitgehend befreite künstlerische Gegenwart geworden ist. Das Kunsthaus Tacheles steht als Teil des Images eines neuen, um Profil ringenden, künstlerisch freien Berlins international deutlich da.
Die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler über die Jahre ist selbstverständlich, wie bei selbstverwalteten und –initiierten Projekten leicht verständlich, nicht frei von Widersprüchen. Indes sind solche organisatorischen Probleme und die Fragen der Verfassung des Hauses eher zweitrangig zu sehen: neben dem enormen Zugewinn an künstlerischer Potenz und an der Deutlichkeit mit der die Institution auf einen Gegenpol zur bestehenden herrschenden und institutionalisierten Kultur zielt, ist doch das Kunsthaus Tacheles selbst, wie es die Betreiber einmal formuliert haben, Versuchs-anordnung, quasi Kunst-Labor und damit sowohl Gehäuse wie auch Gegenstand künstlerischen Handelns. Tacheles hat eine Struktur und ein Gehäuse, beide ergänzen und durchdringen einander, und für die Zukunft des Tacheles muß diese Konstruktion zunächst gewährleistet sein. Alternativen sind nicht einfach durch Bereitstellung von Räumen herzustellen, sondern das Tacheles selbst in seiner spezifischen Konstruktion und kunststrategischen Lage ist ein Ort, der die Entwicklung von Berlin - Mitte bislang sichtbar mitbestimmt und profiliert hat.
Der Aspekt des Gesamtkunstwerkes ist in der bisherigen Diskussion meines Erachtens völlig unzureichend berücksichtigt worden. So wie das Tacheles die Zentrierung internationaler, junger, experimenteller und fließender Kunstformen auf Berlin - Mitte befördert hat, so ist es in der heutigen Situation auch als Punkt der Auseinandersetzung weiterhin lebender Teil eines gesamtkünstlerischen Prozesses. Das Tacheles muß erhalten bleiben, um die Prozesse weiterführen zu können und zu Lösungen bringen zu können, die künstlerisch angelaufen sind.
Das Gesamtunternehmen Tacheles als Kunstwerk könnte nicht von der Bildfläche verschwinden, ohne gleichzeitig ein Riesenloch und einen erheblichen Verlust im schwachen Gefüge der zeitgenössischen Berliner Kunstsituation zu hinterlassen. Das Tacheles ist Teil der Berliner kreativen und experimentellen Kunstgegenwart.“
Prof. Dr. Ulrich Krempel, Leiter des Sprengel-Museums Hannover, Mai 97
Die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler über die Jahre ist selbstverständlich, wie bei selbstverwalteten und –initiierten Projekten leicht verständlich, nicht frei von Widersprüchen. Indes sind solche organisatorischen Probleme und die Fragen der Verfassung des Hauses eher zweitrangig zu sehen: neben dem enormen Zugewinn an künstlerischer Potenz und an der Deutlichkeit mit der die Institution auf einen Gegenpol zur bestehenden herrschenden und institutionalisierten Kultur zielt, ist doch das Kunsthaus Tacheles selbst, wie es die Betreiber einmal formuliert haben, Versuchs-anordnung, quasi Kunst-Labor und damit sowohl Gehäuse wie auch Gegenstand künstlerischen Handelns. Tacheles hat eine Struktur und ein Gehäuse, beide ergänzen und durchdringen einander, und für die Zukunft des Tacheles muß diese Konstruktion zunächst gewährleistet sein. Alternativen sind nicht einfach durch Bereitstellung von Räumen herzustellen, sondern das Tacheles selbst in seiner spezifischen Konstruktion und kunststrategischen Lage ist ein Ort, der die Entwicklung von Berlin - Mitte bislang sichtbar mitbestimmt und profiliert hat.
Der Aspekt des Gesamtkunstwerkes ist in der bisherigen Diskussion meines Erachtens völlig unzureichend berücksichtigt worden. So wie das Tacheles die Zentrierung internationaler, junger, experimenteller und fließender Kunstformen auf Berlin - Mitte befördert hat, so ist es in der heutigen Situation auch als Punkt der Auseinandersetzung weiterhin lebender Teil eines gesamtkünstlerischen Prozesses. Das Tacheles muß erhalten bleiben, um die Prozesse weiterführen zu können und zu Lösungen bringen zu können, die künstlerisch angelaufen sind.
Das Gesamtunternehmen Tacheles als Kunstwerk könnte nicht von der Bildfläche verschwinden, ohne gleichzeitig ein Riesenloch und einen erheblichen Verlust im schwachen Gefüge der zeitgenössischen Berliner Kunstsituation zu hinterlassen. Das Tacheles ist Teil der Berliner kreativen und experimentellen Kunstgegenwart.“
Prof. Dr. Ulrich Krempel, Leiter des Sprengel-Museums Hannover, Mai 97
Pressebericht „Maybe CAM in Berlin - They could live in Germany“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von Kunsthaus Tacheles


Nachveröffentlichung des Leo-Greller-Hörbuchs "Halblang, Kleines!" zum 20. Jubiläum
_Zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Leo-Greller-Hörbuchs, feiert die Kulturszene ein besonderes Jubiläum: Ab sofort steht das bisher unveröffentlichte Hörspiel "Halblang, Kleines!" aus dem Jahr 2003 kostenlos im Internet zum Anhören bereit._
Liedermacher, Aussteiger und sanfter Poprebell
Leo Greller bereichert seit nunmehr zwei Dekaden als Liedermacher, Aussteiger und sanfter Poprebell Hamburg, Berlin und ein wenig auch den Rest der Republik. Seine Karriere durchlief verschiedene Phasen: von musikalischen Erfolgen über provo…


Verantwortungsbewusste Satire hat Zukunft
_Verantwortungsbewusster politischer Humor spielt in unserer heutigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung, der kritischen Auseinandersetzung und der Schaffung eines gesellschaftlichen Bewusstseins. Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Medien und der Reichweite sozialer Plattformen ist es wichtig, dass Satire ein hohes Maß an Verantwortung und Sensibilität gewährleistet. Diese Form der Kunst erfordert ein feines Gleichgewicht zwischen Humor und Respekt vor gesellschaftlichen Minoritäten._
Die Schaffung von politisch…
Das könnte Sie auch interessieren:


2017 Parliamentary Elections: Jamaica for Germany?
In less than two months, Germany will hold parliamentary elections. A tool developed at HHL Leipzig Graduate School of Management calculates the allocation of seats in parliament as well as stable coalition relationships and analyzes the distribution of ministries between possible government partners based on the latest weekly data.
---
Jamaica Coalition, …
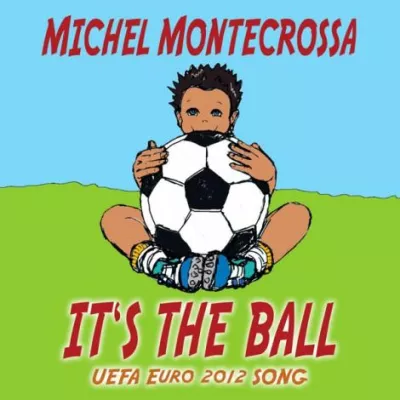
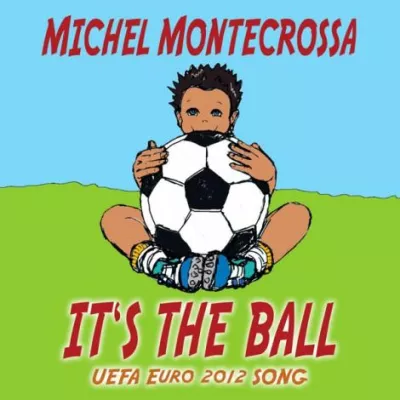
Michel Montecrossa veröffentlicht zur Fußball-EM 2012 Topical-Song ‘It’s The Ball’ über sportliches Verhalten
‘It’s The Ball’, Michel Montecrossa’s Topical-Song & Film für die Fußball-EM 2012, ist der Bereitschaft zu sportlichem Verhalten gewidmet und wird von Mira Sound Germany als Single und DVD veröffentlicht. Der Song und das Video zu ‘It’s The Ball’ sind auf der Michel Montecrossa Homepage verfügbar und die Single steht bei Bandcamp zum Download bereit. …


Hylton's Electric Connection - Access Control Systems
Do one ever wonder who is entering one's building and when? Do one have employees who should have access to one's building, but not after certain hours? Or maybe one're wondering who found the key to one's front door that was lost last week and one's now wondering who has full access to one's business?
With electronic access control systems one can have …


Aircraft Engine Monitoring: How It Works
… reasons, it usually means that the airline not only has to have the aircraft towed away for expensive emergency repairs, it has to make alternate arrangements to fly the passengers maybe even provide accommodation and food while the passengers are waiting. All put together, it can be one big frightful bill and just a few of these in a year would be …


Lawn & Garden Maintenance Services Australia
… garden maintenance on your own, what starts as a small cleaning operation usually ends up with a big list of requirements. As you clean, you realise there are a lot of things you've missed. Maybe you notice that the plants are being eaten by some pest or there appears to be water logging in one part of the lawn or some of the sprinklers are not working or …


Das drohende Ende der Nomadenkulturen - Eine europaweite Kampagne schafft Aufmerksamkeit
… extinction of Saami reindeer herding very quickly and of course it will then mean that the original Saami culture will die. The Saami people will become ordinary Finnish citizens. Maybe they speak Saami language, and maybe they wear in some cases these colourful clothes. But in the hearts, like Indians would say, they would become white man’s.”
Der Film …


Blue Cosmic and the rollin´ puppet - Alternative Rock Konzert
… 2016.http://www.bluecosmic.comhttps://www.facebook.com/Blue-Cosmic-The-Rollin-Puppet-520987128064674/?fref=ts
Vorverkauf 6,- € / Abendkasse 8,50 €
(Bei Onlinekauf zzgl. Gebühr)
Tickets direkt bei ART Stalker oder online: https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/
ART Stalker - Kunst+Bar+Events
Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin
+49(0)30 - 22052960 - - www.art-stalker.de


"MAYBE PARFUM“ endlich auch in der Schweiz angekommen
… erreichbar.
Wer möchte nicht gerne für kleines Geld seinen Lieblingsduft sein Eigen nennen ? Das ermöglicht jetzt die Kooperation mit dem jungen, deutschen Unternehmen MAYBE PARFUM aus Berlin über autorisierte Vertriebspartner in der ganzen Welt und seit Dezember nun auch in der Schweiz.
Aus derzeit insgesamt 100 verschiedenen Markendüften kann sich der Kunde sein …
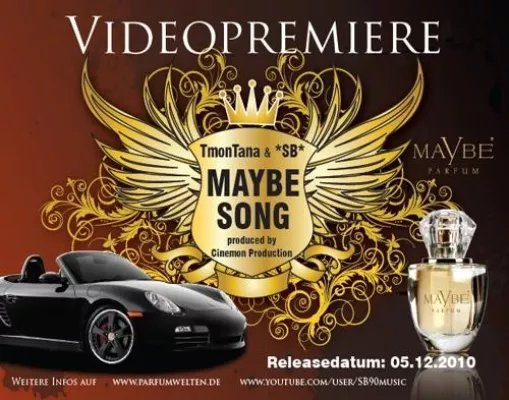
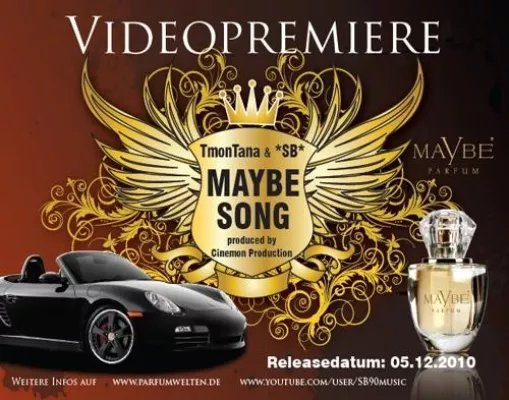
Maybe Parfum Videopremiere am 05.12.2010
… kurzen Kennlerngespräch und einer Besichtigung der Firmenzentrale trafen auch die weiteren Protagonisten des heutigen Tages ein: Das Topmodel Regina Rembold aus Singen, bekannt aus der TV-Serie Germany´s Next Top-Model und der Produzent Simon Herget aus Fulda. Und sie hatten reichlich Arbeit im Gepäck.
Schnell stellte sich heraus, das es ein sehr langer …


Overwhelming feedback to international design contest Becker Contest 2011
… be presented at the awards show on 24th May and also during the Interzum.
The winners are:
- Philip Berkemeyer, Akademie Gestaltung im Handwerk, Münster, Germany
- Chang Yu-Chih und Hu Tsuo-Ning, Weißensee Kunsthochschule Berlin, Germany
-Tobias Fink, Dipl.-Designer (FH), Aachen, Germany
- David Gekeler, Universität der Künste, Berlin, Germany
- Jan …
Sie lesen gerade: Maybe CAM in Berlin - They could live in Germany