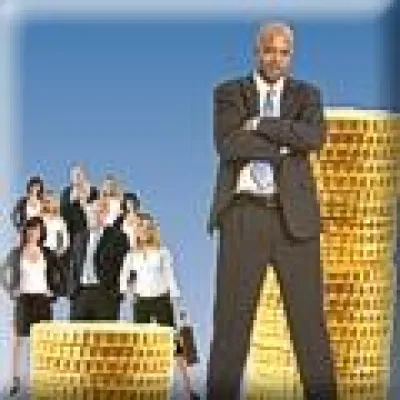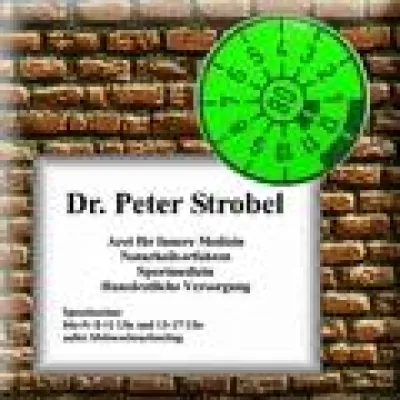(openPR) Die Einführung der diagnosebezogenen Vergütung in Krankenhäusern (Diagnosis Related Groups - DRGs) hat auch Veränderungen in der Pflege bewirkt. Diese Veränderungen haben aus Sicht der Pflegekräfte Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen mit sich gebracht: Durch eine Abnahme der Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei der Arbeit und die verstärkte Erfahrung, mehr unnötige Aufgaben wie Küchen- und Hausarbeit erledigen zu müssen. Für die Genesung der Patienten erscheint problematisch, dass der zeitliche Aufwand der Pflegenden für direkte und gezielte Kommunikation mit Patienten abgenommen hat. Dies sind die zentralen Befunde der Bilanzierung einiger schon veröffentlichter Studien durch Sabine Bartholomeyczik zur Einführung von DRGs und deren Effekte für die Pflegetätigkeit.
In einer Untersuchung im Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke wurden 2003, 2004 und 2005 an drei Krankenhäusern der Maximalversorgung in jeweils zwei Stationen Informationen über die Pflegearbeit erfasst. Als Ergebnis zeigte sich: Der relative Anteil patientennaher Tätigkeiten (pflegerische Tätigkeiten und Mitarbeit bei ärztlicher Diagnostik und Therapie) ist zwischen 2003 und 2005 zurückgegangen. Dies beruht vor allem auf einem Rückgang der direkten Pflege, während die Mitarbeit bei ärztlichen Aufgaben leicht zugenommen hat. Innerhalb der pflegerischen Aufgaben nahm vor allem die direkte und gezielte Kommunikation mit den Patienten (Krankheitsfragen, organisatorische Aspekte) ab. Hervorgehoben wird, dass unter den beobachteten Bedingungen einer Arbeitsverdichtung im Krankenhaus die zeitlichen Anteile an Küchen- und Hausarbeit eher zunehmen und insgesamt die Anteile von Kommunikation oder Körperpflege deutlich übersteigen.
Aus einem anderen Projekt stammen Daten zu beruflichen Belastungen und Beanspruchungen der Pflegenden. Dort wurde eine leichte Zunahme quantitativer Anforderungen deutlich, gekoppelt mit der Erfahrung, dass Einflussmöglichkeiten auf Arbeitsinhalte abgenommen haben und das Gefühl sich verstärkt, mehr unnötige Aufgaben erledigen zu müssen. "Die Entfremdung scheint demnach deutlich zuzunehmen", bilanziert Bartholomeyczik.
In einer weiteren Studie schließlich, dem sog. "Arbik-Projekt " - Arbeitsbedingungen im Krankenhaus wurden Pflegende und Ärzte nach der Wahrnehmung der jeweils anderen Berufsgruppe befragt. Hier zeigte sich, dass es von beiden Seiten wenig Verständnis für die jeweils andere berufliche Situation und vorhandene Probleme gibt. Vielfach fühlen sich die Pflegenden von den Ärzten nicht geschätzt, beklagen die schlechte Organisierbarkeit der Visiten, während die Ärzte eine fehlende Verbindlichkeit von Absprachen kritisieren.
Insgesamt zeigen die Studien, dass Pflegende in den letzten Jahren relativ seltener bei den Patienten sind, obwohl diese im Durchschnitt kränker werden, also mehr direkte Unterstützung benötigen. Der Umfang der von Ärzten delegierten Tätigkeiten hat nicht abgenommen, wohl aber die direkte Pflege und darin vor allem die Kommunikation. Problematisch erscheint dies, da Patienten bei einer kürzer werdender Verweildauer besser informiert und angeleitet werden sollten, damit sie das Krankenhaus schneller verlassen können.
Weitere Informationen:
http://www.forum-gesundheitspolitik.de/dossier/index104.htm