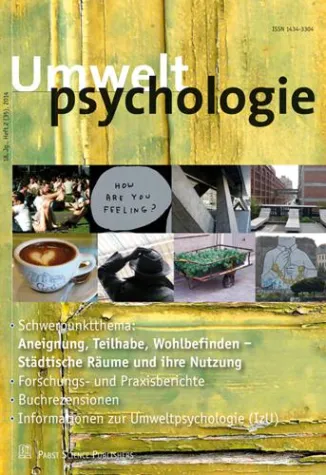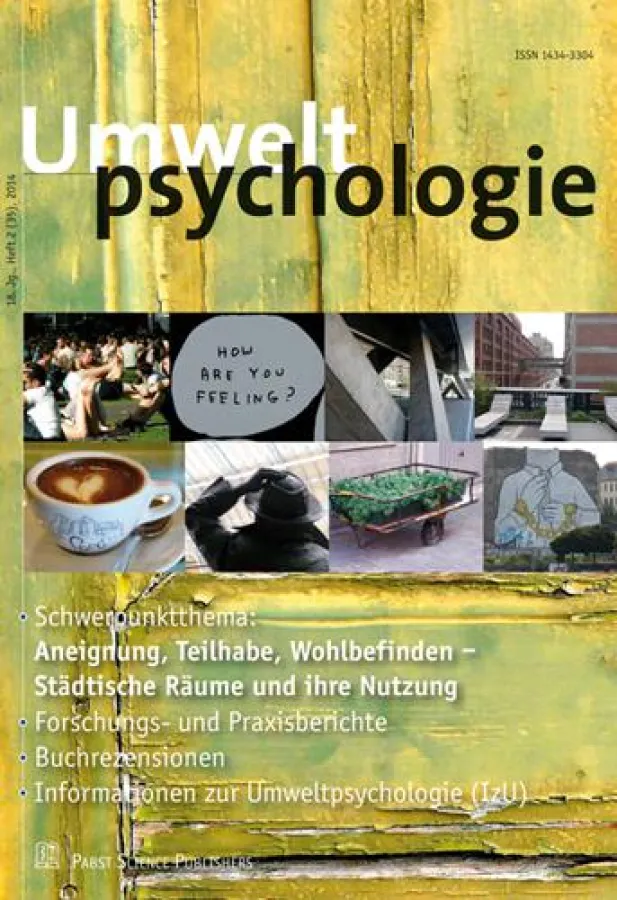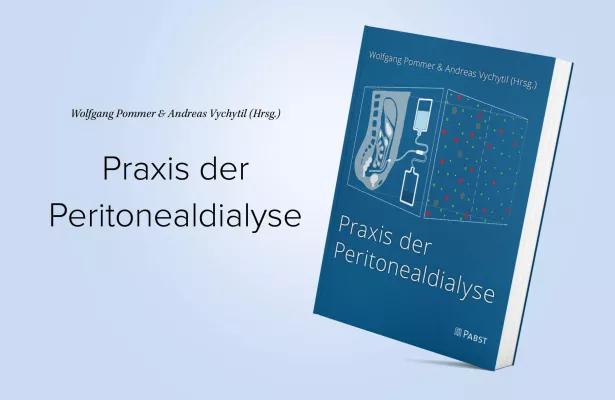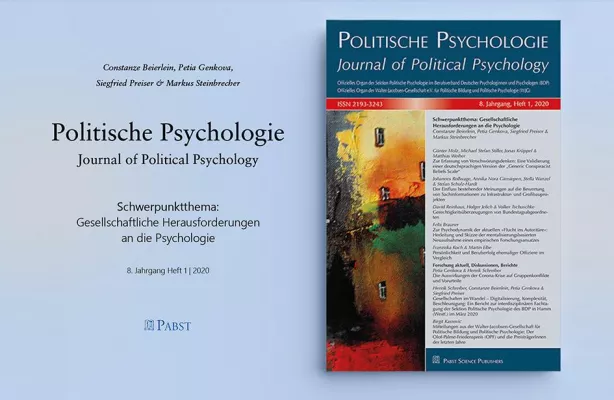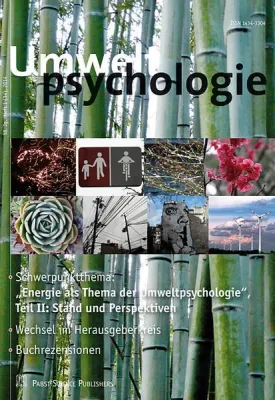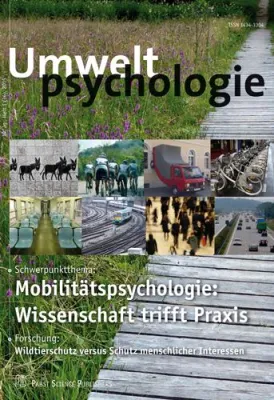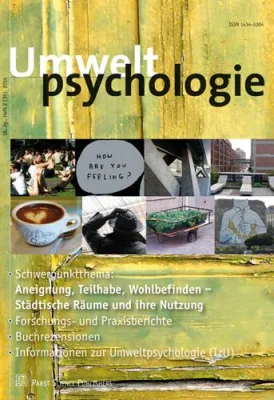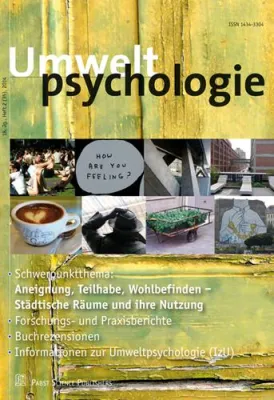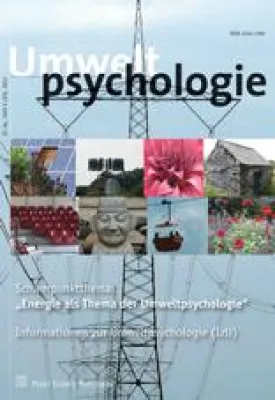(openPR) Umweltpsychologie: In Städten entstehen auf unbebauten Flächen immer häufiger Gemeinschaftsgärten. Für die Initiatoren stehen die Nachbarschaftsarbeit und die soziale Mitgestaltung der Stadt im Vordergrund; Ökologie und gesunde Ernährung spielen eine fast ebenso wichtige Rolle. Erholungsaspekte stehen in der Motivation an letzter Stelle. Dies ergab eine Studie über Initiatoren von Gemeinschaftsgärten in Berlin. Dr. Dörte Martens und Dr. Vivian Frick berichten in der Fachzeitschrift "Umweltpsychologie" über die Befunde.
"Urbane Gemeinschaftsgärten befinden sich oftmals im öffentlichen oder halböffentlichen Raum und sind daher eine prägnante Art der Stadtgestaltung im Sinne der physischen Gestaltung des Stadtbildes. Oft gelingt die Schaffung von Gemeinschaftsgärten durch aktive Aneignung öffentlichen Raumes. Durch ihre Zugänglichkeit wirken Gemeinschaftsgärten auch auf die Wahrnehmung und Erholung Nicht-Beteiligter und bilden potentielle Begegnungszonen für StadtbewohnerInnen.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends stellten Gemeinschaftsgärten insbesondere Räume der Mitbestimmung und des politischen Widerstands dar. Die Zielsetzungen sind heute teilweise breiter geworden." Häufig stehen pädagogische Wirkungen im Vordergrund. "Oft werden Gemeinschaftsgärten multifunktional genutzt und zeigen dadurch eine Vielfalt unterschiedlicher Wirkungen. Durch die Thematisierung von Umwelt- und Stadtplanungsaspekten oder durch soziale Einbindung verschiedener Bevölkerungsgruppen geschieht gesellschaftliche und politische Stadtgestaltung.
Die Gärten können wichtige gesellschaftliche Aufgaben erfüllen, da stadtökologische wie auch politische Fragestellungen aufgegriffen werden, etwa die Auseinandersetzung mit Biodiversität, Saatgut und Ernährungssouveränität. Im Vergleich zu Kleingärten greifen Gemeinschaftsgärten oft bewusst in den Dialog über die Stadtgestaltung ein, stellen sich in ein Verhältnis zur Stadt und wollen als genuiner Bestandteil von Urbanität wahrgenommen werden."
Allerdings reflektieren die Umweltpsychologinnen auch potentielle Risiken: "Gerade Gemeinschaftsgärten als Zwischennutzung bergen die Gefahr, dass sie eine zunächst kaum wahrgenommene unattraktive Brache aufwerten und dass eine maßgebliche Wertsteigerung des umliegenden Quartiers InvestorInnen anzieht. Wenn die Stadt das Potential von Freiflächen nicht erkennt und die Fläche beispielsweise veräußert, besteht die Gefahr der Verdrängung und Exklusion von Bevölkerungsschichten als Folge der Aufwertung ..."
>> Dörte Martens, Vivian Frick: Gemeinschaftsgärten - Motive zur Initiierung und Einfluss auf das Erholungserleben. In: Umweltpsychologie 2/2014, S. 103-123
www.umps.de