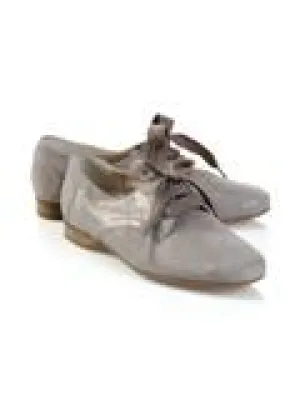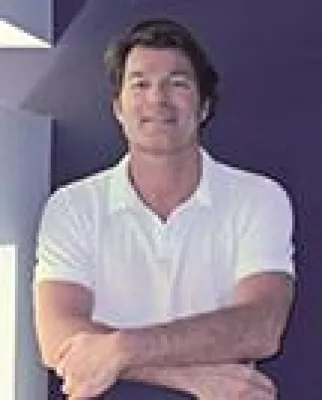(openPR) Es gibt über 150 verschiedene operative Methoden um den Hallux valgus zu behandeln. Operateure sind sich uneinig, welches Verfahren das Beste ist, beheben aber nur selten die Ursache der so genannten „Ballenzehe“. Mit Dr. Roger Weist hat das AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG einen Spezialisten für Fußchirurgie, der mit einer erfolgreichen Operationsmethode einen neuen Trend bei der Behandlung des Hallux valgus eingeleitet hat.
Der Hallux valgus – ein Schiefstand der großen Zehe - ist die häufigste Ursache für Fußschmerzen und entsteht meist anlagebedingt. Oftmals wird die Grundlage bereits im Kindergarten gelegt: 40 Prozent der Kindergartenkinder tragen zu enge Schuhe. Durch falsches Schuhwerk wird der Hallux valgus im Krankheitsverlauf zusätzlich begünstigt. Die Betroffenen halten oft jahrelang Schmerzen aus, weil sie Angst vor einer Operation haben. Diese Angst ist nicht unbegründet, da bei den üblichen Operationsmethoden, meist nicht die Ursache, sondern nur das Symptom kuriert wird.
Zu den bekanntesten Verfahren zählen die Operationstechniken nach Austin oder Chevron. Dabei wird der erste Mittelfußknochen V-förmig durchtrennt und der durchgesägte Knochen anschließend in die gewünschte Stellung verschoben. Zusätzlich muss ein Weichteileingriff vorgenommen werden. „Diese Operation soll die Beweglichkeit des Gelenkes erhalten, ist aber nur für leichte Korrekturen des Hallux valgus geeignet“, sagt Dr. Roger Weist vom AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG.
„Je größer die Fehlstellung ist, desto weiter körpernah muss die Korrektur erfolgen“, so Weist und wendet bei schweren Deformationen des Hallux valgus bevorzugt die Lapidusarthrodese an. Im Vergleich zu anderen Verfahren weist diese Operationstechnik eine weitaus niedrigere Rezidivrate auf und beseitigt Schmerzen dauerhaft. „Mit dieser Methode wird die größte Schwachstelle des Hallux valgus wieder stabilisiert“, so Weist.
Hintergrund ist: Der Fuß war früher ein Greifwerkzeug. Jetzt aber geht der Mensch aufrecht und die Fußknochen haben sich dieser Entwicklung im Laufe der Evolution nicht angepasst. Deshalb liegt in diesem Bereich häufig eine Instabilität vor.
Die Lapidusarthrodese ist eine Versteifungsoperation zwischen dem ersten Mittelfußknochen und dem inneren Keilbein. Die eingebrachten Schrauben und Plättchen müssen nach Abschluss des Heilungsprozesses nicht zwingend entfernt werden. „Stört das Material in engem Schuhwerk trotzdem, so kann es im Rahmen einer ambulanten Operation entfernt werden.“, erklärt Weist.
Dennoch bleibt die Operation ein schwerer Eingriff und lässt sich nicht im „Vorbeigehen“ erledigen. Ratsam ist es daher, die Lapidusarthrodese im Rahmen eines stationären Aufenthaltes vornehmen zu lassen.
Je nach Ausmaß des Eingriffes muss der Patient entsprechend viel Geduld mitbringen: Bis zu sechs Wochen nach der Operation darf der Fuß nur teilbelastet werden und es muss ein so genannter „Vorfußentlastungsschuh“ getragen werden, der ein Gehen auf der Sohle unter Entlastung des Vorfußes ermöglicht. Eine uneingeschränkte Sportfähigkeit ist erst nach drei Monaten zu erwarten.
„Viele machen den Fehler und belasten den Fuß zu früh. Deshalb muss nicht nur die Operation sondern auch die Nachbehandlung individuell besprochen werden“, so Weist.