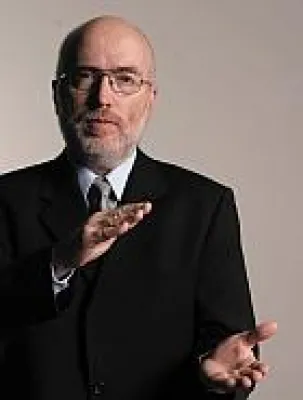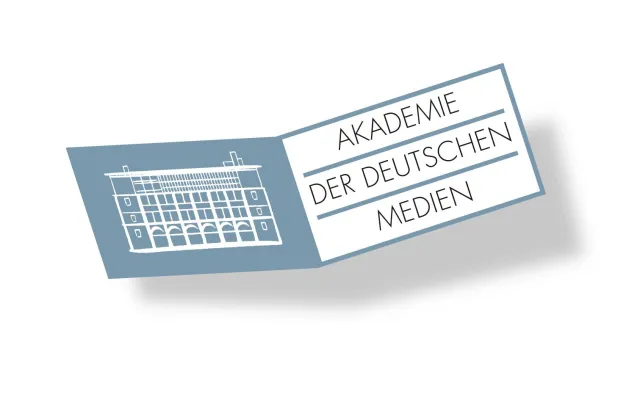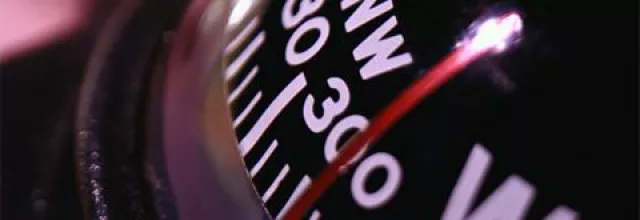(openPR) – Zukunftsorientierter Wissenstransfer und schlanke Organisationsstrukturen als Wettbewerbsvorteil –
In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise richtet sich der Fokus der Unternehmen auf Kurzarbeit, Kosten, Auftragseingänge und Liefertermine. Dabei ist die herrschende Wirtschaftskrise (Subprimekrise), auch wenn Sie eine der schwersten der Wirtschaftsgeschichte ist, nur ein mittelfristiges Phänomen. Wie auch die „Dotcom-Blase“, die Ölkrise und die Weltwirtschaftskrise 1929 wird sie in einem Aufschwung münden. Eine solche Krise fordert von jedem Unternehmen maximale Produktivität und effiziente Prozesse, um im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.
Darüber hinaus stellt der Demografische Wandel neue Herausforderungen für unsere Gesellschaft, im Besonderen für die Wirtschaft und die Unternehmen. Dieser Wandel wird unseren Hochlohn- und Hochtechnologie-Standort Deutschland auf die Probe stellen, langfristiger und intensiver als die derzeitige Wirtschaftskrise. Der Anteil der über 50-jährigen in der Gesellschaft wird in den nächsten 10 Jahren drastisch ansteigen, wobei der Anteil der 20 bis 29-jährigen sinkt. Dazu wird die Einwohnerzahl, laut des Statistischen Bundesamts, von 82 Mio. Einwohnern auf 77 Mio. Einwohner bis zum Jahr 2030 sinken. Die Alterstruktur unserer Gesellschaft, das ist bekannt, wird sich bis 2020 massiv verändern. Diese Veränderung ist nicht linear, sondern schubweise. Schubweise deshalb, weil es immer wieder stärkere und schwächere Geburtengänge gab.
Was bedeutet diese Entwicklung für die Unternehmen?
Der Wettbewerb auf den lokalen, nationalen und internationalen Märkten nimmt kontinuierlich zu und verlangt von den Unternehmen eine ebenso kontinuierliche, internationale Weiterentwicklung. Der Demografische Wandel führt zu einer alternden Belegschaft in den Unternehmen. Zudem wächst die Nachwuchsproblematik zu Zeiten des Bevölkerungsrückgangs. Diese Entwicklungen stellt ein Risiko für die Soziale Marktwirtschaft dar, denn mit ihren Sozialsystemen muss sie die Veränderung der Bevölkerungsstruktur zeitgleich abbilden und finanzieren. Mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse werden Kommunen, Land und Bund sowie deren Körperschaften vor selbige Probleme gestellt wie Unternehmen der Realwirtschaft.
Die genannten Herausforderungen lassen sich gemeinsam betrachten und bieten auch eine Chance für Kommunen, Land, Bund und Unternehmen (weiter mit „Unternehmen“ benannt). So lassen sich Unternehmen für die Zukunft schlank, effizient, effektiv aufzustellen ohne dabei das künftig wichtigste Gut - den Menschen - aus den Augen zu verlieren.
Welche Handlungsfelder ergeben sich?
Drei Handlungsfelder müssen beleuchtet werden, um die derzeitige Entwicklung als Chance zu verstehen und diese Chance auch umzusetzen: Die Arbeitsplatzgestaltung, intelligenter Wissenstransfer und das Schaffen einer schlanken Organisation. Dies sind die drei Handlungsfelder mit höchster Priorität, wobei alle drei in gegenseitiger Wirkung zueinander betrachtet werden müssen.
Die Erfahrungen älterer Mitarbeiter in Bezug auf Anlagen, Prozesse, wechselnde Organisationsstrukturen und Kunden sind von großer Bedeutung für jedes Unternehmen. Dieses Wissen auf die jüngeren Mitarbeiter zu übertragen ist eine der Herausforderungen. Dabei ist entscheidend, nicht flächendeckend, nach dem Motto: „Je mehr, desto besser“ mit der Gießkanne Mitarbeiter zu qualifizieren. Die Qualifizierung muss bedarfsgerecht geschehen. Das setzt voraus, dass dem Unternehmen klar ist, in welchen Bereichen welches Wissen weitergegeben werden muss. In Anbetracht dessen, dass mit dem Alter auch ein Leistungswandel stattfindet und die körperliche Leistungsfähigkeit nachlässt, ist das Erstellen von Schulungsmaterialien und das bedarfsgerechte Qualifizieren durch ältere Mitarbeiter zum Beispiel eine Möglichkeit. So kann das Unternehmen den Mitarbeiter mit maximalem Nutzen für das Unternehmen selbst und dem individuellen Leistungswandel des Mitarbeiters entsprechend einsetzen.
Andererseits sind jüngere Mitarbeiter mit der Nutzung und dem selbständigen Aneignen von Wissen zur Nutzung von moderner Technik häufig gewandter. Im Rahmen eines intelligenten Wissenstransfers ist zum Beispiel auch bedarfsgerechte Qualifizierung von Jung zu Alt im Bereich von IT und Technologie, mit vorhanden innerbetrieblichen Ressourcen, eine weitere Möglichkeit. Ein Wissenstransfer in beide Richtungen, jung und alt, kann unter Berücksichtigung der Lebensumstände und Lebensphasen, sowie des Bedarfs im Unternehmen nicht nur Kosten einsparen, sondern auch Wissen im Unternehmen halten und die sozialen Verbindungen im Unternehmen stärken.
Wie schon erwähnt ist eine innovative Berücksichtigung der Lebensphasen der Mitarbeiter im Bereich des intelligenten Wissenstransfers eine Möglichkeit, den Arbeitsplatz des Mitarbeiters zu Gunsten seiner Bedürfnisse bzw. Anforderungen im Alter, zu verändern. Ein weiterer Aspekt ist die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes. Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehören zum Beispiel wiederkehrende Bewegungen, ungünstige Körperpositionen und/oder Schadstoffe. Arbeitsplätze, die den Ansprüchen der Mitarbeiter genügen - und dabei spielt der Faktor gewerblich oder angestellt keine Rolle - vermeiden mittel- und langfristig krankheitsbedingte Ausfälle und sorgen so nicht nur für eine Steigerung der Produktivität, sondern auch für eine Steigerung der Motivation. Neben der Ergonomie ist die Mängelfreiheit des Arbeitsplatzes wichtig für reibungsfrei Prozesse und Abläufe. Mängel sind Abweichungen vom Sollzustand der Anlage, des Arbeitsplatzes oder des Arbeitsumfelds. Diese Abweichungen führen, das sagt die Erfahrung, früher oder später zu Verlusten (Anlagenausfälle oder Gefährdungspotenziale sind nur zwei Beispiele). Um eine Mängelfreiheit zu gewährleisten, ist es notwendig ein System zu schaffen in dem der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, gefundene Mängel anzuzeigen. Werden diese angezeigten Mängel zeitnah durch das Unternehmen beseitigt, motiviert dies wiederum dazu, neue Mängel anzuzeigen. Das frühzeitige Beachten und Beseitigen von Mängeln führt schließlich zu stabilen Arbeits- und Produktionsprozessen.
Zur Berücksichtigung der Lebensphasen gehört auch eine zeitliche Flexibilität: Arztbesuche können zum Teil nur zu bestimmten Uhrzeiten stattfinden, Kindergarten und Ämter haben ebenfalls vorgegebene Öffnungszeiten. Für eine ganzheitliche Motivation des Mitarbeiters und vollständige Einbindung in das Unternehmen ist es notwendig, innovative Arbeitszeitmodelle zu entwerfen, die eine Flexibilität für den Mitarbeiter gewährleisten, sein Privat und Arbeitsleben miteinander zu verbinden bzw. zeitsparend zu verknüpfen. Dabei ist Flexibilität nicht nur als Vorteil für den Mitarbeiter zu sehen. Die Systeme sollen auch dem Unternehmen Freiräume einräumen, um auf Marktlagen schnell und flexibel reagieren zu können. Zum Beispiel durch Sonderschichten bei erhöhter Nachfrage oder kurzfristiger Ausfall einer Schicht bei reduzierter Nachfrage. Zudem bieten Zeitkonten und bereichsübergreifend ausgebildete Mitarbeiter mit „Springer-Funktion“ weitere Möglichkeiten für unternehmerische und private Flexibilität.
Um die Potenziale der Arbeitsplatzgestaltung und die des intelligenten Wissenstransfers für den Mitarbeiter und das Unternehmen ausschöpfen zu können, muss eine schlanke Organisation, das dritte Handlungsfeld, geschaffen werden. Das bedeutet genauer, die durch Altersteilzeit aus dem Unternehmen ausscheidende Mitarbeiter als Chance für eine schlankere Organisation zu nutzen, jedoch ohne dabei Mehrarbeit auf die anderen Mitarbeiter zu verlagern. Ziel muss es sein, eine schlanke Organisation zu schaffen, die das demografische Profil der Gesellschaft abbildet und Freiräume für Schulungen und Flexibilität bietet. Wie Eingangs erwähnt, altert und schrumpft unsere Gesellschaft. Dementsprechend werden qualifizierte Arbeitskräfte künftig nicht mehr in der gewohnten Anzahl zur Verfügung stehen. Das Schaffen einer schlanken Organisations ist demnach keineswegs als Jobabbau zu verstehen. Vielmehr ist die schlanke Organisationsstruktur als Anpassung an die demografische Struktur, und natürlich als Wettbewerbsvorteil auf den nationalen und internationalen Märkten, zu sehen.
Wie können die Handlungsfelder ganzheitlich umgesetzt werden?
Ein Konzept zur Ganzheitlichen Optimierung, das alle Mitarbeiter mit einbezieht und die internen und externen Herausforderungen, Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt, ist notwendig. Das Konzept sollte dabei in zwei Phasen unterteilt werden. Die strategische Ausrichtung ist die erste Phase, die operative Umsetzung die zweite Phase.
Für eine strategische Ausrichtung muss eine Zukunftsbild des Unternehmens erarbeitet und erstellt werden. Diese berücksichtigt die allgemeinen internen und externen Herausforderungen des Unternehmens und beschreibt langfristige Ziele. Darauf aufbauend muss ein Kennzahlensystem geschaffen werden, das die beschriebenen Ausprägungen des Zukunftsbildes misst. Die dafür benötigten Kennzahlen sind entweder im Unternehmen vorhanden oder müssen vorab eingeführt werden. Basierend auf den Kennzahlen werden jährliche Ziele innerhalb des Betriebs vereinbart. Um diese zu erreichen, definieren die jeweilig Verantwortlichen darauf ausgerichtete Maßnahmen, die dann stückweise in kleinen Schritten umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise Prozessablaufoptimierungen, Technologieoptimierungen, Störzeitenreduktion, Prozessgeschwindig-keitssteigerungen, Rüstzeit-Reduktionen, Ausschussreduktion, Reklamationsreduktion, Schulungen und Weiteres, je nach Maßnahmendefinition.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Unternehmen formuliert in seinem Zukunftsbild, der günstigste Anbieter am Markt zu sein und zudem anstehende Altersteilzeitkräfte durch schlanke Prozesse nicht zu ersetzen. Um diesen Anspruch gerecht zu werden, werden Kennzahlen benötigt, mit deren Hilfe der Anspruch intern gemessen und verfolgt werden kann. In diesem Beispiel könnten zwei der zu betrachtenden Größen die Anlageneffektivität und Produktivität sein. Entsprechend dieser Kennzahlen vereinbart man daraufhin Ziele, zum Beispiel Steigerung der Anlageneffektivität um 10% und Steigerung der Produktivität um 3%, was im Beispiel zwei Vollzeitkräften entspricht. Durch die Steigerungen der Anlagenverfügbarkeit könnte das Unternehmen in kürzerer Zeit seine Produkte herstellen und damit seinem Zukunftsbild einen Schritt näher kommen. Durch die Steigerung der Produktivität hat das Unternehmen die Möglichkeit die Altersteilzeitkräfte nicht neu zu besetzen ohne dabei die Arbeit als Mehraufwand auf andere Mitarbeiter zu übertragen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen nun Maßnahmen definiert werden. Diese könnten die Reduktion der ungeplanten Anlagenstillstände und eine ergonomische Mehrmaschinenbedienung sein.
An dieser Stelle findet der Wechsel vom strategischen in den operativen Bereich statt. Es folgt das Umsetzen der Maßnahmen durch innerbetriebliche, interdisziplinäre Teams und das Kontrollieren der Kennzahlen, um die Maßnahmenwirksamkeit zu prüfen.
Alle drei Bausteine: intelligenter Wissenstransfer, Arbeitsplatzgestaltung und das Verschlanken der Organisation in einem Programm zur Ganzheitlichen Optimierung, mindern die Risiken, die auf das Unternehmen durch die Krise und den demografischen Wandel wirken und bieten Chancen. Am Ende eines Programms zur Ganzheitlichen Optimierung stehen Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Arbeitsplätze entsprechend der persönlichen Lebensphase, Kostenersparnisse für das Unternehmen, eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und somit motivierte Mitarbeiter mit zukunftssicheren Jobs.