(openPR) Der Onlineshop telefon.de aus Osnabrück zeigt seit dem 22. April der ganzen Welt, was im Onlineshop der Osnabrücker Firma aktuell an Produkten aus den Rubriken „Handys“ und „Telefone“ verkauft wird. Auf einer Deutschlandkarte (telefon.de/maps), werden dabei die Verkäufe der Herkunftsregion zugeordnet, so dass man mehr oder weniger live miterleben kann, wenn ein Nokia-Handy nach Dresden verkauft wird oder ein Hot-Lips Fun-Telefon nach Düsseldorf geliefert wird.
Mit Hilfe dieser Shopping-Map können sich die Kunden inspirieren lassen von den Käufen anderer Kunden. Erfolgt ein Verkauf, poppt bei der Stadt, aus der der Verkauf erfolgt ist, dass entsprechende Produktbild auf. Wollte der Betrachter der Shopping-Map es einem Käufer gleichtun, genügt ein einfacher Klick auf das Produktbild. Dieser Klick führt den Käufer direkt in den Shop von telefon.de.
„Wir haben uns dieses unterhaltsame Feature ausgedacht, um den Kunden etwas vom Shopping-Feeling aus den Einkaufsmeilen bzw. dem klassischen Facheinzelhandels zu vermitteln. Auch da lässt man sich ja durchaus von den Käufen anderer Kunden inspirieren“, weiß Klaus-Martin Meyer von telefon.de zu berichten. Nach Angaben der Osnabrücker Firma wurde die Shopping-Map bereits am ersten Tag von den Kunden begeistert aufgenommen.
Viele tausend Surfer sahen sich die Seite an. „Wir haben viele positive Zuschriften erhalten, teilweise mit Glückwünschen für die gute Idee“, zeigte sich Meyer erfreut. Nach Angaben des Leiters Online-Marketings von telefon.de wollen bereits einige Kunden regionale Vorlieben für bestimmte Handymodelle erkannt haben. So scheinen die Norddeutschen besonders gerne Mobiltelefone mit Blumenmotiven zu mögen, während im Raum Düsseldorf viele Smartphones der Marke Blackberry nachgefragt werden.
Das Team von Telefon.de warnt übrigens vor einer möglichen Suchtgefahr der Shopping-Map. Das ganze Team von telefon.de saß gestern angeblich vor der Shopping-Map. Ein Mitarbeiter, der nicht genannt werden wollte, gab an, „mehrere Stunden von der Arbeit abgehalten worden zu sein“, weil er durch die verkauften Produkte, die auf seinen Bildschirm sprangen, quasi „hypnotisiert“ worden war.
Presseinformation
Telefon.de zeigt auf Deutschlandkarte was wohin verkauft wird


Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:Kontakt:
Telefon.de Handels AG
Klaus-Martin Meyer (Online-Marketing)
Telefon.de Handels AG
Albert-Brickwedde-Str. 2
49084 Osnabrück
Tel.: 0541/6006666
Fax: 0541/6006667
E-Mail: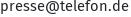
Internet: www.telefon.de
Telefon.de Handels AG
Klaus-Martin Meyer (Online-Marketing)
Telefon.de Handels AG
Albert-Brickwedde-Str. 2
49084 Osnabrück
Tel.: 0541/6006666
Fax: 0541/6006667
E-Mail:
Internet: www.telefon.de
Über das Unternehmen
Über telefon.de
1996 als Einzelunternehmern von Jan Klöker gegründet. 1998 wurde der erste eigen entwickelte Internetshop online gestellt. 2001 erfolgte die Gründung der Telefon.de Handels AG. Im Jahre 2004 wurden erstmalig über 500.000 Besucher im Monat registriert. Nach einem optischen Relaunch des Online-Shops im Jahr 2006 wurde mit www.telefon.at auch eine erste internationale Dependance eröffnet
1996 als Einzelunternehmern von Jan Klöker gegründet. 1998 wurde der erste eigen entwickelte Internetshop online gestellt. 2001 erfolgte die Gründung der Telefon.de Handels AG. Im Jahre 2004 wurden erstmalig über 500.000 Besucher im Monat registriert. Nach einem optischen Relaunch des Online-Shops im Jahr 2006 wurde mit www.telefon.at auch eine erste internationale Dependance eröffnet
Pressebericht „Telefon.de zeigt auf Deutschlandkarte was wohin verkauft wird“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von Telefon.de Handels AG


telefon.de kürt Gigalocal zur „App der Woche“
Osnabrück, 05. September 2011 – Deutschland ist im Gigalocal-Fieber. Die neue App des jungen Startups vermittelt Micro-Jobs zunächst in Berlin und Hamburg. Dabei listet die kostenlose Applikation, die vom Onlinehändler telefon.de zur „App der Woche“ gekürt wurde, ortsbezogene Mini-Dienstleistungen auf. Damit wird künftig das Smartphone zu einem Jobcenter. Privatpersonen können dabei Jobs anbieten und nachfragen. Wer z.B. gerade keine Zeit oder Lust hat, einen Kasten Bier einzukaufen, kann den Einkauf auf Gigalocal ausschreiben und das Honorar…


Der Onlinehändler telefon.de gewinnt den Shop Usability Award 2011 in der Kategorie „Handy & Mobile“
Osnabrück, 20. April 2011 – Der in Osnabrück ansässige Onlineshop telefon.de ist im Rahmen der Internet World Messe in München mit dem Shop Usability Award 2011 in der Kategorie „Handy & Mobile“ ausgezeichnet worden. Die Fachjury – zu der unter anderem Ulrich Hafenbradl, Geschäftsführer der Trusted Shops GmbH, Dominik Grollmann von der Zeitschrift Internet World Business, Christian Riedel von CHIP.de sowie Stefan Lein von Google Germany gehören – lobte die Benutzerfreundlichkeit des Internethändlers: „telefon.de zeigt, dass ein Telekommunikat…
Das könnte Sie auch interessieren:

Telefon.de sucht Webmaster mit Fußballfan-Seiten
Nachdem das Affiliate-Team von telefon.de kürzlich via Affiliatepr.de erfolgreich führende Geschenke-Websites für sein Partnerprogramm gewinnen konnte, richtet sich die Zielgruppen orientierte Suche nach geeigneten Partnerschaften nun auf Internetauftritte mit Fußball afinem Traffic.
Viele Fanseiten bewerben auf der einen Seite noch gar nicht oder nur …

telefon.de: Neue Handy-Bundles und vybemobile Verträge
Noch rechtzeitig vor Weihnachten hat telefon.de das Sortiment an Bundle-Angeboten bestehend aus Handy mit Vertrag und attraktiven Zugaben kräftig ausgebaut. Dabei legt telefon.de sehr viel Wert auf qualitativ hochwertige und stark nachgefragte Zugaben, wie z.B. Navigationssysteme von TomTom, Spielkonsolen wie die Nintendo Wii oder die Nintendo DS lite. …

Telefon.de vertraut auf Commission Junction
Unterhaching/München, 25. April 2007 - Einen neuen Advertiser begrüßt Affiliate-Marketing-Profi Commission Junction: Zum17. April startete der Online-Shop Telefon.de ein Partnerprogramm bei CJ.
Telefon.de, mit eigenen Shops in Deutschland und in Österreich vertreten, offeriert als einer der wenigen Online-Shops für Telekommunikationsprodukte die komplette …

Telefon.de empfiehlt zeitnahen Ersatz alter CT1 -Telefone
… die mit empfindlichen Strafen belegt wird, ist der Ersatz der einschlägigen Telefone dringend empfohlen. Heute stehen hierfür zahlreiche strahlungsarme Dect-Telefone zur Verfügung.
Die Telefon.de Handels AG empfiehlt den zeitnahen Umstieg und warnt in ihrem Blog vor möglichen Engpässen bei DECT-Endgeräten zum Jahresende. Auch sind steigende Preise zum …


Telefon.de veranstaltet Affiliate-Wettbewerb zum Thema „Monetarisierung von Blogs mit Partnerprogrammen
… „Montetarisierung von Blogs über Partnerprogramme“ einer breiten Front an Bloggern bekannt zu machen und um innovative Lehrbuchbeispiele mit Nachahmungscharakter zu honorieren, veranstaltet telefon.de (Telefone, Handy & Zubehör) jetzt einen Wettbewerb für Blogger.
Diese sind aufgerufen, sich auf eine besonders originelle Weise mit dem Thema „Monetarisierung …


Telefon.de startet eigenes Blog
Die Telefon.de Handels AG aus Osnabrück startete am 6. März 2007 ins Bloggingzeitalter. Die Firma betreibt seit dem Jahr 2001 unter der Domain Telefon.de sehr erfolgreich einen Online-Shop für alles Rund um das Thema Telefonie und Telekommunikation. Das Sortiment fängt an bei A wie Anrufbeantworter und endet bei V für Voice over IP. Die Kunden können …


Ministerpräsident Christian Wulff besucht telefon.de
Der amtierende niedersächsische Ministerpräsident Wulff besuchte mit der Jungen Union Osnabrück am Freitag, den 24. August 2007 die Firma telefon.de Handels AG in Osnabrück.
Die telefon.de Handels AG ist eine innovative eCommerce-Firma in der Hansestadt Osnabrück, die im Internet unter der Adresse www.telefon.de erfolgreich mit Produkten aus dem Bereich …


Telefon.de wertet Bereich „Coole Apps“ auf
Im Januar startete telefon.de im hauseigenen Blog den Bereich „Coole Apps“. In dieser Rubrik für iPhone-, Android-, Nokia-, Blackberry- und Palm-Apps haben App-Entwickler die Möglichkeit, ihre Programme mit einer eigens erstellten, persönlichen Vorstellung zu präsentieren. Damit bietet telefon.de den Programmierern eine der wenigen Möglichkeiten außerhalb …

Affiliates mit Geschenkeportalen und Seniorenseiten haben bei telefon.de beste Verdienstaussichten
Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Das gilt nicht nur für die Generation der Senioren. Telefon.de sucht Webmaster, die sich dezidiert mit den Themengebieten Geschenke und der Damen- und Herrenwelt oberhalb von 50 Lebensjahren befassen. Was haben beide Themengebiete gemeinsam? Die Antwort liegt nicht gleich auf der Hand, überrascht aber auch nicht.
Im …

Telefon.de sucht die besten Affiliates Deutschlands
Die telefon.de Handels AG sucht für ihre Partnerprogramme Deutschlands beste Affiliates.
Telefon.de offeriert als einer der wenigen Online-Shops für Telekommunikationsprodukte die komplette Palette an Festnetz-, VoIP-, Handy- und Zubehörprodukten. Im Zubehörbereich setzt Telefon.de Maßstäbe, was Qualität und Umfang angeht. Selbst in den Teilsegmenten …
Sie lesen gerade: Telefon.de zeigt auf Deutschlandkarte was wohin verkauft wird