(openPR) Psychotherapeutische Gespräche zwischen Arzt und Patient, Entspannungsübungen und Bewegung sind bei Patienten mit so genannten funktionellen Störungen oder psychosomatischen Beschwerden, deren körperliche Ursache unklar ist, oftmals wirksamer als Spritzen oder Operationen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der Universität Tübingen aufgrund einer Auswertung internationaler wissenschaftlicher Übersichtsarbeiten zu funktionellen Störungen.
Funktionelle Störungen sind in der hausärztlichen Praxis überaus häufig. "Rund 30 Prozent aller Patienten beim Hausarzt leiden an diesen Erkrankungen ", erklärte Professor Dr. Wolfgang Herzog, Ärztlicher Direktor der Heidelberger Universitätsklinik für Allgemeine Klinische und Psychosomatische Medizin. Das Spektrum der Beschwerden ist breit, und häufig sind die Erkrankungen nicht klar voneinander abgrenzbar. Daher plädieren die Forscher auch dafür, den typischen Scheuklappenblick, mit dem z.B. der Rheumatologe nur auf die Muskel- und Gelenkschmerzen, der Orthopäde auf den Rücken und der Gastroenterologe nur auf die Verdauungsprobleme achtet, aufzugeben und umfassender zu erheben, unter welchen körperlichen und seelischen Beschwerden die Patienten insgesamt leiden. Nicht jeder, aber viele Patienten haben Beschwerden aus mehreren Bereichen, die leicht übersehen werden.
Da eindeutige körperliche Befunde fehlen, haben die Patienten oft eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich, bevor die Funktionelle Störung erkannt wird. Die drei häufigsten Erkrankungen dieser Art sind der Reizdarm, das chronische Müdigkeits-Syndrom und die Fibromyalgie, eine Erkrankung mit chronischen Schmerzen in Muskel- und Bindegewebe. Genetische Ursachen spielen bei Funktionellen Erkrankungen nur eine geringe Rolle, vielmehr sind traumatische Erfahrungen in der frühen Kindheit, aber auch belastende Ereignisse im späteren Leben wie körperliche Krankheiten, Unfälle oder Verluste der Auslöser. Soziale und kulturelle Einflüsse sind ebenfalls bedeutsam: So neigen deutsche Patienten im Vergleich zu englischen doppelt so häufig zu psychosomatisch bedingten Rückenschmerzen.
Weitere Informationen zur Studie:
http://www.forum-gesundheitspolitik.de/dossier/index114.htm
Presseinformation
Arzt-Patient-Kommunikation ist bei funktionellen Störungen wirksamer als Spritzen


Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:Über das Unternehmen
FORUM GESUNDHEITSPOLITIK ist eine private Initiative, die von gesundheitspolitisch engagierten Wissenschaftlern getragen wird. Zielsetzung ist eine fundiertere Information der Öffentlichkeit und insbesondere von Wissenschaftlern und Journalisten, Studenten/innen und politischen Entscheidungsträgern über gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, gesetzliche Veränderungen in diesem Bereich sowie Ansprüche der Bevölkerung an das Gesundheitssystem. Die Website verfolgt keinerlei kommerzielle Interessen.
Pressebericht „Arzt-Patient-Kommunikation ist bei funktionellen Störungen wirksamer als Spritzen“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von Forum Gesundheitspolitik
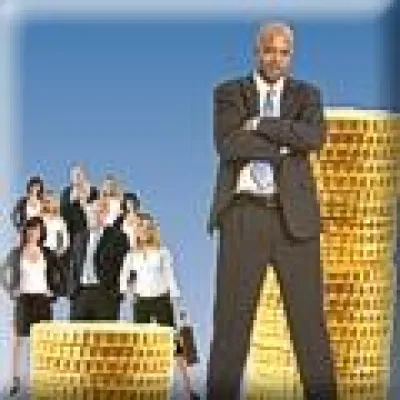
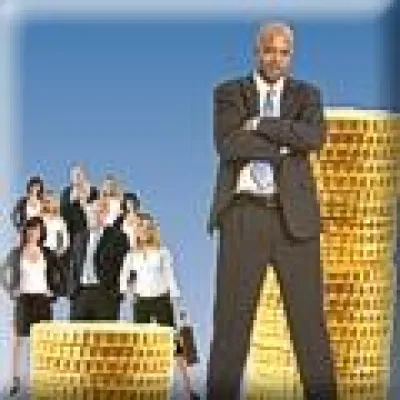
Hohe Einkommensunterschiede: Ursache auch sozialer, kultureller und gesundheitlicher Problemherde
Die Einkommensschere in Deutschland hat sich im internationalen Vergleich besonders weit auseinander entwickelt, die Einkommensunterschiede hierzulande sind so groß wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Auch die Zahl der Armen erreichte im Jahr 2005 einen Rekordwert. Ein Aufsatz englischer Wissenschaftler hat zu dem Thema "ökonomische Ungleichheit und daran geknüpfte soziale Probleme" nun eine Vielzahl neuerer Forschungsergebnisse vorgelegt. Es zeigt sich: Je größer die Einkommensunterschiede in einem Land sind, desto häufiger tauchen dort…
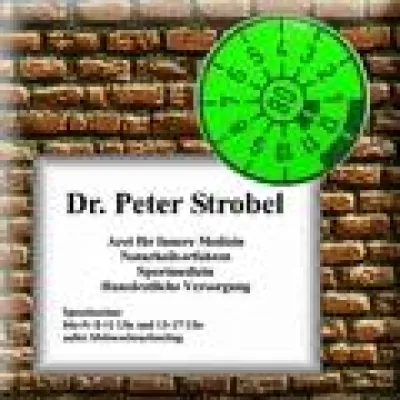
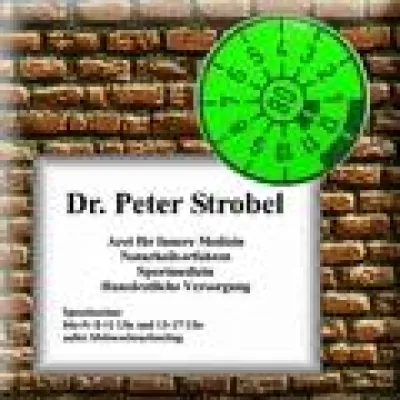
Mehrheit der Patienten wünscht sich ein Ärzte-TÜV und schriftliche Patienteninformationen vom Arzt
Eine Bremer Bevölkerungsumfrage mit rund 3.600 Teilnehmern hat jetzt gezeigt: Patienten sind heute in Gesundheitsfragen erheblich besser informiert als ihre Väter und Mütter. Aber sie sind auch kritischer und anspruchsvoller. Die ärztliche Diagnose reicht den meisten nicht aus: Zwei von drei Patienten (67%) bemühen sich vor oder nach einem Arztbesuch um zusätzliche Informationen, sei es zu den Krankheitsursachen, sei es zu Behandlungsmöglichkeiten. Über die Hälfte (56%) aller Patienten stellen anlässlich eines Arztbesuchs zumindest manchmal s…
Das könnte Sie auch interessieren:

Der sichere Weg zur gelungenen Schönheitsoperation
… Gesprächen zwischen Patient und Arzt geklärt – welche Fragen hierbei keinesfalls offen bleiben sollen, definieren die ModernBeauty-Checklisten.
Ganz gleich, ob es um Botox-Spritzen, Fettabsaugen, den größeren Busen, das glattere Gesicht, um schönere Zähne oder „Augen ohne Brille“, um Mann oder Frau geht: Ein ästhetisch-chirurgischer Eingriff erfolgt …

Dokumentation – leicht gemacht: Patientenkalender 2016
… wird in sieben Sprachen bescheinigt, dass sich der Patient regelmäßig mit Blutgerinnungs-konzentraten behandeln muss und daher neben dem Präparat auch Spritzen und Injektionsnadeln mit sich führt.
Sie können den Dokumentationskalender 2016 per E-Mail bestellen unter oder bei
Octapharma GmbH
Produktmanagement Hämophilie
Elisabeth-Selbert- Straße 11
40764 …

Neuer Dokumentationskalender 2009 für Hämophiliepatienten jetzt erhältlich
… Einschätzung der Therapie. Gleichzeitig wird die im Transfusionsgesetz geforderte Chargendokumentation unterstützt.
Ergänzt wird der Kalender durch eine mehrsprachige ärztliche Bescheinigung für Medikament und Spritzen. So hat der Patient diese Informationen auf Reisen bei der Kontrolle des Handgepäcks oder zur Vorlage beim Zoll stets zur Hand.
Sie können …

Nützlich – hilfreich – übersichtlich: Dokumentationskalender 2015
… wird durch die Dokumentation der Chargennummer die im Transfusionsgesetz geforderte Chargendokumentation unterstützt. Und falls eine Reise ansteht, kann die Notwendigkeit für Medikament, Spritzen und Injektionsnadeln von ärztlicher Seite direkt im Kalender bescheinigt werden. So hat der Patient diese Information bei der Kontrolle des Handgepäcks oder …

Funktionelle Störungen: Schmerzen ohne eindeutige körperliche Befunde umfassender erheben
Funktionelle Störungen sind häufig. "Rund 30 Prozent aller Patienten beim Hausarzt leiden an diesen Erkrankungen ", erklärt Professor Dr. Wolfgang Herzog, Ärztlicher Direktor der Heidelberger Universitätsklinik für Allgemeine Klinische und Psychosomatische Medizin.
Das Spektrum der Beschwerden ist breit, und häufig sind die Erkrankungen nicht klar voneinander …

Mediation im Medizinrecht – Patientenfürsprecher und andere außergerichtliche Hilfen für Patienten"
Die Veranstaltung „Mediation im Medizinrecht - Patientenfürsprecher und andere außergerichtliche Hilfen für Patienten“ bietet eine interdisziplinäre Darstellung der Erfahrungen dicht an der Praxis mit
Max-Alfred Schaudig, Oberarzt, Ev. Johannesstift Wichernkrankenhaus,
Michael Wardenga, Mediator und Patientenfürsprecher, Ev. Johannesstift Wichernkrankenhaus,
Rechtsanwalt Volker Loeschner, Fachanwalt für Medizinrecht.
Zwischen Arzt und Patient gibt es oft Streit. Manchmal geht es sogar um Fehler, die die Gesundheit verletzen.
Am besten ist…

Neuerscheinung des Buches "Arzt-Patienten-Kommunikation - Ein Patient und sein Chirurg im Zwiegespräch
Eine der wichtigsten Schnittstellen ist jene zwischen Arzt und Patient, insbesondere wenn der Arzt ein Chirurg ist.
Das Buch beschreibt anhand authentischer Erfahrungen die intensive Begegnung zwischen beiden Autoren.
Prof. Dr. med. Werner Hohenberger, einer der weltweit besten Viszeralchirurgen und ehem. Leiter mehrerer Universitätskliniken und Dr. Helmut Moldaschl, Kernphysiker und ehem. Leiter internationaler kerntechnischer Projekte
"Arzt-Patienten-Kommunikation - Ein Patient und sein Chirurg im Zwiegespräch"
Verlag Walter De Gruyter 24.0…

Arbeitsplätze: jährlich 5 bis 10 Prozent Zuwachs in der Wellness-Branche
… ihrem Insider-Buch "Unternehmen Wellness".
Sinnvolle Wellness-Angebote nützen nicht nur den betroffenen Einzelnen, sondern auch der gesamten Volkswirtschaft; denn "Störungen individueller Befindlichkeiten führen zwangsläufig zu Störungen betrieblicher und volkswirtschaftlicher Ordnungen.
Mobbing hat sich ausgebreitet und kostet allein in Deutschland …
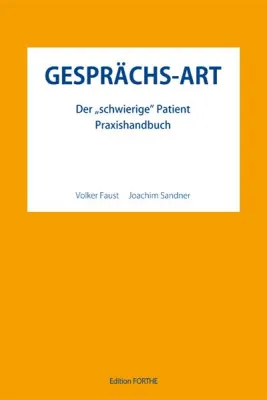
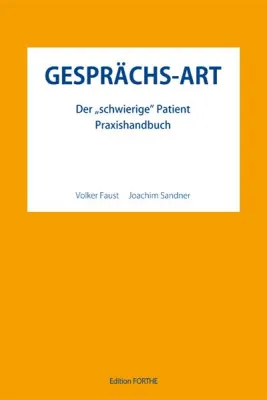
Neu. Gesprächs-Art, Praxishandbuch: Der "schwierige" Patient
… können.
Die kranke Seele hat Konjunktur. Entsprechende Berechnungen der Weltbank ergeben, daß im Jahre 2020 fünf seelische Störungsbilder (u.a. Depressionen, Angststörungen, somatoforme Störungen) unter den zehn wichtigsten Erkrankungen zu finden sind. Laut Bundesgesundheitsministerium stehen inzwischen über 40% der Krankschreibungen mit psychischen …

Konservative Orthopädie
… die jeweilige Stufe einordnen.
Akupunktur
Eine Behandlungsmethode der konservativen Orthopädie ist die Akupunktur, die Dr. Schank ebenfalls anbietet. Bei der Akupunktur werden Energiestörungen im Körper wieder normalisiert. Durch feine Nadeln werden die entsprechenden Organe angeregt, um so die außer Takt geratenen Energieströmungen wieder in Gleichgewicht …
Sie lesen gerade: Arzt-Patient-Kommunikation ist bei funktionellen Störungen wirksamer als Spritzen