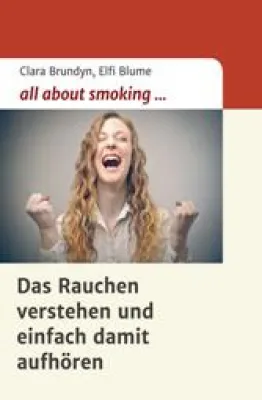(openPR) INGENIEURE SUCHEN NACH LÖSUNGEN, LKW KLIMAFREUNDLICHER ZU MACHEN. DIE EINEN ENTWICKELN E-LOKOMOTIVEN AUF RÄDERN, DIE ANDEREN SETZEN AUF WASSERSTOFF.
In Groß Dölln, nördlich von Berlin, hat der Siemens-Konzern eine Versuchsstrecke angelegt, die Technologien des Schienen- und des Straßenwesens vereinigen soll. Seit knapp zehn Jahren fahren hier Lastwagen, die ihre Energie wie E-Lokomotiven mit Stromabnehmern aus einem Draht über der Straße ziehen und damit einen Elektromotor antreiben.
Das Bundesumweltministerium unterstützt den Modellversuch "eHighway" (so der Arbeitstitel) mit mehr als 100 Millionen Euro, und der Bürger kann einen Teil der Anlagen, in die die Investitionen geflossen sind, inzwischen schon an ersten Autobahnstrecken besichtigen.
Im Moment gibt es in der öffentlichen Debatte dafür wenig Applaus angesichts der enormen Fördersummen mit ungewissem Ausgang. Der Bund der Steuerzahler hat den eHighway in sein jüngstes Schwarzbuch aufgenommen, das Bundesverkehrsministerium begegnet dem Konzept des Umweltressorts mit Skepsis, und die meisten Lkw-Hersteller haben dem Konzept sowieso eine klare Absage erteilen. Die Gegenargumente: zu teuer, zu unpraktisch und nicht europaweit durchsetzbar. Martin Daum, Lkw-Vorstand im Daimler-Konzern, spricht von einer „extrem teuren Sackgassenlösung“, und fügt hinzu: „Wir haben nicht viel Zeit.“
Ob Ausweg oder Irrweg - der eHighway soll helfen, ein ernstes Problem zu lösen. Auch in Hessen wurde zwischen Frankfurt und Darmstadt im Mai eine Erprobungsstrecke in Betrieb genommen, in Schleswig-Holstein bei Lübeck starten derzeit die Tests. Und in Baden-Württemberg soll eine elektrifizierte Bundesstraße folgen.
ZIELMARKE DEKARBONISIERUNG
Im Kanon der Klimaschutzanstrengungen ist 2050 die Zielmarke der Dekarbonisierung, das Ende der Verfeuerung fossiler Brennstoffe. Diesen Weg nicht einzuschlagen würde für die Lkw-Hersteller teuer. Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen schon Mitte des gerade angebrochenen Jahrzehnts für alle, die weitermachen wie bisher. Der politische Wunsch, mit Akkuantrieben in eine klimaneutrale Zukunft zu steuern, wird schon beim Pkw schwer zu erfüllen sein - beim Lkw im Fernverkehr ist es praktisch unmöglich. Sattelzüge mit 1000-Liter-Dieseltanks schaffen im heutigen Speditionsalltag bis zu 3000 Kilometer mit einer Füllung. Wie schlecht dagegen ein Batteriebrummi abschneidet, zeigen erste Experimente. So hat der niederländische Hersteller DAF als bisher einziger der etablierten Anbieter mit der Produktion einer Kleinserie elektrischer 40-Tonner begonnen. Der Akku der Zugmaschine wiegt dreieinhalb Tonnen - also etwa das Vierfache eines 1000-Liter-Dieseltanks. Die Reichweite des E-Riesen: etwa 100 Kilometer; „fern schnell gut“, das alte Logistikerversprechen, lässt sich damit nicht erfüllen.
Die gewaltige Akkumasse ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein aufwendiges Kühlsystem miteingerechnet ist, das die Zellpakete umgibt. Der Speditionsalltag bedeutet maximalen Stress für den Stromspeicher und ist nicht vergleichbar mit dem meist kommoden Nutzungsprofil beim Pkw. Unentwegt wird der Akku mit hoher Leistung ge- und entladen. DAF hat den E-Truck für eine Ladeleistung von 300 Kilowatt ausgelegt. Mit dieser elektrischen Druckbetankung lässt sich der Speicher in einer halben Stunde auf 80 Prozent seiner Kapazität füllen. Allerdings muss dafür sogar die Stromleitung gekühlt werden. All das funktioniere recht zuverlässig, erklärt DAF-Produktmanager Tim Plasberg, allerdings nur im Kurzstreckenbetrieb: „Im Moment ist nicht absehbar, dass die Batteriekapazitäten auch Fernverkehr ausreichen könnten.“
Doch genau hier spielt sich der Lkw-Betrieb in der Hauptsache ab: Gut die Hälfte aller Lkw-Emissionen in Deutschland stammen von Fahrzeugen mit mehr als 26 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, die vorwiegend im Fernverkehr zum Einsatz kommen. Zwei Fünftel aller Klimagasemissionen durch den Straßenverkehr kommen laut einer ICCT-Untersuchung inzwischen aus Lkw-Auspuffrohren. Und bis 2050, schätzen Verkehrswissenschaftler, dürfte sich das Truck-Aufkommen noch einmal verdoppeln. Der Lastwagen mit konventionellem Antrieb könnte dann der größte Klimaschädling des Transportwesens werden.
Wir von der HDS International Group verfolgen mit Spannung alle Trends und Entwicklungen in der Logistik – und beraten Sie gern bei der Kostenoptimierung und Planung Ihrer Transporte.
Weitere Artikel auf unserem Blog: http://www.hds-international.group/blog/