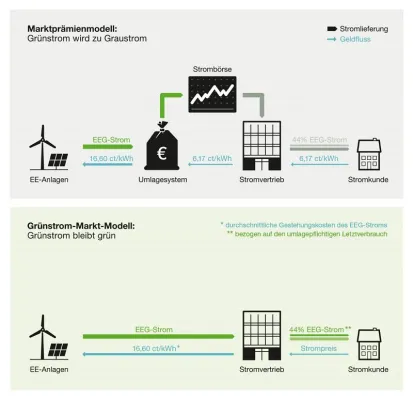(openPR) Hamburg, 17.6.2014
Die Bundesregierung treibt die Reform des EEG voran. Dabei werden unter anderem die neuen, technologiespezifischen jährlichen Zubauraten kritisch bewertet und als „Ausbremsen“ der Energiewende bezeichnet. Das arrhenius Institut hat einen neuen methodischen Ansatz konzeptioniert, mit dem die Zubauraten mit Blick auf die im EEG-Entwurf präzisierten Ausbauziele analysiert werden können. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die aktuellen Zubauraten, wie sie von der Bundesregierung anvisiert werden, bis auf weiteres ausreichen, um die gesteckten langfristiger Ziele zu erreichen.
Laut EEG-Reformvorschlag soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuer¬baren Energien bis 2050 auf mindestens 80% wachsen. Als Zwischenziele werden Anteile von 40-45% in 2025 und 50-55% in 2025 angestrebt. Für die einzelnen Techno-logien werden jährliche Zubauraten definiert. Maßgeblich über den Zeitraum bis 2050 ist allerdings nicht nur die Zubaurate selbst, sondern im Zeitverlauf auch die „Sterbe¬rate“ von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Zunehmend werden – wie auch bei konventionellen Kraftwerken – mehr und mehr dieser Anla¬gen an das Ende ihrer Lebensdauer kommen. Auf Basis der gängigen Lebensdauern von 20 bis max. 30 Jahren wird von heute bis zum Jahr 2050, also über einen Zeitraum von mehr als 35 Jahren, noch einmal der gesamte Anlagenbestand ersetzt werden müssen. Ferner lässt sich zeigen, dass – bei einer Lebensdauer einer Technologie von 20 Jahren – allein die Zubaurate ab 2030 darüber entscheidet, ob das Ziel für das Jahr 2050 erreicht wird.
Durch einen „idealen“ Zubau (definiert als im Zieljahr zu erreichende installierte Leistung geteilt durch die Lebensdauer der Anlagen) lassen sich sowohl überhöhte Gesamtkapazitäten als auch Zyklen bei den jährlichen Zubauraten vermeiden. Beides hilft, möglichst konstante Rah¬men¬bedingungen für die Investoren zu schaffen und die Kosten für die Verbraucher zu begrenzen.
Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die jüngst vorgeschlagenen Zu¬bau-raten bis auf weiteres ausreichen, um die gesteckten langfristigen Ziele zu erreichen. Dies gilt allerdings nur, wenn vorausgesetzt wird, dass der Strom¬ver-brauch nahezu konstant bleibt.
Wenn dagegen, wie für den Klimaschutz vielfach gefordert, deutlich mehr elektrische Energie in den Bereichen „Wärmeversorgung“ und „Verkehr“ eingesetzt werden soll und sich der Stromverbrauch damit deutlich erhöht, dann muss der Zubau von Erzeugungskapazitäten spätestens ab 2030 deutlich erhöht werden. Es muss daher noch präzisiert werden, welcher Stromverbrauch die Grundlage für das 80%-Ziel sein soll.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die jetzt definierten Zubauraten für die nächsten 10 Jahre ausreichen und erst dann überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden müssen.