(openPR) Über zwei Monate verschobene Bilanzsitzung am 20.02.2013 in Berlin
Berlin/Deutschland - Nachdem vor fast 3 Jahren unzählige sexuelle Übergriffe an Schutzbefohlenen in
staatlichen sowie kirchlichen Institutionen bekannt wurden, begann im März 2010 die Arbeit des Runden Tisches zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen.
Anlässlich der Überprüfung, welche der Empfehlungen aus dem am 30.11.2011 veröffentlichten Abschlussbericht des Runden Tischs umgesetzt werden konnten, wurde bereits für den 12.12.2012 ein Bilanztreffen terminiert. Allerdings konnte dieses infolge der zu dem Zeitpunkt dominierend geführten Diskussion über die religiös motivierte Beschneidung bei Jungen und der Abwesenheit der verantwortlichen politischen Vertreter nicht stattfinden. Sowohl der Schutz von Kindern und Jugendlichen, als auch die Lebenssituation erwachsener Betroffener sollten verbessert werden, so geht es aus den Empfehlungen des Abschlussberichts hervor. Um die Frage zu beantworten, was sich seit der Abschlusssitzung des Runden Tischs vor über einem Jahr tatsächlich verändert hat, treffen sich die Verantwortlichen am 20.02.2013 in Berlin.
Positiv
Durchaus positiv zu bemerken sind die Einführung des erweiterten Führungszeugnisses für Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die Kampagnen zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit und das Investieren in die Forschung sowie das Fortführen der Arbeit von Dr. Christine Bergmann durch den neuen Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig.
Ergänzendes Hilfesystem
An den Folgen des sexuellen Missbrauchs tragen die Betroffenen oft ein Leben lang. Neben psychischen Erkrankungen kann es zu Lebenskrisen unterschiedlicher Art kommen. Körperliche Langzeitfolgen führen nicht selten zu langjähriger Arbeitsunfähigkeit oder Frühverrentung. Mit dem Ziel diese Folgen zu mildern, wurde im Abschlussbericht des Runden Tisches die Schaffung eines ergänzenden Hilfesystems zugunsten der Opfer auch familiärer sexueller Gewalt beschlossen.
Demnach sollten für Betroffene Sachleistungen finanziert werden, die derzeit von den sozialen Hilfesystemen nicht oder nicht ausreichend lang übernommen werden: Therapiestunden über den von den Krankenkassen getragenen Umfang hinaus, Fahrkarten zu Treffen von Selbsthilfeorganisationen oder Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßmahmen. Dafür stellte die Bundesregierung 50 Millionen Euro zur Verfügung, weitere 50 Millionen sollten von den
Bundesländern bereit gestellt werden.
Obwohl die Länder bereit wären, Ihrer Verantwortung gegenüber Betroffenen aus staatlichen
Erziehungsinstitutionen gerecht zu werden, wurden bei der Jugend- und Familienministerkonferenz im vergangenen März hinsichtlich der Einbeziehung derer, die im familiären Kontext missbraucht worden sind, Vorbehalte deutlich gemacht. So lehnen einige der Länder bis zum jetzigen Zeitpunkt die Umsetzung dieser Empfehlung ab, infolge dessen Betroffene nicht die Hilfe erhalten, die sie dringend benötigen. Stattdessen sollten jene Betroffene eindeutige Rechtsansprüche auf bedarfsgerechte Hilfen im Regelsystem erhalten.
Das Argument, für die Umsetzung dieser Empfehlungen fehle es an einer Finanzierungsgrundlage, kann in diesem Fall nicht entsprochen werden, betrachtet man beispielsweise die Trauma-Folgekosten-Studie aus dem Jahr 2009. Demzufolge nehmen die Kosten der Versicherungsgesellschaften zur Behandlung der Langzeitfolgen von Betroffenen sexuellen Missbrauchs ein erhebliches Ausmaß an: Jährlich muss von einem Betrag zwischen 500 Millionen und 3 Milliarden Euro ausgegangen werden. Der für das ergänzende Hilfesystem geforderte Betrag von 50 Millionen Euro ist nicht einmal annähernd so hoch, als dass ernsthaft von einer fehlenden Finanzierungsgrundlage gesprochen werden könnte.
Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs
Wir befürworten und bestätigen den Beschluss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Bundesregierung vom 28. März 2012 und teilen die Auffassung einer gemeinsamen
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Dieser Verantwortung könnten die politischen
Entscheidungsträger u.a. mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern
sexuellen Missbrauchs (StORMG) gerecht werden. Der Entwurf hierzu vom Juni 2011 sieht die Ausweitung der Möglichkeiten anwaltlichen Beistandes, den verstärkten Einsatz von Videoaufnahmen zur Vermeidung von Mehrfachvernehmungen sowie die Verlängerung der zivilrechtlichen Verjährungsfristen vor, liegt allerdings seit 20 Monaten im Rechtsausschuss. 20 Monate sind verstrichen, ohne dass es auch nur ansatzweise zur Verwirklichung kam. Das könnte, sollte er dort nicht in absehbarer Zeit auf die Tagesordnung gesetzt werden, aufgrund des Diskontinuität-Prinzips dazu führen, dass er völlig neu erarbeitet werden muss. Das würde erneut sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ohne dass sich etwas verändert.
Enttäuschend: Um die Bereitstellung der finanziellen Mittel für das ergänzende Hilfesystem zu umgehen, sprachen sich einige Länder für die Einführung eindeutiger Rechtsansprüche für Betroffene aus, um ihnen die Inanspruchnahme von Hilfen im Regelsystem zu ermöglichen. Doch wie sich am Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs unschwer erkennen lässt, ist eine Veränderung in diesem Bereich in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
Psychotherapeutische Versorgung
Für Betroffene kommt zusätzlich erschwerend hinzu, dass trotz gegenteiliger Aussagen des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) kein flächendeckendes Netz an kompetenter
psychotherapeutischer Versorgung zur Verfügung steht. Dies ist wohl nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass kein ausreichender Rahmen für das Aufgreifen der Thematik bei der aktuellen Ausbildungsordnung von Ärzten und Psychotherapeuten gegeben ist. Dementsprechend lang sind die Wartelisten der wenigen Fähigen, oder es fehlt die notwendige kassenärztliche Zulassung. Das wird uns leider von Suchenden immer wieder bestätigt, was die Notwendigkeit der Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tischs nur bestärkt.
Fazit
Besonders Schade: Die Verschiebung des Bilanztreffens auf den 20.02.2013 sollte den Ländern die
Möglichkeit eröffnen, sich im Vorfeld zusammen mit dem Bund an dem ergänzenden Hilfesystem zugunsten der Opfer sexuellen Missbrauchs insbesondere im familiären Bereich zu beteiligen. Diese Möglichkeit wurde offensichtlich nicht genutzt.
Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass nach 3 Jahren öffentlicher Diskussion in Bezug auf
institutioneller und familiärer sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche keine nachhaltige und
ausreichende Verbesserung der Situation der Betroffenen erreicht wurde. Die Betroffenen haben nach wie vor keine Möglichkeit auf eine angemessene Entschädigung erhalten und es wurden trotz gegenteiliger Aussagen keine Regelungen entwickelt, nach denen Entschädigung und Unterstützung zu erfolgen hätten.
Bisher konnte die deutsche Regierung ihrer Verantwortung gegenüber Betroffenen aus der Vergangenheit nicht gerecht werden.
Wir fordern die Verantwortlichen daher auf, noch vor Ende dieser Legislaturperiode eine Verbesserung der Situation der Betroffenen in Form entsprechender Gesetzesentwürfe auf den Weg zu bringen. Andernfalls wäre es beispielsweise für das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs zu spät.
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen müssen endlich vollständig anerkannt werden. Täter und
Institutionen, die vorsätzlich bzw. fahrlässig Missbrauchstaten befördert oder geduldet haben, müssen dafür juristisch und finanziell zur Verantwortung gezogen werden.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes-Wilhelm Rörig bewertete die politische
Umsetzung bei den Hilfen und beim Opferschutz trotz einzelner positiver Signale in einer Pressemitteilung vom 6.12.2012 insgesamt als nicht zufriedenstellend. Die höhere Sensibilität in der Gesellschaft hätte noch nicht dazu geführt, dass sich die Lage Betroffener sexualisierter Gewalt durch aktives Handeln von Bund, Ländern und Kommunen tatsächlich verbessert hat.
Weiter bestätigt Rörig, dass im vergangenen Jahr eindeutig zu wenig für die Missbrauchsopfer erreicht worden ist, das wäre knapp 3 Jahre nach Einrichtung des Runden Tischs für Betroffene bitter. Die Verzögerungen zu Lasten der Betroffenen infolge der Verschiebung des Bilanztreffens sind nach deren Empfinden zusätzlich als katastrophal einzustufen.
Obgleich die Sichtweise der Betroffenen als eine erste wichtige Arbeitsgrundlage für Politik und Gesellschaft angesehen wird und wiederholt darauf hinwiesen wurde, konnte bisher für keine der Empfehlungen aus dem Abschlussbericht ein fester Zeitpunkt für die Umsetzung terminiert werden.
Aus diesem Grund sind die Arbeitspapiere und der Abschlussbericht des Runden Tischs lediglich als ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation von Betroffenen zu betrachten. Der nächste Schritt muss die Umsetzung der Empfehlungen sein. Dafür allerdings bedarf es in erster Linie eines verbindlichen Zeitrahmens und des politischen Willens aller Parteien.
Presseinformation
Nach über einem Jahr Ende „Runder Tisch“: Nach wie vor keine Hilfe für Betroffene
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:Über das Unternehmen
gegen - missbrauch e.V. - bundesweit tätig, setzt sich gegen sexuellen Kindesmissbrauch ein. Wir wollen nicht nur eine Plattform für Betroffene bzw. Überlebende von sexuellem Kindesmissbrauch sein, sondern auch aktiv Hilfe leisten. Konkret versuchen wir, aufgrund unserer Erfahrungen aktive und schnelle Hilfe / Unterstützung u.a. in folgenden Bereichen zu leisten:
Probleme mit Krankenkassen
Kampf durch den Amtsdschungel
Vermittlung zu Hilfsangeboten vor Ort
Begleitung von Betroffenen vor Ort (z. B. Beratungsstellen, Ärzte, Polizei, Behörden etc.)
schnelle, individuelle, unkomplizierte Hilfe für Betroffene (z. B. Übernahme von Therapiekosten)
Darüber hinaus hat es sich der Verein u. a. zum Ziel gesetzt aufzuklären, Präventivarbeit zu leisten und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich aktiv gegen sexuellen Kindesmissbrauch zu engagieren.
Schon zu lange wird das Thema sexueller Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft tabuisiert.
Probleme mit Krankenkassen
Kampf durch den Amtsdschungel
Vermittlung zu Hilfsangeboten vor Ort
Begleitung von Betroffenen vor Ort (z. B. Beratungsstellen, Ärzte, Polizei, Behörden etc.)
schnelle, individuelle, unkomplizierte Hilfe für Betroffene (z. B. Übernahme von Therapiekosten)
Darüber hinaus hat es sich der Verein u. a. zum Ziel gesetzt aufzuklären, Präventivarbeit zu leisten und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich aktiv gegen sexuellen Kindesmissbrauch zu engagieren.
Schon zu lange wird das Thema sexueller Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft tabuisiert.
Pressebericht „Nach über einem Jahr Ende „Runder Tisch“: Nach wie vor keine Hilfe für Betroffene“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von gegen-missbrauch e.V.


gegen-missbrauch e.V.: Onlinepetition zur Erfassung eingestellter Verfahren ins erweiterte Führungszeugnis
Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: Nach §153a StPO eingestellte Verfahren gehören ins erweiterte Führungszeugnis!
Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird bislang nach deutschem Recht (§ 176 StGB) wie ein „Vergehen“ behandelt, da die Mindeststrafe hierfür bei einer Freiheitsstrafe unter einem Jahr liegt.
Abgesehen von der mangelnden Anerkennung des menschlichen Leids im Falle eines Kindesmissbrauchs bedeutet die Einstufung als Vergehen, dass Verfahren gegen eine Auflage eingestellt werden können und somit weder im Bundeszentralregiste…


Stellungnahme zum Koalitionsvertrag
Noch viel Luft nach oben
gegen-missbrauch e.V. nimmt GroKo Koalitionsvertrag unter die Lupe
„Wir hätten uns mehr Klarheit und Verbindlichkeit gewünscht“, so Ingo Fock, 1. Vorsitzender des Vereins gegen-missbrauch e. V., der sich für Betroffene sexualisierter Gewalt einsetzt. Der Verein hat den nun vorliegenden Koalitionsvertrag genau unter die Lupe genommen.
Sicher, es sind viele gute Ansätze vorhanden. Gefreut haben wir uns zum Beispiel über die verbindliche Aussage, dass die Kinderrechte nunmehr im Grundgesetz verankert werden.
Verbesse…
Das könnte Sie auch interessieren:

Auf in die nächste Runde
… BVMW Mittelrhein und Dr. Margot Klinkner, stv. Geschäftsführerin der ZFH haben sich fürs neue Jahr viel vorgenommen: So ist beispielsweise die Veranstaltungsreihe „Personaler Runder Tisch“ bereits fester Bestandteil des Programms für 2018. Der Runde Tisch bietet Personalern der Region Gelegenheit, sich über aktuelle Anforderungen im HR-Bereich auszutauschen. …


Ein Jahr nach Abschlussberichts des Runden Tischs: Bilanztreffen fällt aus
… Bundesbildungsministerin Annette Schavan und Bundesfamilienministerin Kristina Schröder nicht stattfinden, schließlich hatten sie die Leitung der Institution Runder Tisch inne, was für Betroffene einen Eklat darstellt, da ihre Forderungen offensichtlich nicht ernst genommen werden.
Kaum Veränderungen für Betroffene
Wirklich überraschend ist diese Entwicklung für Betroffene …
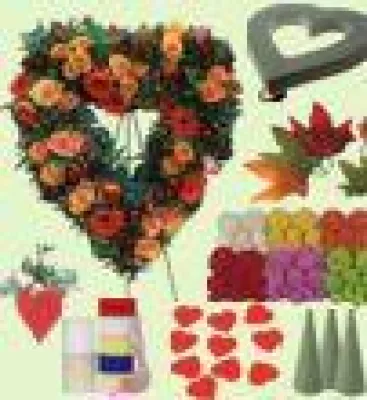
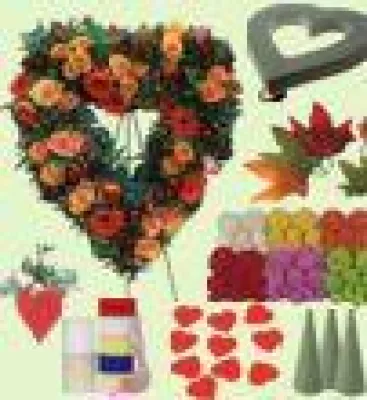
Hochzeitsdekoration und Tischdekoration selber machen - Deko und Blumendekoration der Hochzeit selbst basteln
… Glasvase oder eine Blumen-Girlande mittig auf dem Tisch zu empfehlen. Blüten , Blätter, Perlen sowie Deko-Herzen und Tauben können auf die Tische gestreut werden. Ob runder, ovaler, langer oder eckiger Tisch, für jede Tischform sind Gesteck-Unterlagen und Dekoschalen erhältlich. Das Blumengesteck oder Tischgesteck können Sie mit Hilfe der Tischschalen in …
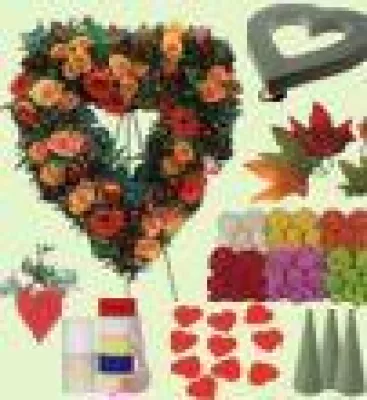
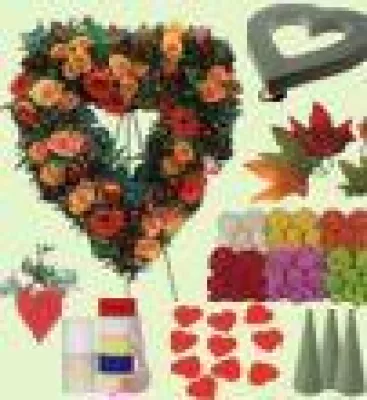
Hochzeitsdeko und Tischdeko für die Hochzeit selbst basteln - Blumengestecke für den Tisch selber gestalten
… Ring- oder Herz-Form an. Die Gesteckunterlagen für die Tischdeko haben einen wasserdichten Kunststoffboden, sowie Wasserspeicher und Gießrand.
Für den Brautstrauss finden Halter in runder, oder in Herz-Form Verwendung. Die Brautstrausshalter haben einen schwenkbaren Griff und können somit in die gewünschte Position gebracht werden. Die Blumen-Dekoration …

Berlin: Späte Entscheidungen, Kompliziertes Verfahren, Fazit - Runder Tisch Schulhelfer
… überhaupt, auch in diesem Jahr erst in den lletzten Tagen vor den Schulferien. Nach wie vor gibt es keine Planungssicherheit für Eltern und Schulen. Die Betroffenen gingen erneut voller Sorgen in die Sommerferien, da Schulhelferstunden abgelehnt oder stark reduziert wurden.
Das neue dezentrale Vorgehen verkompliziert das Verfahren deutlich. Die Verteilung des …


Der "Runde Tisch" - das Förderprogramm für Unternehmen in Schwierigkeiten
… Krisenmanagements. Nach erfolgter Zusage der KfW werden die Kosten hierfür vom Fördermittelgeber übernommen.
Durch die Unterstützung des Runden Tisches konnte schon vielen betroffenen Unternehmen geholfen werden. Immer mehr Unternehmer entscheiden sich daher, diese Chance zu ergreifen.
Weitere Informationen bei der IHK bzw. HWK oder unter www.kfw.de …


Wer darf an der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen mitarbeiten?
… nachlesen, soll die wesentlichen Repräsentanten von Gesundheitswesen und Gesellschaft widerspiegeln (vgl. dazu >>> http://charta-zur-betreuung-sterbender.de/runder-tisch-zusammensetzung.html http://charta-zur-betreuung-sterbender.de/runder-tisch-institutionen.html ).
In diesem Zusammenhang stehend wäre es interessant, zu erfahren, ob z.B. die …


Runder Tisch - Initiative zur nachhaltigen Förderung der Region startet in Windeck
… Initiative von Arndt Schäfer, der treibenden Kraft hinter energy2hub (http://www.energy2hub.de/), startet am Mittwoch, dem 15.4.2015 der "Runde Tisch" in Windeck-Schladern. Die Initiative "Runder Tisch" will die Region nachhaltig beleben. Um dies zu erreichen wurden Akteure der Region am "Runden Tisch" zusammengebracht. Zu diesen gehören neben energy2hub …

INTERGEO East 2010: Geoinformationssysteme im Mittelpunkt: Runder Tisch GIS e. V. Kooperationspartner
Istanbul/Karlsruhe, 20.04.2010. Ob Geoinformationen und Web 2.0, Geodateninfrastrukturen, Mobiles GIS, Cloud Computing oder 3D und 4D GIS, der Runder Tisch GIS e. V. kennt die Trends und fördert den Dialog und die Kommunikation unter den Vertretern des Marktes mit Geoinformationssystemen (GIS). Der im Jahr 2000 gegründete Zusammenschluss mit 216 Mitgliedern …

Seit 10 Jahren hilft der Runde Tisch der KfW Betrieben in Heilbronn-Franken in Krisensituationen
… sowie im Internet unter www.heilbronn.ihk.de/krisenmanagement.
Hintergrund:
So funktioniert der Runde Tisch
Ein Anruf genügt! Dann prüft die Kammer im Vorfeld anhand eingereichter Unterlagen, ob das betroffene Unternehmen in einer Krise steckt, die gelöst werden kann. Im gegebenen Fall wählt das Unternehmen dann einen von der KfW gelisteten Runden Tisch-Berater …
Sie lesen gerade: Nach über einem Jahr Ende „Runder Tisch“: Nach wie vor keine Hilfe für Betroffene