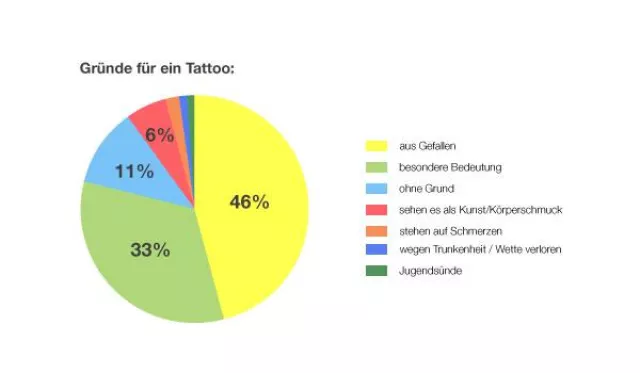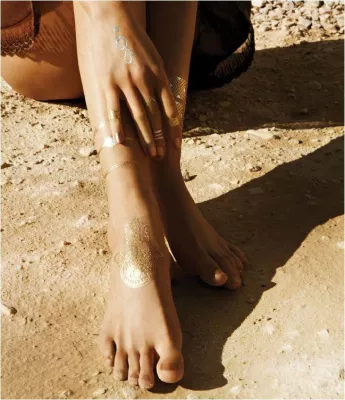(openPR) Tattoos und ihre Folgen beschäftigen immer wieder die Gerichte: Ob sie nachträglich doch nicht gefallen, Gesundheitsschäden verursachen oder den Arbeitgeber stören. Urteile zum Tattoo-Thema hat die Redaktion des Online-Portals Fachanwaltsuche zusammengestellt:
Bio-Tattoo löst sich nicht auf: Schadensersatz und Schmerzensgeld
Eine Tätowiererin muss ihrer Kundin allerdings Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen, weil sich ein sogenanntes "Bio-Tattoo" entgegen der Ankündigung nicht auflöste und nun mittels Laserbehandlung entfernt werden soll. So lautet eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (AZ 7 U 125/08).
Nachträgliche Hautinfektion: Kein Schadensersatz und Schmerzensgeld
Nach einem aktuellen Urteil des Landgerichts Coburg (Az. 11 O 567/10), haftet ein Tätowierer beim Auftreten einer entzündlichen Hauterkrankung nach der Tätowierung nicht. Im zugrundeliegenden Fall hatte sich eine Frau am Unterschenkel ein Tattoo stechen lassen und sechs Monate später trat im Bereich einer rotvioletten Farbgestaltung eine entzündliche Hautveränderung auf. Dieser Hautbereich musste nach längerer ärztlicher Behandlung entfernt werden. Das Gericht wies die Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage der Frau ab: Es sei allgemein bekannt, dass Tätowierungen ein gewisses Risiko, insbesondere der Infektion der betroffenen Hautteile, aufweisen würden. Hierüber bedürfe es keiner besonderen Aufklärung, zumal sich die Klägerin bereits viermal zuvor hatte tätowieren lassen. Der Tätowierer durfte sich auch auf die ihm vorliegenden Herstellerinformationen über den verwendeten Farbton verlassen. Keinesfalls war er verpflichtet, selbst aufwändige und teuere Laboruntersuchungen über die Farben zu veranlassen. Ein Verstoß gegen Hygieneregeln und eine unsachgemäße Aufbewahrung der Farben konnte die Frau nicht nachweisen.
"Schiefes" Tattoo: Kein Schadensersatz und Schmerzensgeld
Bei einem Tätowiervertrag handelt es sich um einen Werkvertrag. Minderungs- oder Schadenersatzansprüche bei einer fehlerhaften Tätowierung sind daher grundsätzlich nur möglich, wenn die Chance zur Nachbesserung gegeben wurde. Eine Unzumutbarkeit der Nachbesserung ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass erneut ein Eingriff in den Körper stattfinden muss. So urteilte das Amtsgericht München (AZ 213 C 917/11) im Fall einer Frau, die nach der Tätowierung mit dem Ergebnis unzufrieden war, dem Tätowierer aber auch nicht die Möglichkeit gegeben wollte, das Tattoo nachzubessern.
Arbeitnehmer muss Tätowierung verbergen
Ein Justizvollzugsbeamter muss seine Uniform so tragen, dass seine Unterarmtätowierungen nicht zu sehen sind. Dies urteilte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (AZ 2 A 10254/05.OVG ) mit folgender Begründung: Durch das Tragen einer Uniform solle ein einheitliches und neutrales Auftreten der Beamten erreicht werden. Mit diesem Zweck seien die großflächigen und deshalb besonders auffälligen Tätowierungen des Klägers trotz des Einstellungswandels der Bevölkerung zu Tätowierungen nicht vereinbar. Vielmehr ähnelten die Tätowierungen des Klägers denjenigen, die auch im Milieu von Strafgefangenen verbreitet seien. Deshalb bestehe die Möglichkeit eines Distanzverlustes zu den Strafgefangenen und damit einer Schwächung der Autorität des Beamten.