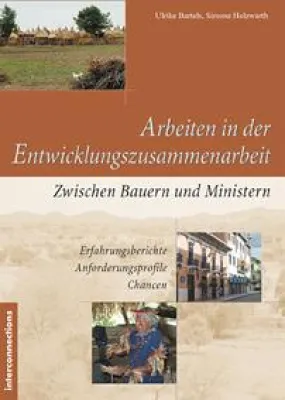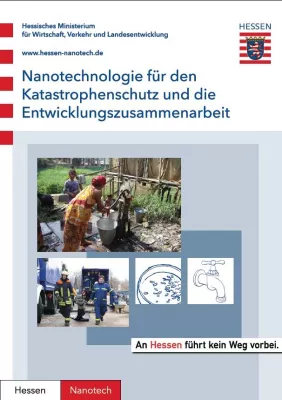(openPR) Nach aktuellen Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) sind 200 Millionen Frauen und Mädchen, vor allem in Afrika und Asien, von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) und ihren lebenslangen Folgen betroffen – das sind 200 Millionen schwere Menschenrechtsverletzungen, die Kindern angetan wurden. Der Verein „Lebendige Kommunikation mit Frauen in ihren Kulturen“ (LebKom), der sich seit über 15 Jahren mit seinem Fulda-Mosocho-Projekt für ein Ende von FGM engagiert, möchte anlässlich des Welttags gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar darüber hinaus die entwicklungspolitische Dimension dieser Problematik ins öffentliche Bewusstsein rücken.
Die neue Europa-Entwicklungszusammenarbeit steht vor allem seitens Umweltschutz- und kirchlichen Organisationen in der Kritik, weil sie in erster Linie darauf aufbaue, durch europäische Unternehmensniederlassungen Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Befürchtet wird, dass von dieser Art „Hilfe“ vor allem Europa profitiere, und zwar auf Kosten von Mensch und Natur in Afrika. LebKom vermisst in dem aktuellen Konzept der europäisch-afrikanischen Entwicklungszusammenarbeit zudem den Aspekt der Gleichberechtigung der Geschlechter. „Das Arbeiten daran ist ein entscheidender Schritt für mehr Wohlstand in Afrika - und die Einbeziehung der Männer daran ein wichtiger Motor“, sagt Ulrike Maschke, Mitbegründerin des Fulda-Mosocho-Projektes und von LebKom.
Schon seit Jahrzehnten ist es ein Ziel offizieller Entwicklungspolitik, Frauen zu „Entwicklungsträgerinnen“ zu machen. Doch das grausame Ritual der Genitalverstümmelung, das seinen Ursprung darin hat, Mädchen und Frauen als minderwertig zu definieren, verhindert eine Stärkung des weiblichen Teils der Bevölkerung. So ist FGM sowohl Ausdruck der Diskriminierung von Frauen als auch bremsender Faktor, wenn es um die Beseitigung ungleicher Behandlung geht. „Gewalt gegen Frauen hat weitreichende Konsequenzen für Frauen, ihre Kinder und die Gesellschaft als Ganzes“, so die Vereinten Nationen 2007 in einer Studie, in der sie den Zusammenhang zwischen voranschreitender Verarmung und geschlechtsspezifischer Gewalt eindeutig formulierten.
„Frauen, die wertgeschätzt werden, können zu Wertschöpfung beitragen, weil sie wissen, dass die Entfaltung ihrer Potentiale erwünscht ist“, fasst die Fuldaer Professorin Dr. Hinkelmann-Toewe zusammen. Sie ist Initiatorin des Fulda-Mosocho-Projektes, das 2010 in einer internationalen Studie von UNICEF als eine der fünf erfolgreichsten Initiativen hervorgehoben wurde, die sich in Afrika gegen FGM einsetzen. Es arbeitet in Kenia mit der Kisii-Ethnie zusammen, deren Beschneidungsrate 2001 noch 96 Prozent betrug. Schon wenige Jahre nach Projektstart galt FGM in der Region Mosocho als überwunden.
Erreicht wurde der Erfolg mit Hilfe einer wissenschaftlichen psychosozialen Strategie zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau, dem an der Hochschule Fulda entwickelten „Wert-Zentrierten Ansatz“. In Schulungseinheiten reflektieren Männer und Frauen mit speziell ausgebildeten sozialpädagogischen Fachkräften, welche Bereiche ihrer Kultur ihnen wichtig sind und welche Konventionen sie belasten. Sie erhalten innovatives Know-How zur Anatomie des weiblichen und des männlichen Körpers, das dazu führt, diesen wertzuschätzen; in Elternschulen erfahren sie, dass ihre Töchter genauso viele Potentiale wie ihre Söhne mitbringen.
Mittlerweile ist das Projekt infolge der großen Nachfrage auf die Nachbarregionen Marani und Kisii South ausgeweitet worden. Von den Mädchen, die 2003 zu den ersten geretteten Jahrgängen gehörten und die jetzt jugendlich oder erwachsen sind, haben viele weiterführende Schulen besucht und verfolgen selbstbestimmt Berufsperspektiven, die über das bisherige weibliche Rollenbild von der Frau als „Werkzeug des Mannes“ hinausgehen.
Das Beispiel des Fulda-Mosocho-Projektes zeigt nach Auffassung von LebKom, dass Europa ein anderer Blick auf den Nachbarkontinent gut zu Gesicht stünde: „Dann sehen wir nicht das bedürftige Afrika, sondern ein Land mit Entwicklungspotentialen, die freigesetzt und gefördert werden wollen“, unterstreicht Ulrike Maschke.