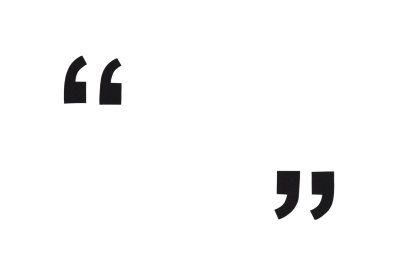
Fußnoten und Zitate führen den interessierten Leser zu weiteren, detaillierteren Informationen zum beschriebenen Thema. Sie zeigen zudem auf, dass sich der Autor mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und recherchiert hat. Vor allem dienen die Quellenangaben als Nachweis der richtigen Verwendung des geistigen Eigentums anderer, ohne durch Zitate das Urheberrecht zu verletzen. Doch wie muss eine Fußnote oder ein Zitat richtig aussehen? Je nachdem, ob die deutsche oder die amerikanische Zitierweise Verwendung findet, unterscheiden sich die Formen.
Direktes Zitat: So geht es richtig
Wie der Hinweis auf eine zitierte Textstelle oder gleich auf ein ganzes Buch auszusehen hat, hängt davon ab, was für eine Art Zitat es ist. Beim direkten Zitat handelt es sich um einen Text, der wortwörtlich und unverändert wiedergegeben wird. Das direkte Zitat kommt komplett in Anführungsstriche. Diese zeigen genau an, wo das Zitat beginnt und wo es endet.
Sollen Textstellen nicht mitzitiert werden, so ersetzen Auslassungszeichen mit drei Punkten darin die wegfallende Textstelle. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass durch die Auslassung der Originaltext inhaltlich nicht verfälscht wird und die wegfallende Textpassage für das Zitat nicht von Belang ist. Das gleiche gilt für Ergänzungen in ein direktes Zitat hinein. Der Autor setzt die Ergänzungen ebenfalls in die eckigen Klammern und schreibt dahinter einen Hinweis, dass es sich um eine Ergänzung handelt.
- Zitat in Anführungsstrichen: „zitierter Text“
- Kennzeichnung von Auslassungen: [...]
- Ergänzender Text: [Beispieltext, Anmerkung des Verfassers]
Direktes Zitieren
Selbst Fehler im Originaltext sind exakt zu zitieren. Handelt es sich beispielsweise nicht einfach um die alte Rechtschreibung, sondern um orthographische Fehler? Dann kann der Verfasser sich von der Schreibweise distanzieren und sie als fehlerhaft kenntlich machen. Dazu kennzeichnet er die zitierte Passage mit dem lateinischen Wort sic und einem nachfolgendem Ausrufezeichen in eckigen Klammern hinter den Text, auf den es sich bezieht. Es handelt sich dabei um die Kurzform von „sic erat scriptum“, was „so stand es geschrieben“ übersetzt bedeutet.
Wörter, die im Originaltext nach der alten Rechtschreibung korrekt geschrieben stehen, dürfen unverändert ohne Kennzeichnung übernommen werden. Alternativ ist es auch möglich, sie an die neue Rechtschreibung und damit an den übrigen Text angepasst zu verwenden und das ohne jeglichen Hinweis. Sind wörtliche Zitate mehrzeilig so werden sie als eigener Absatz in den Text eingerückt. Ansonsten ist bei einem direkten Zitat alles genauso zu übernehmen, wie im Original. Das gilt auch für Kursivschreibungen. Dahinter bekommt das Zitat nach deutscher Zitierregel eine hochgestellte Anmerkungsziffer für die Fußnote, in der sich dann die genaue und detaillierte Quellenangabe befindet.
- Hinweis auf Rechtschreibfehler oder gravierende Fehler im Originaltext: [sic!]
- Zitatmuster mit Anmerkungsziffer und Quellennennung in der Fußnote:
„Ein direktes Zitat muss exakt zitiert werden, auch wenn es Fehller [sic!] enthält, [...].“ ²
Sinngemäße Wiedergabe
Handelt es sich nicht um ein wörtliches, sondern ein sinngemäßes Zitat, dann folgt die Formatierung anderen Regeln. Es gibt keine Kennzeichnungen oder Zeichen, sondern der Hinweis auf die Bezugnahme erfolgt im Satz direkt. Dazu verwenden die meisten Verfasser den Konjunktiv I. Die Quelle ist allerdings genau wie bei dem direkten Zitat über eine Anmerkungsziffer mit Quellenangabe in der Fußnote zu benennen. Für den sprachlichen Einbau beginnt der Satz mit einem Hinweis auf den Autor. Entfällt der Name vor dem Zitat, so steht vor der Quellenangabe in der Fußnote die Abkürzung des Wortes vergleiche, also „vgl.“. Andere verwenden alternativ das Wort siehe in seiner Abkürzung „s.“ Nachfolgende zwei Beispiele dazu:
- Zitat: Richter sagte doppeldeutig hierzu, dass das Morgengrauen mit der Lektüre der Zeitung beginne.1
Quellenangabe: 1 Richter, Michael, Wortbruch, Aphorismen, verbum Druck Berlin, 1993 - Zitat: Wiederrum andere meinen, dass das Morgengrauen bereits mit der Lektüre der Zeitung beginne.²
Quellenangabe: ² vgl. Richter, Michael, Wortbruch, Aphorismen, verbum Druck Berlin, 1993
Zitate aus dem Internet richtig verwenden
Sie sind rechtlich immer wieder ein großes Problem – die Zitate von Quellen aus dem Internet. Da Suchmaschinen Double Content abstrafen, legen die Webseitenbetreiber besonders großen Wert auf Unique Content. So machen sich Wettbewerbsrechtler immer wieder auf die Suche nach Verstößen, was online ohne viel Aufwand zu recherchieren ist. Deswegen muss auf Zitate von Texten oder Grafiken im Internet aber nicht komplett verzichtet werden. Wichtig ist eine korrekte Kennzeichnung, dass es sich dabei um Zitate handelt.
Neben den gleichen Angaben, die bei Offlinequellen verwendet werden, kommt im Internet die URL dazu. Des Weiteren muss das Datum des Aufrufs dahinter stehen, für den Fall, dass der Inhalt der Webseite geändert wird. Wichtig ist es, nur dann Zitate aus dem Internet zu verwenden, wenn alle erforderlichen Quellenangaben auch erkennbar sind.
Quellenangabe Muster:
Richter, Manuel, XY-Buch, Druckverlag München 1982, auszugsweise veröffentlicht auf https://www.internetseite.de/buch [01.01.2018]
Die Quellenangabe bei Zitaten
Bei Zitaten nach deutscher Zitierregel stehen die Quellenangaben als Fußnote unterhalb des Textes. Dabei kommen zuerst die Anmerkungsziffer und dann die Quellenangabe. Sie enthält verschiedene Punkte in nachfolgender Reihenfolge:
1. Anmerkungsziffer: ³
2. Nachname, (Komma)
3. Vorname: (Doppelpunkt)
4. Titel des Werkes, (Komma)
5. Auflage, (Komma)
6. Erscheinungsort, (Komma)
7. Verlag, (Komma)
8. Erscheinungs- oder Auflagejahr, (Komma)
9. Seite
Bei Zitaten aus dem Internet können die Punkte 1 bis 8 gleich bleiben. Nach dem Punkt 9 folgt ein Komma, dann geht es so weiter:
10. URL [http://...]
11. Datum der Datenabfrage: [tt.mm.jjjj]
Die deutschen Zitierregeln erfordern die Quellenangabe mit allen vorhanden Informationen in oben dargestellter Weise. Ist in einem Text die gleiche Quelle ein zweites Mal zu verwenden, dann genügt die Kurzform, die ausschließlich folgende Punkte beinhaltet:
1. Anmerkungsziffer: ³
2. Nachname, (Komma)
3. Vorname: (Doppelpunkt)
4. Erscheinungs- oder Auflagejahr, (Komma)
5. Seite
Die amerikanischen Zitierregeln haben eine andere Verwendung der Kurzform der Quellenangabe. Sie steht dann direkt in Klammern hinter dem Zitat im Fließtext. Die komplette Quellenangabe steht dann erst am Ende des Textes. Anstelle der Anmerkungsziffer dient die kurze Quellenangabe als Verbindung zum Vollbeleg. Verwendet werden hierfür nur der Nachname, das Ausgabejahr und die Seitenzahl. Das kann dann beispielsweise so aussehen: (Richter, 1982, S.14). Eine alternative Schreibweise ist (Richter, 1982: 14).
Musterbeispiele für Quellenangaben
Die Quellenangabe ist das Wichtigste an einem Zitat, denn sie informiert über den geistigen Eigentümer der Worte. Sie dient daher nicht nur als Angabe, wo interessierte Leser das Thema vertiefen können. Die Angabe des Rechteinhabers der Zitate sichert den Verfasser auch gegenüber Urheberrechtsklagen ab.
- Quellenangabe als Fußnote:
1 Nachname, Vorname: Titel, Auflage, Erscheinungsort, Verlag, Ausgabe, Seite - Quellenangabe von Internetquellen mit Fußnote:
1 Nachname, Vorname: Titel, Auflage, Erscheinungsort, Verlag, Ausgabe, Seite, URL [tt.mm.jjjj] - Quellenangabe indirektes Zitieren:
1 vgl. Nachname, Vorname: Titel, Auflage, Erscheinungsort, Verlag, Ausgabe, Seite - Quellenangabe in Kurzform bei zweiter Nennung:
1 Nachname, Vorname: Ausgabe, Seite - Quellenangabe in Kurzform auf amerikanische Weise:
(Nachname: Ausgabe, Seite)
Deutsche oder amerikanische Zitierweise?
Die Frage ist so generell nicht zu beantworten. Prinzipiell sollten Autoren die deutsche Zitierweise verwenden, wenn sie öffentliche Texte schreiben. Anders kann das an Universitäten, Instituten, Schulen, bei Verlagen oder in der Forschung aussehen. Viele Schulen und Hochschulen geben eine Form des Zitierens ganz detailliert vor. Die einen setzen auf die deutschen Zitierregeln, die anderen geben die amerikanische Weise vor. Gerade bei Doktorarbeiten legen die Universitäten in der Regel die Zitation bis in das kleinste Detail fest.

