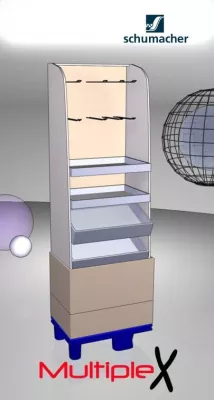(openPR) Unerträgliche Schmerzen, allein sein, wenn die Not am größten ist, oder sich ob seiner Hilfsbedürftigkeit als Belastung für die Allgemeinheit empfinden müssen, davor fürchtet sich, wer sich Gedanken darüber macht, wie das eigene Leben wohl zu Ende gehen wird. Fachleute sind überzeugt, dass es heute viele Möglichkeiten gibt, Schmerzen erträglich werden zu lassen. Gerade auf dem Land fehlt es jedoch häufig an entsprechenden Angeboten, Sterbenskranke gut zu versorgen. Ein neues Gesetz soll dies ändern.
„Hospiz- und Palliativgesetz“ heißt die Vorlage, über die der Bundestag heute diskutierte. U.a. soll grundsätzlich klargestellt werden, dass die Sterbebegleitung eine Regelleistung darstellt, die von den Kranken- und Pflegekassen übernommen werden muss. Bisher müssen sich ambulante Versorger immer wieder mit den Kostenträgern auseinandersetzen, ehe sie sich um Schwerstkranke kümmern können. Ein reibungsloser Ablauf soll dafür sorgen, dass mehr Menschen zu Hause sterben können. Sehnlichster Wunsch vieler, der sich momentan nur für jeden Fünften erfüllt. Fast jeder Zweite erlebt seine letzten Stunden im Krankenhaus, nahezu jeder Dritte im Pflegeheim.
Was braucht es, um gut daheim sterben zu können? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Fachtagung des Caritaszentrums Miesbach und des Katholischen Bildungswerks im Landkreis Miesbach e.V. am 28. Oktober 2015 im St. Anna-Haus Holzkirchen.
Als Hauptreferentin war Martina Kern vom Zentrum für Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn nach Oberbayern gekommen. Für http://www.Lawiki.bayern erläuterte Kern, worum es bei der Palliativ-Versorgung geht: den Patienten in eine Art schützenden Mantel (pallium = lateinisches Wort für ‚Mantel‘) zu hüllen, wenn eine Heilung kaum mehr möglich erscheint. Das Credo laute: dem Tag mehr Leben geben und nicht dem Leben (um jeden Preis) mehr Tage hinzufügen.
Kern erläuterte die unterschiedlichen Formen der Versorgung. Die Hospizdienste etwa würden vorwiegend von Ehrenamtlichen getragen. Bei der ‚Spezialisierten ambulanten Palliativ Versorgung‘ (SAPV) kümmerten sich Teams von Ärzten, Pflegenden und Mitarbeitern der psychosozialen Berufsgruppen um die Patienten. In Hospizen würden Schwerstkranke rund um die Uhr bis zum Lebensende begleitet. Immer mehr Krankenhäuser verfügten über Palliativstationen, die stationär aufgenommene Patienten in Krisensituationen so gut einzustellen versuchten, dass ihre Schmerzen und andere Symptome erträglich würden und sie idealerweise nach Hause entlassen werden könnten.
Auch in Pflegeeinrichtungen erkenne man langsam die Bedeutung einer Palliativversorgung. (Anmerkung: Die oben genannte Gesetzesvorlage will Pflegeheime verpflichten, künftig u.a. mit Ärzten zusammenzuarbeiten, um den Bewohnern ein erträgliches Sterben in Würde zu ermöglichen.) Menschen in diesen Einrichtungen kämpften ebenfalls mit Schmerzen, Angst, Unruhe oder Atemnot. Viele wollten nicht mehr zum Sterben ins Krankenhaus, sondern bis zuletzt in ihrem Pflegeheim bleiben. Die Palliativversorgung könne entweder von der Pflegeeinrichtung selbst oder in Kooperation mit externen Anbietern organisiert werden.
Wichtig sei, dass die Idee der Palliativversorgung sich nicht auf die Begleitung von Patienten in der Sterbephase beschränke. Sie sei immer dann gefragt, wenn Menschen mit einer lebensbedrohlichen Situation konfrontiert seien, wenn sie ihre letzten Dinge ordnen und über die großen Fragen des Lebens reden wollten. Was wünsche ich mir, wenn…? Wo möchte ich sein, wenn…?
Unterstützung brauchten jedoch nicht nur Schwerstkranke selbst, sondern auch ihre Angehörigen, insbesondere dann, wenn der Patient daheim versorgt werde. So könnten z.B. Hospizdienste vorübergehend für den Kranken da sein, so dass die Angehörigen ein wenig Zeit für eigene Bedürfnisse bekämen.
Spezielle Angebote für Kinder würden erst in jüngerer Zeit entwickelt. Bisher habe man sie als Trauernde kaum wahrgenommen. Dabei äußere sich ihr Seelenzustand nur anders als der der Erwachsenen. Kinder seien nicht durchgängig traurig, sie hüpften sozusagen in den Pfützen der Trauer.
Insgesamt kommt es Kern zufolge in der Palliativarbeit darauf an, alle Angebote so miteinander zu vernetzen, dass Hilfebedürftige nicht lange suchen müssen, sondern vor Ort passgenau das für sie Notwendige finden.
Nach Martina Kerns Erfahrung dürfen in der Palliativversorgung tätige Fachkräfte bei aller Sorge um Patienten und deren Angehörige ihre eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Zwischendurch müsse auch unter Kollegen die Frage erlaubt sein: „Wie viel Tod und Sterben vertragen wir, wenn wir uns immer wieder neu berühren lassen vom Leid der Menschen?“ Vertrauensvolle Zusammenarbeit in harmonischen Teams sei eine wichtige Voraussetzung, Palliativarbeit auf Dauer gut machen zu können. Kern ist überzeugt, dass nur „denkerische Durchdringung“ der Palliativarbeit befähigt, das Leid der Patienten, ihre Ohnmacht mit ihnen zusammen auszuhalten, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen.