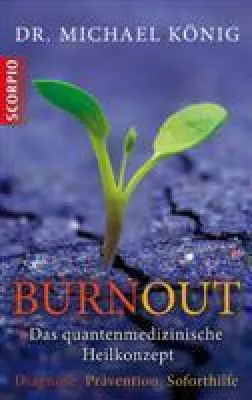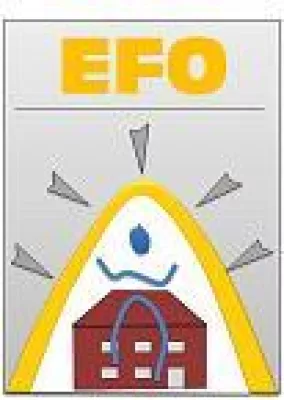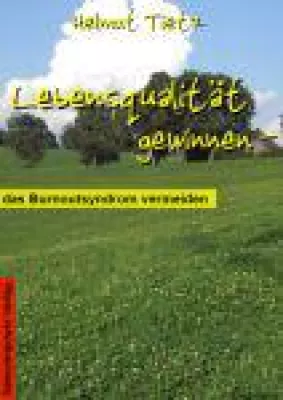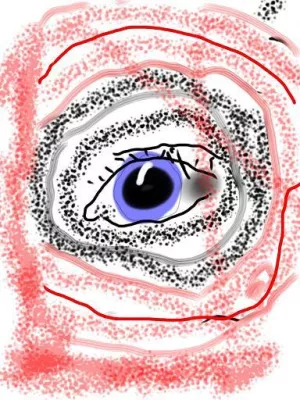(openPR) Das Burnout-Phänomen - des Ausgebrannt seins, der psychosomatischen, chronischen Erschöpfung - ist grundsätzlich nicht erst eine typische Symptomatik dieses Jahrhunderts. Barth (1992, S. 13f.) zitiert aus dem ,,Oberpfälzer Schulanzeiger" von 1911, in dem eine ,,moderne Lehrerkrankheit" mit dem Namen ,,Neurasthenie" beschrieben wurde, die sehr ähnliche Symptome wie das Burnout-Syndrom aufweist und deren Wurzeln in den ,,übermäßigen fortgesetzten Anforderungen des Berufs und des gesellschaftlichen Lebens" liegen. Betroffen vom Burnout-Syndrom sind hauptsächlich Menschen in verantwortungsvollen Positionen wie Pflegepersonal, Führungskräfte, Lehrer, Ärzte, Polizisten,…. Es handelt sich beim Burnout um ein komplexes Beschwerde- bzw. Leidensbild, das eine beachtliche Schnittmenge mit einer Depression hat, deren Ursachen jedoch eindeutig im beruflichen Bereich liegen. Was sind typische Kennzeichen von Burnout? Die Autoren Schaufeli und Enzmann (1998) nennen vier Symptomgruppen:
1. Stressreaktionen
o Hektik
o Ungeduld
o Reizbarkeit
o erhöhter Blutdruck
o Magenbeschwerden
2. Gefühl reduzierter Effizienz
o Angst, nicht mehr den Anforderungen gewachsen zu sein
o fremdbestimmt zu sein, nur noch reagieren können
o wie ein Hamster im Rad sein
o Hilflosigkeit
3. Reduzierte Motivation
o Gefühle des Versagens, der Sinnlosigkeit
o mangelndes Interesse am Beruf oder Aufgabenbereich
o Verzweiflung bis hin zu Hoffnungslosigkeit
o negative Einstellung zur Firma oder Beruf
4. Disfunktionale Einstellungen zur Arbeit
o Alkohol, Drogen
o Entscheidungen verschieben
o permanente Überstunden, Überarbeitung
o Gefühl, alles selbst machen zu müssen
o zu wenig Schlaf
o Zynismus
o Perfektionismus
Wie bei vielen Störungen, ist auch Burnout nicht von einer auf die andere Sekunde auf einmal präsent. Es entwickelt sich schubweise, wenn nicht interveniert wird. Das heißt, Zeiten einer Verschärfung folgen wieder Zeiten einer spontanen Besserung, wobei die Grundtendenz bei fehlender Intervention in Richtung Verschärfung geht. Es können nach Edelwich & Brodsky (1980) mehrere Phasen bei Burnout unterschieden werden:
1. Idealistische Begeisterung
Selbstüberschätzung, hochgesteckte Ziele, ausgeprägter Optimismus, hoher Arbeitseinsatz sowie starke Identifizierung mit Kunden und der Arbeit
2. Stillstand
erste Enttäuschungen, Beschränkung der Kontakte auf Kollegen, Reduzierung des Lebens auf die Arbeit, Rückzug von Klienten und Vernachlässigung des Familienlebens
3. Frustration
Erfahrung der Erfolg- und Machtlosigkeit, Probleme mit Bürokratie, gefühlter Mangel an Anerkennung von Kunden und Vorgesetzten, Gefühle von Inkompetenz, psychosomatische Erkrankungen, Zynismus, Sarkasmus, versteckte und offene Aggression
4. Apathie
völlige Desillusionierung, Verzweiflung wegen schwindender beruflicher Alternativen, Resignation bis hin zur Hilflosigkeit mit depressiver, gehemmter Symptomatik.
5. Intervention
Versuche, das Problem erst einmal selbst an zu gehen, Anti-Burnout-Training und bei schwererem Störungsbild Psychotherapie evtl. mit adjuvanter Pharmakotherapie bzw. Klinikaufenthalt. Britische Forscher haben in einer neuen und großen Studie mit 641 Betroffenen (vgl. P.D. White et al., 2011) mehrere Therapien überprüft. Am erfolgreichsten zeigen sich bei der klinischen Erschöpfungssymptomatik die Kognitive Verhaltenstherapie als auch die Aktivierungstherapie.
Anhand dieser Symptome ist zu erkennen, dass es nicht nur eine große Schnittmenge zur Depression gibt, sondern sich ähnlich wie bei Konflikten am Arbeitsplatz aktive Phasen durch passive Phasen und umgekehrt ablösen. Das Gute daran ist - sofern man bei Burnout wirklich von "gut" sprechen kann - dass Burnout bei wirksamer Intervention zurückgebildet werden kann.
Darüber geht es hier demnächst weiter ...