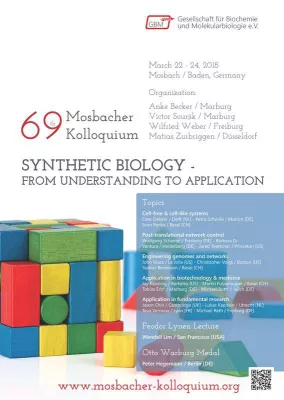(openPR) Untersuchungen von insolventen Unternehmen zeigen, dass ca. 60% dieser Unternehmenskrisen auf Nichtbeachtung strategischer Risiken zurückzuführen sind. Unabhängig von gesetzlichen Notwendigkeiten ist der aktive Umgang mit Risiken ein wichtiger Baustein einer erfolgreichen und präventiven Unternehmensführung.
Die rechtzeitige Erkennung und angemessene Einstufung von Risiken in einem Unternehmen verhindert oft die Vermeidung des Eintretens dieser Negativereignisse. In solchen Fällen wird das „Risikoerlebnis“ sogar positiv empfunden.
Dabei leitet sich der Risiko-Begriff aus der Seefahrt ab, d.h. im Sinne „eine Klippe umschiffen“.
Diese Verantwortung trägt auf einem Schiff entsprechend dem Top-Down-Ansatz der Kapitän, der über die verschiedensten Informationstools, ähnlich einem „Risikocockpit“, versucht, bestehende oder mögliche Risiken einzuschätzen und ggf. zu vermeiden.
Schon historisch drängt sich die Frage auf, ob dieser Ansatz erfolgversprechend ist?
Ein klares „Nein“!
Bestes Beispiel - der vielstrapazierte Titanic-Untergang: Der Kapitän wähnte sich absolut sicher - trotz extremer Route und eines nagelneuen Schiffs (mit zu wenigen Rettungsbooten). Dieses Ignorieren von Risiken wurde entsprechend an die Mannschaft weitergegeben – der resultierende schiffsweite Glaube an die „Unsinkbarkeit“ verhinderte auch jedes Auseinandersetzen mit etwaigen Risiken auf der Jungfernfahrt.
So stellt sich konsequenterweise folgende Frage: Hätte der Untergang durch besseres Hintergrundwissen der Mannschaft bzw. Training für den Risikofall verhindert werden können?
Ein klares „Ja“!
Die Katastrophe wurde wahrscheinlich erst durch die Fehlentscheidung des wachhabenden Offiziers ausgelöst, nicht mit dem (verstärkten) Schiffsbug den Eisberg zu rammen, sondern ein Ausweichmanöver einzuleiten. Dieses zu-kurz geratene „Abdrehen“ führte dann dazu, dass die Titanic an der ungeschützteren Breitseite mit dem Eisberg kollidierte.
Allein durch ein entsprechendes Training der Offiziere bzgl. der Schiffskonstruktion bzw. des Schiffsverhaltens im Extremfall hätte das Unglück vielleicht nicht ganz verhindert, zumindest aber das Ausmaß verringert werden können.
Durch das Wissen über die Vor- und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen des Schiffes hätte man ein entsprechendes Risikobewusstsein aufbauen, trainieren und auch leben können.
Ist dies in die heutige operative (Projekt- bzw. Prozess-) Praxis übertragbar?
Wiederum „Ja“!
Jeder Mitarbeiter sollte sich bereits vor Beginn eines Projektes oder eines (neuen) Prozesses Gedanken über die aktuellen Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) machen sowie im bereichsübergreifenden Team die weiteren Möglichkeiten (Opportunities) und Bedrohungen (Threats) beleuchten. Diese einfache und schnelle Möglichkeit der wohlbekannten SWOT-Analyse verschafft einen schnellen, einfachen und recht kompletten Überblick über die jetzige und zukünftige Situation.
Und: Wer kennt denn am besten die operativen Risiken eines Projektes bzw. Prozesses – natürlich der „ausführende“ Mitarbeiter bzw. das dazugehörige Team!
Auf Basis der SWOT-„Bestandserhebung“ leiten folgende Fragen sehr schnell zum operativen Risikomanagement über:
• Wie können wir unsere Stärken nutzen, um Chancen erfolgreich ergreifen zu können?
• Wie können wir unsere Schwächen abbauen, um die Chancen nicht vorbeiziehen zu lassen?
• Wie können wir unsere Stärken nutzen, um Bedrohungen abwenden zu können?
• Wie können wir unsere Schwächen abbauen, um Bedrohungen zu vermeiden?
Ein moderierter Teamansatz erhöht die Transparenz und Nachhaltigkeit und optimiert diese Methodik. Hierdurch kann dann im nächsten Schritt das Risikomanagement aktiv eingeleitet werden:
Für die negativ-belegten Punkte in der SWOT-Matrix (Weaknesses, Threats) werden Risiko- bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse und der dazugehörige mögliche Schaden im Eintrittsfall definiert. Über diese zwei Parameter können dann sehr schnell in der üblichen Vierfeldermatrix die hoch-, mittel- und niedrigriskanten Einzelpunkte sichtbar gemacht werden.
Zumindest für die hochriskanten Fälle werden wiederum gemeinschaftlich Risikoverminderungsstrategien (inkl. Kosten) ausgearbeitet – die mittelriskanten Bereiche stehen „unter Beobachtung“.
Somit ist Risikomanagement ein effektiver und effizienter operativer Ansatz, einzelne Projekt- und Prozessrisiken prospektiv zu senken.
Und: Konsolidiert man diese einzelnen Risikoverminderungsansätze „nach oben“ so kommt es automatisch zur werthaltigen Risikoverminderung für das Gesamtunternehmen.
Und: Durch die entsprechende Dokumentation erfüllt man gleichzeitig noch etwaige gesetzliche Anforderungen!
Das Resultat:
Operativ gelebtes Risikomanagement ist wert- und nutzbringend für das gesamte Unternehmen und verliert sein Negativ-Image durch den prospektiven bereichsübergreifenden Teamansatz.
Der Top-Down-Ansatz würde zwar für die formelle Berichtung genügen, hätte aber keine operativen Synergien, da nicht gelebt.
Werthaltiges Risikomanagement…
…ist gelebtes, operatives Risikomanagement…
…ist ein Bottom-Up-Ansatz!