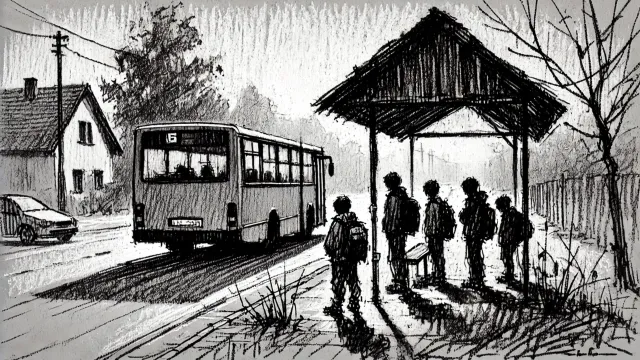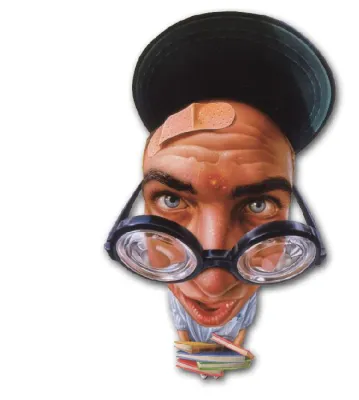(openPR) Vorwort - Loitz, Lernort mit Geschichte und Gegenwart
Loitz ist ein Ort mit Geschichte. Und mit Verantwortung. Vor siebzig Jahren war diese Stadt ein Schauplatz von Ausgrenzung, Misstrauen und stillem Mitlaufen – als nach dem Krieg Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, hier keine neue Heimat fanden. Auch Brigitte Irrgang, deren Lebensgeschichte ich sehr schätze, erinnert daran: Dass Hass, Missgunst und Schweigen keine abstrakten Größen sind – sondern Folgen fehlgeleiteter gesellschaftlicher Prägungen, die Wirklichkeit schaffen und Menschen vertreiben können.
Heute sind es andere Zeiten. Aber dieselben Fragen. Wie begegnen wir denen, die neu hier sind? Was heißt es, Teil dieser Stadt zu werden? Was brauchen Jugendliche, um sich sprachlich, fachlich und menschlich orientieren zu können?
Die beiden Brandanschläge, die Loitz im September 2025 erschüttert haben, waren keine Einzelfälle, sondern Ausdruck eines Klimas: gegenüber Geflüchteten, gegenüber Projekten, die für Integration und Teilhabe stehen. Dass einer dieser Anschläge mein Fotoatelier traf, ist nicht das Zentrum dieser Dokumentation. Aber es ist ihr Auslöser.
Denn genau dort, am Ort der Zerstörung, im selben Zeitraum, ist dieses Praktikum durchgeführt worden: Ein integrativer Lernraum für Jugendliche aus der Ukraine, begleitet von einfacher Sprache, klaren Bildern und einem verbindlichen Tagesrhythmus. Ohne großen Aufwand. Ohne Vorwissen. Aber mit Struktur, Feingefühl und Verantwortung.
Diese Leseprobe zeigt, wie Sprache wachsen kann, wenn sie nicht verurteilt, sondern geteilt wird. Wie Fachbegriffe zu Werkzeugen werden, wenn man sie in Bilder übersetzt. Und wie Integration beginnt: nicht in der Statistik, sondern im Kopf.
Deshalb beginnt es nicht mit einem fertigen Konzept – sondern mit einem guten Lösungsansatz: angefangen, fortgeführt, weitergedacht.
Kapitel 1: Einleitung
Wie kann ein Praktikum so aufgebaut sein, dass es nicht nur abläuft, sondern wirklich etwas bewegt? Diese Frage stand ganz am Anfang – nicht als Theorie, sondern als echte Überlegung. Zwei Jugendliche waren gerade erst nach Deutschland gekommen. Es gab ein Fotoatelier. Einen selbstständig arbeitenden Fotografen. Zwei Wochen Zeit.
Mehr war es nicht. Aber genau daraus wuchs etwas Besonderes: ein Praktikum, das Sprache, erste Schritte mit Medien und eigenes Mitdenken miteinander verbindet. Es gab keinen fertigen Ablaufplan. Keine Anleitung, wie man es richtig macht. Aber es gab eine klare Richtung.
Was in dieser kurzen Zeit entstanden ist, zeigt dieser Text – in kleinen Schritten, in klaren Worten.
Warum wir mit Theorie, klarer Sprache und zweisprachigen Handouts begonnen haben – und was daraus geworden ist
Manchmal beginnt etwas nicht mit einer großen Idee, sondern mit einem einfachen Blick auf die Wirklichkeit. In diesem Fall war es eine Frage: Wie kann ein Ort, an dem Bilder entstehen, auch ein Ort sein, an dem man ankommt? Was kann ein Fotoatelier leisten, wenn zwei junge Menschen aus einem anderen Land nicht nur eine neue Sprache lernen müssen, sondern auch einen Platz suchen – im Alltag, im Denken, im Leben?
Die Antwort war kein fertiges Konzept. Sondern ein Versuch. Und dieses Konzept begann langsam – ganz bewusst. Zwei Wochen lang. Mit klarer Sprache, mit verlässlichen Abläufen, mit einfachen Blättern zum Nachlesen. Und vor allem: mit der Zeit. Zeit zum Verstehen. Zeit zum Ausprobieren. Zeit, um Fragen zu stellen. Und auch Zeit, um Fehler zu machen.
Am Anfang stand nicht die Kamera, sondern das Gespräch. Nicht die Fachbegriffe, sondern zwei Sprachen, die nebeneinander Platz hatten: Ukrainisch und Deutsch. Denn Technik nützt wenig, wenn man nicht versteht, was gesagt wird. Und ein geordneter Ablauf hilft nicht weiter, wenn man sich dabei verloren fühlt.
Dieses Projekt ist kein Plan zum schnellen Nachmachen. Aber vielleicht ein Anfang. Eine Möglichkeit, wie man das Ankommen üben kann – ohne Druck, ohne Eile, aber mit einer klaren Richtung und gegenseitigem Respekt.
Was in diesen zwei Wochen entstanden ist – was gut lief, wo es gehakt hat, und warum es trotzdem trägt – das erzählt dieser Text.
Kapitel 2: Einstieg - Meine Philosophie
Wenn junge Menschen lernen, braucht es mehr als Wissen. Es braucht Zeit, Geduld und einen Ort, an dem man sich sicher fühlt. Genau das war der Ausgangspunkt für dieses Praktikum: langsam anfangen, gemeinsam denken – und erst dann ins Tun kommen.
Freiberufliche Arbeit unter dem Namen DREIFISCH
DREIFISCH steht für freies, selbstständiges Arbeiten mit Fotografie, Film und Gestaltung – mit einem hohen Anspruch an Sorgfalt und Genauigkeit.
Das Atelier ist dabei nicht nur ein Ort für Aufträge, sondern ein Raum, in dem Geschichten mit Bildern erzählt werden. Hier wird genau hingeschaut. Es wird so gearbeitet, dass man dem, was gezeigt wird, mit Respekt begegnet – und auch den Worten, die das Bild begleiten.
Es geht nicht einfach nur um Technik oder um schöne Bilder. Es geht um eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten: aufmerksam, offen, mit dem Bewusstsein, dass jedes Bild etwas bedeutet.
Wer fotografiert oder filmt, entscheidet mit, was sichtbar wird – und was vielleicht im Verborgenen bleibt. Und genau deshalb ist jede gestalterische Arbeit auch mit Verantwortung verbunden.
Ob beim Fotografieren, beim Schneiden oder beim Gestalten eines Layouts: Es geht immer darum, etwas sichtbar zu machen, das sonst vielleicht übersehen würde.
An diesem Punkt trifft das Gestalten auf eine Aufgabe, die über das Bild hinausgeht. Genau dort beginnt die Idee, dass Gestaltung nicht nur ein Beruf ist, sondern auch ein Weg, sich mit anderen zu verbinden – über das, was man sieht, und über das, was man zeigen möchte.
Integration braucht Raum, Zeit und Begegnung
Integration ist kein Ziel, das man einmal erreicht und dann abhaken kann. Sie braucht Zeit. Sie wächst langsam, Schritt für Schritt. Und wie alles, was wirklich wachsen soll, braucht sie Geduld, Wiederholung – und Orte, an denen man etwas ausprobieren darf, ohne gleich bewertet zu werden.
Gerade junge Menschen, die neu in ein Land kommen, stehen oft vor zwei großen Aufgaben: Sie müssen eine neue Sprache lernen. Und sie müssen sich in einem Alltag zurechtfinden, der ihnen noch fremd ist.
Integration heißt in diesem Zusammenhang nicht, sich anzupassen, bis man nicht mehr auffällt. Sondern: gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen – langsam, mit Augenmaß, und auf beiden Seiten.
Am besten gelingt das, wenn man nicht nur darüber spricht, sondern gemeinsam etwas tut. Wenn Integration kein Begriff bleibt, sondern etwas wird, das man im Alltag erleben kann – beim Mithelfen, im Gespräch, in kleinen Abläufen, die man gemeinsam bewältigt.
Langsamkeit ist dabei kein Nachteil. Im Gegenteil: Sie ist notwendig. Wer sich Zeit nimmt, kann genauer hinschauen. Wer das, was gelingt, sichtbar macht, erkennt seinen eigenen Fortschritt – und kann stolz darauf sein. Und wer zusammen mit anderen lernt, lernt nicht nur etwas über Sprache oder Technik, sondern auch über sich selbst und das Miteinander.
Ein Praktikum als Anfang – langsam, zweisprachig, mit viel Zeit für Theorie
Die Idee war einfach: Integration darf man nicht nur erwarten, man muss sie möglich machen. Und damit das gelingen kann, braucht es Orte, an denen man gemeinsam üben kann, wie es geht.
So entstand der Wunsch, ein Praktikum zu schaffen – im eigenen Atelier. Nicht als klassischer Einstieg in einen Beruf, sondern als Gelegenheit, erst einmal anzukommen. Still zu beobachten. Fragen zu stellen. Mitzudenken, ohne gleich etwas leisten zu müssen.
Damit das gelingen konnte, wurde das Atelier angepasst – inhaltlich und sprachlich. Es sollte ein Ort sein, der nicht überfordert, sondern einlädt. Ein Ort, der ruhig ist, klar strukturiert, und an dem man Dinge ausprobieren darf, bevor sie beurteilt werden.
Ein wichtiger Punkt war die Sprache. Das Praktikum wurde von Anfang an zweisprachig gestaltet: Ukrainisch und Deutsch standen gleichberechtigt nebeneinander. Auf den Zetteln. In den Gesprächen. In allen Materialien. Sprache sollte keine Hürde sein – sondern ein Werkzeug, das man benutzen kann. Verständlich. Wiederholbar. Zum Mitnehmen.
Auch bei den Inhalten wurde das Tempo bewusst herausgenommen. Am Anfang stand nicht das Machen, sondern das Verstehen. Die Theorie hatte Vorrang – nicht, weil die Praxis unwichtig wäre, sondern weil sie sonst zu früh kommt. Wer mit Technik sicher umgehen will, muss erst begreifen, was sie bedeutet.
Deshalb wurden die Grundlagen zuerst erklärt, gemeinsam angeschaut, ausprobiert – und erst danach kamen Kamera, Licht oder Ton zum Einsatz.
So entstand ein Rahmen, der nicht auf Leistung setzte, sondern auf Vertrauen. Ein langsamer Anfang – mit Absicht gewählt. Denn ankommen heißt nicht nur, anwesend zu sein. Es heißt: sich orientieren zu dürfen, Fragen stellen zu dürfen, Sprache zu finden – und den eigenen Platz zu entdecken.
Kapitel 3: Ausgangslage - Worum es konkret ging
Bevor etwas beginnen kann, muss man verstehen, womit man es zu tun hat. In diesem Fall war die Ausgangslage klar – und gleichzeitig offen. Zwei Jugendliche, neu im Land, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen im Gepäck. Ein Fotoatelier, das nicht nur Bilder macht, sondern auch Fragen stellt. Und der Wunsch, etwas zu versuchen, das mehr ist als ein gewöhnliches Praktikum.
Worum es dabei ganz konkret ging – und welche Überlegungen von Anfang an eine Rolle spielten – darum geht es in diesem Kapitel.
Zwei Schüler aus der 9. Klasse – neu in Deutschland, Muttersprache Ukrainisch
Zwei Jugendliche, beide in der neunten Klasse. Erst vor wenigen Monaten nach Deutschland gekommen. Die Sprache war noch ungewohnt, vieles im Alltag fremd, vieles in der Schule zu schnell. Zuhause wurde Ukrainisch gesprochen. In der Schule waren die Inhalte oft schwer greifbar – selbst dann, wenn sie übersetzt wurden.
Beide brachten ganz eigene Stärken mit: Der eine interessierte sich für Technik, war gern handwerklich unterwegs. Der andere beobachtete genau, war sprachlich wach und nahm vieles visuell auf. Was sie verband, war der Wunsch, sich einzubringen. Sie wollten verstehen – nicht nur über Worte, sondern im Tun.
Im Gespräch mit der Schule wurde schnell deutlich: Was sie brauchten, war kein Platz, an dem möglichst viel gleichzeitig passiert. Sondern ein Ort mit Klarheit. Mit verständlicher Sprache. Mit einem Ablauf, der wiedererkennbar ist.
Die Entscheidung, beide Schüler aufzunehmen, war bewusst getroffen. Nicht, weil es einfach war – sondern weil es sinnvoll war. Denn Lernen hat nicht nur mit Inhalten zu tun. Es hat mit Zugehörigkeit zu tun. Und Zugehörigkeit entsteht dort, wo man merkt: Ich werde gesehen. Auch wenn ich noch nicht viel sagen kann.
Unsere gemeinsamen Ziele: Medien-Grundlagen verstehen, Recht und Sicherheit kennen, Worte in Bilder übersetzen
Das Ziel dieses Praktikums war einfach und klar: Die Jugendlichen sollten grundlegende Werkzeuge der Medienarbeit kennenlernen – Kamera, Licht und Ton. Aber nicht im Sinne einer Ausbildung. Es ging nicht darum, alles gleich perfekt zu beherrschen, sondern erst einmal zu verstehen: Was gehört dazu? Wie funktioniert das überhaupt? Und worauf muss man achten, noch bevor man auf den Auslöser drückt?
Genauso wichtig wie die Technik war das Thema Sicherheit. Denn wer mit Bildern oder Tonaufnahmen arbeitet, bewegt sich schnell in einem Bereich, in dem Rechte eine Rolle spielen. Deshalb sprachen wir von Anfang an auch über Persönlichkeitsrechte, über Einverständniserklärungen und über den Schutz von Daten. Nicht, um Angst zu machen. Sondern damit klar ist: Auch das gehört dazu – ganz selbstverständlich.
Ein drittes Ziel war vielleicht nicht sofort sichtbar, aber es war da: Sprache sollte nicht nur erklärt, sondern erlebt werden. Begriffe sollten nicht im Raum stehen bleiben, sondern in Handlung übersetzt werden. Wenn jemand zum Beispiel einen Begriff wie „Lichtverlauf“ hört, soll er ihn nicht nur auswendig lernen. Sondern sehen, was er bedeutet. Und merken, was passiert, wenn man ihn anwendet.
Genau in dieser Verbindung lag der eigentliche Kern des Praktikums: Technik und Sprache, Ausdruck und Verständnis – alles gehört zusammen. Nicht alles auf einmal. Sondern Schritt für Schritt. Verständlich. Wiederholbar. Greifbar.
Unser gemeinsamer Rahmen: Zwei Wochen im Atelier, keine Außen- und Personenaufnahmen
Das Praktikum dauerte zwei Wochen. Montag bis Freitag, jeweils von neun bis fünfzehn Uhr. Dieser feste Tagesablauf war bewusst so gewählt. Er gab Halt, half bei der Orientierung – und machte es möglich, nach und nach eine gewisse Verlässlichkeit im Alltag aufzubauen. Das ist besonders dann wichtig, wenn Sprache und Umgebung noch ungewohnt sind.
Der Ort war das Atelier selbst. Kein Außendreh, keine Aufnahmen auf der Straße, keine Porträts von anderen Menschen. Das war kein Zufall, sondern Teil des Konzepts. Denn bevor man eine Kamera auf andere richtet, sollte man erst einmal verstehen, wie sie funktioniert – und was man mit ihr auslöst. Es ging darum, Verantwortung zu spüren, Technik zu begreifen – und auch sich selbst besser kennenzulernen.
Der Schwerpunkt lag daher auf Übungen, die man im Raum umsetzen konnte. Auf kleinen Szenen. Auf wiederholbaren Abläufen. Auf dem Aufbau von technischem Wissen und wachsendem Zutrauen. Es gab keine gestellten Porträts, sondern Stillleben. Keine fertigen Filmaufnahmen, sondern erste Entwürfe – zum Beispiel in Form kleiner Bildgeschichten oder Skizzen mit Kamera und Licht.
Diese Zurückhaltung war keine Einschränkung, sondern eine Möglichkeit. Sie machte es leichter, das Medium in Ruhe kennenzulernen – ohne gleich etwas produzieren zu müssen, das fertig oder vorzeigbar ist.
Es entstand Raum. Raum, um zu entdecken, wie Gestaltung funktioniert. Raum, um erste eigene Entscheidungen zu treffen – in zwei Sprachen, in kleinen Schritten, auf einem Weg, der sich entwickeln durfte.
Kapitel 4: Warum „Theorie zuerst“
Man könnte meinen, ein Praktikum sollte möglichst praktisch beginnen – am besten gleich mit Kamera in der Hand. Doch in diesem Fall war der Weg ein anderer. Ganz bewusst. Denn bevor man etwas gut machen kann, muss man verstehen, was man da eigentlich tut. Deshalb stand am Anfang nicht das Machen, sondern das Verstehen.
Warum diese Entscheidung getroffen wurde, was sie möglich gemacht hat – und warum sie mehr gebracht hat als man auf den ersten Blick sieht – darum geht es in diesem Kapitel.
Sprache ist eine Hürde und Fachbegriffe sind schwer
Von Anfang an war klar: Sprache ist mehr als nur ein Mittel, um sich abzusprechen. Sie war die eigentliche Herausforderung. Denn selbst wer im Alltag schon erste Wörter auf Deutsch versteht, stößt schnell an Grenzen, sobald es um Fachbegriffe geht.
Wörter wie „Blende“, „ISO“, „Weißabgleich“ oder „Datenschutz“ sind nicht nur neu, sie klingen oft fremd, unverständlich – oder sie bedeuten im Alltag etwas ganz anderes als im technischen Zusammenhang.
Solche Begriffe können leicht ausgrenzen. Besonders dann, wenn sie einfach so genannt werden, ohne Erklärung. Wer nicht folgen kann, fühlt sich schnell unsicher. Und wer sich unsicher fühlt, zieht sich oft zurück – ganz leise, ohne dass es jemand gleich merkt.
Deshalb war früh klar: Bevor wir mit Kamera oder Ton arbeiten, muss eine gemeinsame sprachliche Grundlage gelegt werden. Ein Raum,
in dem man Fachwörter nicht bestehen muss, sondern
in dem sie erklärt, ausprobiert und gemeinsam verstanden werden,
in dem man nachfragen darf, ohne sich zu schämen,
in dem Wiederholen dazugehört,
und in dem es erlaubt ist, ein Wort zu vergessen – ohne das Gefühl zu haben, man sei nicht gut genug.
In den ersten Tagen zeigte sich sehr deutlich: Sprache ist nicht nur Werkzeug. Sie schafft auch Stimmung. Wenn sie verstanden wird, entsteht Vertrauen. Wenn sie überfordert, entsteht Distanz. Und genau das wollten wir vermeiden.
Theorie schafft ruhige Räume – Zeit zum Erklären, Zeit zum Wiederholen
Sobald man in die Praxis geht, wird vieles schnell. Es entstehen Abläufe. Entscheidungen müssen getroffen werden. Man muss reagieren, mitdenken, umsetzen. Das kann spannend sein – aber eben auch anstrengend. Vor allem dann, wenn die Sprache noch fremd ist und die Umgebung ungewohnt.
Theorie schafft einen anderen Raum. Einen ruhigeren. Einen, in dem man erst einmal klären kann, worum es eigentlich geht. Was ein bestimmter Begriff bedeutet. Warum man eine Sache so und nicht anders macht. Und wie sich alles miteinander verbindet.
Im Praktikum war die Theorie kein trockener Pflichtteil. Sie war bewusst als Schutzraum gedacht – als ein Ort, an dem man langsamer denken durfte. Hier konnten wir Inhalte in Ruhe anschauen, Beispiele finden, Begriffe besprechen. Fehler gehörten dazu. Sie galten nicht als Störung, sondern als Teil des Lernens.
Wiederholung spielte dabei eine große Rolle. Denn wer neu ist in Sprache und Inhalt, braucht mehr als eine Erklärung. Manches blieb am ersten Tag noch unklar – und konnte am dritten oder fünften Tag wieder aufgegriffen werden. Ohne Druck. Ohne Wertung.
So wurde die Theorie nicht zum Gegensatz zur Praxis. Sondern zu einer festen Grundlage. Eine Bühne, auf der Verständnis wachsen durfte – Schritt für Schritt, in zwei Sprachen, mit Zeit und mit Geduld.
Sicherheit & Recht – zuerst verstehen, dann anwenden
Sobald man eine Kamera auf Menschen richtet, geht es nicht mehr nur um Technik oder Bildgestaltung. Es geht auch um Verantwortung. Darf ich diese Person überhaupt aufnehmen? Muss ich vorher fragen? Und was genau bedeutet es eigentlich, wenn jemand „Ja“ sagt?
Gerade im schulischen oder pädagogischen Bereich dürfen solche Fragen nicht nebenbei behandelt werden. Sie gehören in den Mittelpunkt. Denn Neugier auf Technik ist gut – aber sie darf nicht über das hinweggehen, was rechtlich wichtig ist.
Deshalb war früh klar: Es gibt keine Aufnahmen von Personen, bevor diese Themen besprochen wurden. Bevor ein Bild entsteht, muss Klarheit herrschen.
Was ist mit dem Datenschutz? Was bedeutet das „Recht am eigenen Bild“? Wo verlaufen Grenzen – und wie spürt man, wann man sie berührt?
In der Theorie war Raum für all diese Fragen. Ohne Zeitdruck. Mit Beispielen. Und immer in zwei Sprachen, damit niemand ausgeschlossen ist.
Dabei ging es nicht um juristische Fachbegriffe, sondern um ganz praktische Überlegungen: Was heißt das für mich? Was ist erlaubt – und wo wird es heikel?
Erst wenn diese Grundlagen wirklich verstanden sind, kann die Kamera zu einem Werkzeug werden, das verbindet – und nicht verletzt.
Erst verstehen, dann machen – so wächst Mut
Wer etwas wirklich verstanden hat, traut sich eher, es auszuprobieren. Dieser einfache Zusammenhang war die Grundlage für den Aufbau des Praktikums. Denn Mut entsteht nicht durch Druck. Er wächst, wenn man sich orientieren kann. Wenn man nicht einfach etwas tun soll, sondern weiß, worum es geht.
Die Theorie war dabei der Anfang. Sie ermöglichte einen Einstieg, der nicht überfordert. Einen Raum, in dem man sich annähern konnte – ohne sofort etwas leisten zu müssen. Man konnte zuhören, mitdenken, nachfragen. Auch mal still bleiben. Und trotzdem lernen.
Im Atelier zeigte sich schnell: Mit jeder geklärten Vokabel, mit jeder kleinen Skizze, mit jedem Wort, das im richtigen Moment passte, wuchs das Zutrauen. Die Blicke wurden sicherer. Die Fragen genauer. Die Entscheidungen klarer.
So entstand Schritt für Schritt ein Boden, auf dem praktische Arbeit möglich wurde – nicht hektisch, sondern gezielt. Aus Verstehen wurde Handeln. Und aus Handeln entstand ein Gefühl: Ich kann etwas bewirken.
Kapitel 5: Didaktische Entscheidung - Einfach und zweisprachig
Wenn Sprache nicht selbstverständlich ist, braucht Lernen eine andere Form. Es reicht dann nicht, Inhalte zu erklären – man muss sie zugänglich machen. In diesem Praktikum war von Anfang an klar: Es braucht einfache Worte, eine klare Struktur und vor allem: zwei Sprachen. Nicht als Kompromiss, sondern als Brücke. Denn wer etwas verstehen soll, muss sich angesprochen fühlen – auch sprachlich.
Einfache Sprache – kurze Sätze, aktive Verben, ein Gedanke pro Satz
Sprache kann tragen – oder sie kann stolpern. Besonders dann, wenn zwei Sprachen nebeneinanderstehen, neue Begriffe auftauchen und das Thema selbst schon anspruchsvoll ist. Genau deshalb wurde von Anfang an auf einfache Sprache gesetzt. Nicht, um Inhalte zu vereinfachen – sondern um sie klarer zu machen.
Die Regeln waren einfach: Ein Satz, ein Gedanke. Keine unnötigen Nebensätze, keine Ketten aus Fachbegriffen. Stattdessen kurze, klare Sätze. Mit aktiven Verben. Mit Worten, die man verstehen kann, ohne lange überlegen zu müssen. Nicht banal, aber verständlich.
Diese Entscheidung war mehr als Stil. Sie war Teil der Methode. Denn wer lernen soll, muss sprachlich mitkommen. Nur dann kommt auch der Inhalt an. Auch schwierige Themen – etwa Kameratechnik, Lichtführung oder rechtliche Fragen – lassen sich gut erklären, wenn man sie Schritt für Schritt ordnet. Und wenn man bereit ist, sich auf das Tempo der Lernenden einzulassen.
Einfache Sprache war in diesem Praktikum kein Notbehelf. Sie war eine Einladung. Eine stille Botschaft: Du musst nicht alles wissen. Aber du darfst alles verstehen. Und du darfst fragen – jederzeit.
So wurde Sprache nicht zur Hürde. Sondern zur Brücke. Zwischen Begriff und Bild. Zwischen Gedanke und Handlung. Zwischen zwei Sprachen, zwei Welten – und zwei Menschen, die bereit waren zu lernen.
UA / DE – erst die Muttersprache, dann das Deutsche
Von Anfang an galt eine klare Reihenfolge: Zuerst wird in der Muttersprache erklärt – dann folgt das Deutsche. Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Überzeugung. Denn wer zuerst in der eigenen Sprache versteht, kann das Neue gezielter aufnehmen. Wenn man zu früh wechselt, bevor etwas wirklich angekommen ist, entsteht oft Unsicherheit. Und manchmal auch Rückzug.
Deshalb wurde jeder neue Begriff, jedes Thema, jedes Handblatt zuerst auf Ukrainisch erklärt. Erst danach kam das Deutsche dazu – begleitet von Beispielen, kurzen Sätzen und Bildern. So entstand eine Verbindung zwischen dem Vertrauten und dem Neuen. Zwischen dem inneren Verstehen – und dem äußeren Benennen.
Damit es nicht zu viel auf einmal wurde, galt eine feste Regel: Zehn neue Begriffe pro Tag – nicht mehr. Das brachte Ruhe in den Lernprozess. Es gab Zeit, jeden Begriff zu wiederholen, auszusprechen und aufzuschreiben. Und ihn in einen Satz zu setzen. Jeder neue Ausdruck wanderte ins eigene Glossar – zweisprachig, parallel geführt.
So wuchs der Wortschatz nicht einfach in die Breite – sondern in die Tiefe. Die Jugendlichen schrieben mit der Hand. Und verankerten es im Kopf.
Dieses Prinzip – erst Ukrainisch, dann Deutsch – war mehr als eine sprachliche Entscheidung. Es war eine Art zu denken: Erst Herkunft, dann Ankommen. Erst Sicherheit, dann Übergang. Erst Verstehen – dann Sprache.
Begriff = Bild = Satz – Fachsprache anschaulich machen
Ein einzelnes Wort reicht oft nicht aus, um wirklich zu verstehen, worum es geht. Das gilt besonders dann, wenn das Wort neu ist, aus einer anderen Sprache kommt oder mehrere Bedeutungen haben kann. Deshalb wurde im Praktikum jeder Fachbegriff auf drei Arten erklärt: als Wort, als Bild und als Satz.
Das Vorgehen war einfach: Ein technischer Begriff wurde nicht nur gesprochen oder geschrieben – sondern auch sichtbar gemacht. Für jeden Ausdruck gab es eine kleine Zeichnung, die die Grundidee verdeutlichte. Dazu kam ein kurzer Beispielsatz, leicht verständlich und in einfachem Deutsch. Und wenn es passte, wurde der Begriff auch gleich im Alltag angewendet.
Ein Beispiel: Das Wort „ISO“. Es wurde nicht nur als Einstellung an der Kamera beschrieben, sondern mit einem Bild verbunden – zum Beispiel einem Auge, das bei Dunkelheit weiter offen ist. Der Satz dazu lautete: „Hohe ISO macht das Bild heller – aber es kann auch anfangen zu rauschen.“ Ergänzt wurde das Ganze durch eine praktische Frage: „Wie hell ist es im Raum – und was bedeutet das für die Kameraeinstellung?“
Dieses Zusammenspiel half, abstrakte Wörter begreifbar zu machen. Das Bild schuf einen Anker fürs Erinnern. Der Satz zeigte, wie das Wort im Zusammenhang klingt. Und das Beispiel holte den Begriff in die Wirklichkeit.
So wurde diese Dreiteilung – Begriff, Bild, Satz – zu einer stillen Grundlage im Lernalltag. Niemand musste sie ständig benennen. Aber sie war da. Und sie wirkte. Denn Sprache muss nicht einfacher sein, um verstanden zu werden. Sie muss ankommen – im Kopf, im Bild und im gesprochenen Satz.
Handouts – zweisprachig gespiegelt, klar gegliedert, praxisnah
Damit das, was besprochen wurde, nicht gleich wieder verloren geht, war schriftliches Material ein wichtiger Teil des Praktikums. Zu jedem Thema gab es einen eigenen Handzettel – zweisprachig gestaltet, übersichtlich aufgebaut. Auf der einen Seite stand der Text auf Ukrainisch, auf der anderen auf Deutsch. Keine langen Absätze, kein Kleingedrucktes. Stattdessen: klar gegliederte Stichpunkte, kleine Zeichnungen, einfache Beispiele.
Die Themen reichten von rechtlichen Grundlagen über Kamera, Licht und Ton bis hin zur Bildabfolge und Planung. Jeder Abschnitt enthielt die wichtigsten Begriffe – in beiden Sprachen. Dazu ein Beispielsatz, ein Bild zur Orientierung und Platz für eigene Notizen oder Fragen. Die Handzettel waren so gemacht, dass man sie mitnehmen, ergänzen und immer wieder anschauen konnte.
Diese gespiegelt zweisprachige Form hatte einen großen Vorteil: Man konnte selbst vergleichen, ohne ständig nachzufragen oder im Wörterbuch zu blättern. Alles stand nebeneinander – in gleichem Umfang, mit gleichem Wert. Das zeigte: Beide Sprachen zählen. Beide dürfen benutzt werden. Beide helfen beim Lernen.
Im Laufe der zwei Wochen wurden die Handzettel nicht nur gelesen, sondern auch weiterbearbeitet. Man schrieb etwas dazu, unterstrich wichtige Stellen oder zeichnete kleine Skizzen. So wurden aus Vorlagen persönliche Arbeitsmittel – mit eigener Handschrift.
Kapitel 6: Tagesrhythmus - So haben wir gearbeitet
Ein guter Tag beginnt nicht mit einem Plan, sondern mit einem guten Gespräch. Gerade dann, wenn vieles neu ist – Sprache, Umgebung, Aufgaben – gibt ein fester Ablauf Sicherheit. Im Praktikum war deshalb nicht nur wichtig, was gelernt wurde, sondern auch: wann, wie und in welchem Tempo. Der Tagesrhythmus half dabei, Ruhe in den Alltag zu bringen – und machte das Lernen berechenbar, wiederholbar, verlässlich.
Struktur schafft Sicherheit – besonders, wenn vieles noch fremd ist
Wenn man neu ist – in einem Land, in einer Sprache, in einem Umfeld – dann hilft Struktur. Sie schafft Sicherheit. Deshalb folgte das Praktikum einem klaren Tagesrhythmus. Kein starrer Stundenplan, sondern ein verlässlicher Ablauf, der jeden Tag ordnete – und dabei genügend Spielraum ließ für das eigene Tempo, für Pausen, für Wiederholung.
Wiederholung war nicht nur erlaubt, sie war gewollt. Sie war Teil der Methode. Denn was man heute nur halb versteht, kann morgen schon vertrauter klingen – wenn man es noch einmal hört, noch einmal liest, noch einmal sagt.
Jede Einheit des Tages hatte ihren festen Platz. Und ihren Sinn im Gesamtbild. Der Ablauf blieb gleich – die Inhalte wechselten. So entstand ein Rahmen, in dem sich Lernen entfalten konnte, ohne zu überfordern.
Ankommen: Sprache als Anfang
Der Tag begann nicht mit einem Gong oder einer Ansage, sondern mit einem bewussten Start: einer kurzen Begrüßung, einem Blick auf das Thema des Tages – ruhig, verständlich, in beiden Sprachen. Was steht heute im Mittelpunkt? Was wollen wir am Ende des Tages verstanden haben?
Gleich zu Beginn wurden fünf bis zehn neue Begriffe eingeführt – nicht als Vokabelliste, sondern als Teil des Alltags. Die Jugendlichen schrieben die Wörter mit der Hand auf, sprachen sie laut aus, setzten sie in eigene Sätze. So wurde Sprache sofort lebendig – und nicht nur ein Nebenprodukt des Lernens, sondern sein Ausgangspunkt.
Kurzer Input: Verständlich, visuell unterstützt
Danach folgte ein thematischer Einstieg – kein Vortrag, sondern ein kurzer Impuls. Meist begleitet durch Skizzen, kleine Zeichnungen, Übersichten oder einfache Abläufe auf dem Papier. Es ging nicht um vollständige Wissensvermittlung, sondern um einen Zugang. Was ist neu? Was lässt sich an Bekanntes anknüpfen? Welche Fragen könnten sich ergeben?
Die Sprache blieb dabei einfach. Jeder Begriff wurde erklärt, verglichen, in einem Satz gezeigt. Und oft gleich mit einer kleinen Zeichnung oder Metapher versehen. So konnten die Lernenden nicht nur hören, sondern auch sehen und mitdenken.
Trockenübung: Erst Denken, dann Technik
Bevor Kamera oder Tonaufnahme zum Einsatz kamen, wurde erst einmal am Tisch gearbeitet – mit Papier, Stift, kleinen Modellen. Eine sogenannte „Trockenübung“, in der das Gelernte angewendet, aber noch nicht technisch umgesetzt wurde.
Diese Phase war entscheidend. Denn sie zeigte: Auch das Durchdenken eines Ablaufs ist eine praktische Handlung. Hier konnte man ausprobieren, Fehler machen, neu sortieren – ganz ohne Zeitdruck. Oft entstanden dabei erste Skizzen für Bildfolgen, kleine Szenenaufbauten oder Ablaufpläne.
Sprachwerkstatt: Gemeinsam lesen, sprechen, verstehen
Ein fester Bestandteil des Tages war die Sprachwerkstatt. Hier wurde laut gelesen, gemeinsam übersetzt und in leichtes Deutsch übertragen. Diese Phase diente nicht nur dem Wortschatz, sondern auch dem Gefühl für Sprache. Wo liegt die Betonung? Wie klingt ein Satz? Wie verändert sich ein Fachwort, wenn es in einen Alltagssatz eingebettet wird?
Es wurde verglichen, umgestellt und ausprobiert. Die Jugendlichen merkten: Sprache ist formbar. Und sie entdeckten: Sie können mitgestalten. Auch Fachsprache.
Mini-Quiz: Wiederholung ohne Druck
Am Ende der inhaltlichen Phase kam ein kleines Quiz – drei bis fünf Fragen zum Tag. Keine Prüfung. Kein Test. Sondern ein Rückblick: Was ist hängen geblieben? Was ist noch unklar? Die Fragen waren offen gestellt. Man konnte zeichnen, schreiben, erzählen – ganz nach Stärke. Es ging nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um das eigene Verständnis.
Artefakt des Tages: Etwas in der Hand, etwas im Kopf
Jeder Tag endete mit einem kleinen Produkt – einem sogenannten Artefakt. Das konnte ein Einseiter sein, ein Notizzettel, ein kurzer Text, ein gezeichneter Ablauf oder eine Bildbeschreibung. Etwas, das sichtbar machte, was gedacht und gelernt worden war.
Diese Artefakte wurden nicht bewertet. Sie waren individuell – und manchmal überraschend kreativ. Sie gaben den Jugendlichen das Gefühl: Ich habe heute etwas geschaffen. Etwas Eigenes. Etwas, das bleibt.
60-Sekunden-Präsentation: Sich zeigen, sich hören
Zum Abschluss gab es jeden Tag eine kurze Vorstellung des eigenen Beitrags – zuerst auf Ukrainisch, dann auf Deutsch. Maximal eine Minute. Diese kleine Präsentation hatte große Wirkung: Sie stärkte das Selbstvertrauen. Sie ließ die Jugendlichen erleben, dass sie etwas sagen können. Dass sie gehört werden. Und dass ihre Stimme zählt.
Ein Konzept, das trägt
So entstand über die zwei Wochen ein Rhythmus, der Orientierung bot, aber nicht einengte. Der Sicherheit gab, ohne Druck zu machen. Und der am Ende nicht nur Wissen vermittelt hat – sondern auch Vertrauen. In sich selbst. In Sprache. Und in das gemeinsame Lernen.
Kapitel 7: Was entstanden ist – Sichtbare Ergebnisse
Am Ende von zwei Wochen Praktikum stand nicht nur ein voller Notizblock. Es gab auch Dinge, die man sehen, anfassen und zeigen konnte. Kleine Ergebnisse, die deutlich machten: Hier wurde nicht nur geredet, sondern gearbeitet. Es ging nicht um Perfektion, sondern um Entwicklung. Um sichtbare Spuren von Lernen, Ausprobieren und Mitgestalten. In Bildern, in Texten, in Skizzen – und in der wachsenden Sicherheit, mit der zwei Jugendliche sich ausdrücken konnten. Genau darum geht es in diesem Kapitel.
Lernen wird dann sichtbar, wenn es Spuren hinterlässt. Nicht in Form von Noten oder Bewertungen, sondern durch Dinge, die bleiben. In diesem Praktikum war von Anfang an klar: Jeder Tag sollte etwas hinterlassen, das nicht nur dokumentiert, sondern auch mitgenommen werden kann – sprachlich, gestalterisch und inhaltlich.
A: Einseiter „Sicherheit & Recht“ (UA/DE)
Eines der ersten Ergebnisse war ein zweiseitiger Überblick zu wichtigen Grundlagen: Persönlichkeitsrechte, Einwilligung, Datenschutz und Verhalten im Atelier. Der Inhalt war gegliedert nach klaren Fragen wie „Was darf ich?“ und „Was darf ich nicht?“. Symbole halfen beim Verstehen. Die Texte standen auf Ukrainisch und auf Deutsch – nebeneinander. So wurde das Thema Recht nicht nur verständlich gemacht, sondern diente auch als Gesprächsgrundlage über Verantwortung.
B: Spickzettel „Kamera-Licht-Ton“ (UA/DE)
Technik kann abschrecken – oder sie kann durch Klarheit zugänglich werden. Der Spickzettel war eine Hilfe im Alltag: ISO, Blende, Weißabgleich, Mikrofontypen, Lichtquellen, Geräuschpegel – alles kurz erklärt, mit Symbolen versehen und mit Beispielsätzen ergänzt. Die Vorderseite auf Deutsch, die Rückseite auf Ukrainisch. Klein im Format, groß im Nutzen: ein Werkzeug zum schnellen Nachschlagen.
C: Mini-Storyboard mit 6 Feldern und 6 Bildunterschriften (UA/DE)
Ein Höhepunkt der zweiten Woche war die Arbeit an einem eigenen Mini-Storyboard. Sechs Felder – gezeichnet oder mit kleinen Icons bestückt – bildeten eine einfache Bildfolge. Dazu kamen kurze Unterschriften. Erst auf Ukrainisch, dann sinngemäß ins Deutsche übertragen. So wurde aus einer kleinen Idee eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Schluss. Technisch einfach – aber erzählerisch präzise.
D: Zwei Teaser – für jung und alt (UA/DE)
Zum Abschluss verfassten die Jugendlichen je zwei Teasertexte: einen für ein jüngeres Publikum, einen für ein älteres. Drei bis vier Sätze sollten reichen, um das Praktikum zu beschreiben. Die Aufgabe war einfach – aber fordernd: Was war wichtig? Was soll hängen bleiben? Die Texte entstanden zuerst auf Ukrainisch, wurden dann ins Deutsche übertragen – nicht Wort für Wort, sondern sinngemäß. Das Ergebnis: direkte, klare Aussagen mit persönlichem Bezug.
Glossar – 80 Begriffe, zweisprachig geführt
Parallel zu allen Aufgaben entstand ein zweisprachiges Glossar. Mehr als 80 Begriffe – sortiert nach Themen, mit einfachen Erklärungen, ergänzt durch kleine Zeichnungen und Beispielsätze. Jeder Begriff wurde mehrfach geübt: beim Tagesstart, beim Input, beim Quiz, in der Präsentation. Das Glossar wuchs Tag für Tag – und wurde so zu einem sichtbaren Spiegel des Lernprozesses.
Diese Materialien zeigten am Ende: Lernen kann langsam sein – und trotzdem viel hervorbringen. Wenn Sprache ernst genommen wird. Wenn Wiederholung erlaubt ist. Und wenn man sich traut, Fragen zu stellen.
Kapitel 8: Wo es schwer war – und wie wir reagiert haben
Nicht alles lief glatt. Und das war auch nicht zu erwarten. Denn wo Neues entsteht, entstehen auch Unsicherheiten. Manche Schwierigkeiten waren vorhersehbar, andere zeigten sich erst im Tun. Sprache, Konzentration, Müdigkeit, Missverständnisse – all das spielte eine Rolle. Wichtig war nicht, alles sofort zu lösen. Wichtig war: aufmerksam bleiben, offen reagieren, gemeinsam nach Wegen suchen. In diesem Kapitel geht es darum, wo es gehakt hat – und was daraus gelernt wurde.
Fachwörter – Lösung: Icon + Kurzsatz + Beispiel
Fachsprache ist kein Selbstzweck. Doch sobald es um Medien, Technik und Gestaltung geht, begegnet man ihr fast überall: Blende, ISO, Tonpegel, Weißabgleich, Kondensatormikrofon, Vorderlicht. Solche Begriffe sind präzise – aber gerade das macht sie schwer zugänglich. Für Lernende mit wenig Vorerfahrung, und besonders für jene, die erst dabei sind, eine neue Sprache zu lernen, werden diese Begriffe schnell zu Barrieren.
Ein Begriff = ein Bild = ein Satz. Jedes neue Fachwort wurde auf drei Ebenen eingeführt: ein Icon, ein kurzer Beispielsatz und ein konkreter Anwendungskontext. Diese drei Elemente wurden immer gemeinsam eingeführt – im Dialog, mit Skizzen, Nachsprechen und Szenen. Die Begriffe wanderten sofort ins Glossar, zweisprachig und mit Symbolen ergänzt.
Das Ergebnis: Die Hemmung, Fragen zu stellen, ließ nach. Fachbegriffe tauchten im Quiz, in Präsentationen und in Storyboards auf. Sie waren Teil des eigenen Werkzeugkastens geworden – nicht überfordert gelernt, sondern in kleinen Schritten aufgebaut.
Verwechslungen – Lösung: Kontextsatz und Warnhinweis „Falscher Freund“
Neben unbekannten Begriffen stellten sich auch vermeintlich bekannte Wörter als Stolpersteine heraus – sogenannte falsche Freunde. Sie erzeugten Sicherheit, führten aber zu Missverständnissen. Ein Beispiel war ISO: in der Fotografie ein Wert für Lichtempfindlichkeit, in anderen Kontexten eine Abkürzung für Normung.
Die Lösung war ein Warnhinweis ⚠️ in Glossar und Handouts, ergänzt durch Kontext-Sätze: „ISO bei der Kamera ist ein Helligkeitswert – keine Regel oder Norm.“ So entstand ein Bewusstsein für Sprachfallen. Die Jugendlichen begannen selbst, Begriffe zu hinterfragen.
Zweisprachigkeit kostet Zeit – Lösung: kleines Tempo, klare Rollen, 10-Begriffe-Regel
Zweisprachig zu arbeiten ist ein Gewinn – aber es braucht Zeit. Jede Erklärung dauerte länger, da Sprache nicht nur übersetzt, sondern gedeutet werden musste. Mal war das Deutsche schneller, mal das Ukrainische. Es brauchte Pausen – und Geduld.
Die Entscheidung: langsameres Tempo, dafür mehr Klarheit. Maximal zehn neue Begriffe pro Tag, sofort im Glossar festgehalten und wiederholt. Klare Rollen halfen: Wer erklärt? Wer übersetzt? Wer fasst zusammen? Diese Rollen wechselten und gaben Balance.
Am Ende ging es um mehr als Worte: um Vertrauen, Zeit zu haben, und das Zutrauen, sich in beiden Sprachen bewegen zu lernen. Verständigung braucht nicht Geschwindigkeit, sondern Sorgfalt.
Nur Theorie wirkt abstrakt – Lösung: Storyboard & Captions als Praxis geplant
Theorie allein wirkt abstrakt. Nach Tagen voller Fachbegriffe und rechtlicher Grundlagen entstand die Gefahr, dass das Tun fehlte. Die Lösung: kleine Zwischenergebnisse wie Mini-Storyboards mit Bildunterschriften, zweisprachig geführt. Sie verbanden Sprache mit Bildlogik, machten Entscheidungen sichtbar und nachvollziehbar.
Parallel dazu wurden praxisnahe Aufgaben im Atelier vorbereitet: Stillleben mit Alltagsgegenständen, Tonaufnahmen ohne Sprecher, Lichtaufbau im Raum. Keine Außenaufnahmen, keine Porträts – aber reale Handgriffe, echtes Equipment.
So entstand eine Umgebung, in der Theorie in Handlung überging – kontrolliert, begreifbar, selbstbestimmt.
Kapitel 9: Warum das gelingt – Meine Beobachtung
Wenn etwas gelingt, liegt das selten nur an einem einzelnen Baustein. Meist ist es das Zusammenspiel: aus Sprache, Struktur, Vertrauen und Zeit. Im Rückblick auf das Praktikum zeigt sich, dass nicht die Methode allein entscheidend war – sondern die Einstellung, mit der sie umgesetzt wurde. Was wirklich zählt, sind kleine, aufmerksame Schritte. Eine klare Sprache, die niemanden ausgrenzt. Ein Alltag, der Platz lässt fürs Fragen. Und ein Miteinander, in dem sich niemand verstecken muss.
Langsam ist schnell genug. Verständnis ist wichtiger als Tempo.
Wer langsam geht, kommt oft weiter. Denn echtes Verstehen braucht Zeit. Wer sich orientieren will – sprachlich, inhaltlich, menschlich – braucht Raum. Raum zum Nachfragen, zum Wiederholen, zum Selber-Denken.
Im Praktikum war das immer wieder zu spüren. Sobald der Impuls kam, schnell zum nächsten Thema überzugehen, lohnte sich ein Moment des Innehaltens. Dieser führte zu besserem Verständnis. Die Jugendlichen konnten sich neue Begriffe besser merken, wenn sie Zeit bekamen, eigene Worte zu finden – zuerst auf Ukrainisch, dann auf Deutsch.
Schnelles Lernen bringt manchmal schnelle Ergebnisse. Aber was bleibt wirklich hängen? Lernen, das trägt, entsteht nicht im Tempo, sondern in der Tiefe. Und Tiefe braucht Geduld.
So entstand ein Lernumfeld, das nicht auf Masse setzte, sondern auf Bedeutung. In dieser Ruhe wuchs das, was wirklich zählt: Sicherheit, Vertrauen in sich selbst, das Gefühl, beteiligt zu sein.
Am Ende stellte sich nicht die Frage: Wie viel Stoff haben wir geschafft? Sondern: Wer hat sich was zu eigen gemacht?
Bilder helfen. Ein Wort mit einer Skizze bleibt hängen.
Worte brauchen Bilder. Ein kleines Icon, eine Skizze, ein kurzer Linienverlauf – oft genügte schon eine einfache Zeichnung, damit ein Begriff Sinn bekam.
Beispiel: das Wort „Blende“. Solange es nur gesagt wurde, blieb es abstrakt. Doch mit einer Zeichnung – ein Kreis einmal weit, einmal eng geöffnet – war sofort klar: mehr Licht, weniger Licht. Die Bedeutung war nicht nur gehört – sie war gesehen.
Mit der Zeit begannen die Jugendlichen selbst zu zeichnen: kleine Skizzen, Pfeile, Kreise, Figuren. Es waren Werkzeuge, keine Kunstwerke. So wuchsen Sprache und Bild zusammen – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung.
Zwei Sprachen sind eine Brücke. Erst Heimat, dann Ankunft.
Zwei Sprachen bedeuten nicht doppelte Mühe – sondern doppelte Möglichkeit. Sprache gibt Sicherheit, verbindet mit dem Vertrauten und öffnet Wege ins Neue. Deshalb begann vieles auf Ukrainisch, erst danach folgte Deutsch – nicht als Korrektur, sondern als Erweiterung.
Es ging nicht um Übersetzung, sondern um Bedeutung. Manchmal war das deutsche Wort schneller, manchmal das ukrainische. Fehler waren erlaubt. Sätze mussten nicht perfekt sein. Oft halfen die Jugendlichen einander und schufen gemeinsam Bedeutung.
So entstand kein Unterricht, sondern ein Prozess. Ukrainisch gab Halt, Deutsch zeigte Möglichkeiten. Zwischen beiden Sprachen wuchs Vertrauen: dass man hier richtig ist – auch mit Akzent, auch mit Lücken, auch mit eigenen Worten.
Sichtbare Artefakte machen stolz – und sind prüfbar für Schule und Eltern.
Lernen braucht Zeit. Doch Rückmeldungen müssen sichtbar sein. Deshalb entstanden klare Zwischenergebnisse: ein Einseiter „Recht und Sicherheit“, Spickzettel zu Kamera-Licht-Ton, ein Storyboard mit Bildunterschriften, kurze Teasertexte – alles zweisprachig.
Diese Materialien machten die Arbeit nachvollziehbar und gaben den Jugendlichen ein Gefühl von Fortschritt. Ein Zettel wurde zum Beweis: Das habe ich gemacht.
Das stärkte das Vertrauen ins eigene Können, machte Mut weiterzumachen und zeigte: Auch kleine Schritte führen zu Ergebnissen, die zählen.
Am Ende lag nichts Aufwändiges auf dem Tisch – aber etwas Echtes. Etwas Gedachtes, Verstandenes, Gestaltetes. Und genau das macht den Unterschied.
Kapitel 10: Nächster Schritt – Wie wir weitergehen
Ein gelungenes Praktikum ist kein Schlusspunkt, sondern ein Anfang. Die zwei Wochen im Atelier haben gezeigt, was möglich ist, wenn Sprache, Struktur und Zeit zusammenkommen. Sie haben nicht alles gelöst, aber sie haben etwas angestoßen: ein gemeinsames Lernen, das verständlich, greifbar und respektvoll war.
Was nun folgt, ist kein fertiger Plan, sondern eine Richtung. Die Erfahrungen aus dem ersten Versuch sollen weitergetragen werden – angepasst, erweitert, überprüft. Nicht als fertiges Konzept, sondern als Einladung zum Weiterdenken: Was braucht es, damit Integration gelingt? Was hilft, damit Sprache verbindet? Wie können kreative Räume dazu beitragen?
Kleine Innenraum-Übungen
Stillleben fotografieren: Alltagsdinge wie Apfel, Werkzeug, Tasse. Fokus auf Schatten, Farbe, Abstand, Licht. Es geht ums genaue Hinschauen – nicht um schöne Bilder.
Kurzer Ton aufnehmen: Geräusch, Raumton oder Bewegung. Unterschiedliche Mikro-Positionen zeigen: Ton hängt stark vom Raum ab.
Drei Mini-Clips: wenige Sekunden, ein Objekt rollt, Licht verändert sich, Kamera bewegt sich. Ziel: Planung und Beschreibung des eigenen Vorgehens.
Alle Übungen erfordern keine Vorerfahrung, sondern Aufmerksamkeit. Aus Begriff, Bild und Technik wird Handlung. Ergebnisse sind klein, aber echt – und zeigen: Ich habe etwas gemacht. Ich weiß, was ich da gemacht habe.
Aufbaukurse
Die nächsten Schritte bleiben einfach, überschaubar, machbar – mit klaren Zielen.
Aufgabe 1: Filmen im Raum. Mini-Storyboard, 20–30 Sekunden Clip, 3–6 Einstellungen. Kamera bleibt ruhig. Ein bis zwei kurze Clips + Reflexion: Was war die Idee? Was hat funktioniert?
Aufgabe 2: Untertitel DE/UA. Kurzer Clip mit Untertiteln in beiden Sprachen. Keine langen Sätze, Glossar hilft. Ergebnis: Clip + Prüfliste (Lesbarkeit, Timing, Verständlichkeit).
Aufgabe 3: Kleines Interview. Mit Einverständnis-Formular. Kurze Fragen, ruhige Aufnahme. Ziel: ehrliches, einfaches Gespräch (60–90 Sekunden) + Reflexion.
Am Ende jedes Kurses: ein Clip, eine Untertiteldatei, ein Interview-Ausschnitt – begleitet von einem kurzen Lerntagebuch.
Teilen mit der Stadt
Was im Atelier entsteht, soll sichtbar werden. Mit einem digitalen Schaukasten im Fenster und einer zweisprachigen Website (DE/UA) in einfacher Sprache.
Schaufenster: 32-Zoll-Bildschirm zeigt Ergebnisse (Einseiter, Spickzettel, Storyboards, Clips). QR-Code führt zur Website.
Website: einfache Fragen („Was ist das?“, „Wer macht mit?“, „Was kann man sehen?“), Beispiele mit Foto/Clip + 2–4 Sätzen. Barrierefrei: Alt-Texte, Untertitel, klare Struktur.
Datenschutz: Keine Personenaufnahmen ohne Zustimmung. Keine Klarnamen ohne Wunsch. Keine sensiblen Daten.
Ablauf: 1× pro Monat neue Ergebnisse, übersetzt, geprüft, veröffentlicht. Rückmeldungen via Notizzettel oder Kontaktformular.
Ziel: zeigen, was möglich ist – ohne zu überfordern. Die Stadt sieht kleine Schritte. Die Jugendlichen sehen: Das hier gehört in die Welt. Das Atelier bleibt: ein Fenster zwischen Lernen und Leben.
Kapitel 11: Was ich mir wünsche – Einladung an Schule, Eltern, Stadt
Ein Projekt wie dieses lebt nicht allein vom Ort, an dem es stattfindet. Es braucht Verbindungen: Schule, Familie, Umfeld. Damit aus einem Versuch ein Weg werden kann, braucht es Menschen, die mitdenken – und Strukturen, die mitwachsen dürfen.
Dieses Kapitel sammelt Wünsche. Keine Forderungen, sondern Gedanken: Was würde helfen? Was kann Schule tun? Wie können Familien unterstützen? Wie zeigt eine Stadt Teilhabe?
Verlässliche Zeitfenster und kurze Wege
Die größte Hürde war nicht das Lernen selbst – sondern oft die Organisation. Wer spricht mit wem? Wann darf entschieden werden? Genau hier braucht es Verlässlichkeit.
Zeitfenster: feste Termine für Rückmeldungen. Kein Warten ins Leere. Schon kurze Anrufe oder ein wöchentliches 20-Minuten-Fenster schaffen Klarheit.
Kurze Wege: direkte Ansprechpersonen, klare Zuständigkeiten. Entscheidungen müssen rechtzeitig fallen – bei Handouts, Präsentationen, Veröffentlichungen.
Verlässliche Kommunikation ist unsichtbar – aber entscheidend. Sie zeigt: Das Projekt ist gewollt, begleitet, abgesichert.
Räume für ruhiges Lernen
Nicht jeder Lernschritt braucht Technik. Oft genügt ein Tisch, ein Stift, ein ruhiger Ort. Deshalb braucht es ergänzende Lernräume in der Stadt:
Bibliotheken: Glossar ergänzen, Handzettel überarbeiten, in Ruhe nachdenken – mitten in der Stadt, als Teil der Gemeinschaft.
Jugendclubs/Gemeindehäuser: kleine Lerninseln, betreut, leise, ohne Druck. Zwei Plätze an einem Tisch reichen oft.
Mein Wunsch an Schule und Stadt: Bibliotheken und Jugendzentren nicht nur als Treffpunkte sehen – sondern als Partner fürs leise Lernen.
Mitmacher für behutsame Begegnung
Integration braucht irgendwann Begegnung. Aber behutsam, in kleinen Schritten. Keine Bühne, kein Druck.
Vereine: ins Atelier einladen, Storyboards ansehen.
Seniorenkreise: Interviews ermöglichen – mit Zeit und Einverständnis.
Parallelklassen: Glossar oder Handouts vorstellen – als ruhigen Austausch.
Warum diese Gruppen? Weil sie Zeit haben, anders zuhören, andere Fragen stellen – und so echtes Interesse wecken.
Die Reihenfolge zählt: Erst Ruhe, dann Begegnung. Erst Material aufbauen, dann zeigen – mit der Freiheit zu sagen: „Ich bin bereit.“ Oder: „Noch nicht.“
Mitmacher sind Partner. Sie bewerten nicht, sondern geben Rückmeldung. Ihre Aufmerksamkeit zeigt: Das, was hier entsteht, zählt.
Kapitel 12: Fazit – Mein persönlicher Schluss
Am Ende bleiben nicht nur Ergebnisse, sondern Eindrücke. Bilder im Kopf, Sätze im Ohr, Begegnungen im Gedächtnis. Zwei Wochen Praktikum – klein im Kalender, aber reich an Erfahrung.
Dieses Projekt war kein fertiges Modell, sondern ein Versuch – langsam, zweisprachig, offen. Rückblickend zeigt sich: Nicht der Plan trug, sondern die Einstellung. Nicht das Tempo, sondern das Vertrauen. Nicht die Menge, sondern die Tiefe.
Was davon bleibt, ist kein Abschluss, sondern ein Zwischenstand – ein Rückblick, um den nächsten Schritt bewusster gehen zu können.
Dieses Praktikum ist ein Versuch – aber ein guter.
Konzepte sind nie vollständig. Sie bleiben offen, wachsen mit der Praxis. Dieses Praktikum war ein solches Konzept: kein starres Modell, sondern ein Rahmen für gemeinsames Lernen im Alltag.
Es hat gezeigt: Mit klarer Struktur, zweisprachiger Unterstützung und geduldigem Tempo können Jugendliche in kurzer Zeit sichtbare, verständliche Ergebnisse erreichen. Glossare, Handouts, Storyboards, kleine Clips – greifbare Materialien, die wirken, weil sie echt sind.
Was bleibt? Die Erkenntnis, dass dieses Konzept tragfähig ist. Integration beginnt nicht in der Theorie, sondern im Alltag – mit Aufgaben, Ergebnissen und Vertrauen.
Integration beginnt im Kopf: einfache Worte, klare Bilder, Respekt.
Einfache Worte: kurze Sätze, ohne Jargon – Verständigung als Respekt.
Klare Bilder: Skizzen, Icons, Storyboards – Gleichheit trotz Sprachstand.
Respekt: Muttersprache, Lernweg, Tempo des anderen – Anerkennung statt Nachsicht.
Genau hier beginnt Integration: nicht in großen Debatten, sondern im Kopf – mit Offenheit, Bildern und gemeinsamem Grundverständnis.
Wir bleiben dran – nächster Schritt: kleiner Dreh im Innenraum.
Ein Konzept lebt nur, wenn es weitergeht. Stillstand wäre das Gegenteil von Lernen. Deshalb endet dieses Praktikum nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt: Es geht weiter.
Der nächste Schritt: ein kleiner Dreh im Innenraum. Kein großes Filmprojekt, sondern behutsame Erweiterung – Objekte, Licht, Ton. Ziel: Theorie wird Handlung, Glossar wird sichtbar, Ton wird hörbar.
„Wir bleiben dran“ bedeutet nicht vergrößern, sondern vertiefen – Schritt für Schritt, Bild für Bild.
Ich weiß: Es wird gelingen.
Am Ende bleibt die Frage: War es nur ein Versuch – oder der Anfang von etwas Tragfähigem? Für mich ist die Antwort klar: Es wird gelingen.
Nicht, weil alles glatt lief. Sondern weil Geduld, einfache Sprache, klare Bilder und Respekt Barrieren abgebaut haben. Die Jugendlichen haben verstanden, ausprobiert, gestaltet – und Eigenes hervorgebracht. Das ist mehr als Lernen. Das ist Selbstwirksamkeit.
Darum endet dieses Fazit nicht mit einem Fragezeichen, sondern mit einem Leitsatz: Ich weiß: Es wird gelingen.
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ: КОРОТКІ ДАНІ ТА ХІД ПРАКТИКИ // HANDOUT: ZAHLEN - KURZER ABLAUF
Цей роздатковий матеріал подає практику у стислому вигляді: скільки часу вона тривала, хто взяв участь, які результати були досягнуті та за якими принципами працювали. Dieses Handout fasst das Praktikum in kurzer Form zusammen: den zeitlichen Rahmen, die Teilnehmenden, die erzielten Ergebnisse und die zugrunde liegende Arbeitsweise.
Він не замінює повного опису, але дозволяє швидко скласти загальне уявлення про структуру та ключові дані. Es ersetzt keine ausführliche Beschreibung, ermöglicht aber einen schnellen Überblick über Struktur und Kerndaten.
Мета проста: зробити інформацію доступною і зрозумілою для всіх - учнів, батьків, школи та міста. Ziel ist es, die Informationen klar und zugänglich zu halten – für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schule und Stadt.
Тривалість // Zeitraum
Практика тривала два тижні, з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 15:00 год. Das Praktikum erstreckte sich über zwei Wochen, jeweils Montag bis Freitag, von 09:00 bis 15:00 Uhr.
Участники // Teilnehmende
Двоє учнів 9-го класу, рідна мова – українська. Zwei Schüler aus der 9. Klasse, deren Muttersprache Ukrainisch ist.
Результати // Output
Створено чотири навчальні артефакти (A–D), а також глосарій із понад 80 термінами. Entstanden sind vier Lern-Artefakte (A–D) sowie ein Glossar mit über 80 Fachbegriffen.
Дидактика // Didaktik
Робота побудована за принципом UA→DE, щодня – 10 нових термінів, проста мова, роздаткові матеріали у дзеркальному вигляді. Gearbeitet wurde nach dem Prinzip UA→DE, mit zehn neuen Begriffen pro Tag, einfacher Sprache und zweisprachigen Handouts in gespiegelter Form.
Безпека // Sicherheit
Жодних зйомок на вулиці чи з людьми – тільки теорія та ескізи у безпечному середовищі. Keine Außen- oder Personenaufnahmen – ausschließlich Theorie und Skizzen im geschützten Rahmen.
Abschließende Worte – Ein Ort, der bleibt
Dieses Manuskript dokumentiert kein abgeschlossenes Projekt, sondern ein pädagogisches Leitbild: die Überzeugung, dass Lernen gelingen kann, wenn Sprache, Struktur und Respekt zusammenspielen. Es zeigt, was möglich wird, wenn man Bildung nicht als Abfrage von Leistung versteht, sondern als Raum für Entwicklung – sprachlich, technisch und menschlich.
Das hier beschriebene Praktikum war ein Anfang: konkret, erfahrbar, begrenzt – aber tragfähig. Es hat Räume geöffnet, in denen Jugendliche ohne Druck lernen, gestalten und zeigen konnten, was sie verstehen. Es hat Spuren hinterlassen: auf Papier, in Köpfen, in der Stadt.
Zugleich erinnert es daran, dass solche Konzepte nicht im luftleeren Raum entstehen. Sie sind eingebettet in gesellschaftliche Realitäten – mit Spannungen, Unsicherheiten und Widerständen. Die Brandanschläge in Loitz im September 2025 haben dies deutlich gemacht. Sie richteten sich nicht nur gegen Schutzräume, sondern auch gegen Integration: gegen Teilhabe, Offenheit, Sichtbarkeit.
Doch genau deshalb braucht es Projekte wie dieses – als Einladung zu etwas Besserem. Kein Widerstand, keine Gegenwehr. Sondern ein Zeichen, dass Zugehörigkeit möglich ist. Und gewollt.
Dass dieser Ansatz weitergedacht werden muss, steht außer Frage. Eine tiefergehende Einbindung ins schulische Curriculum – etwa über Niveaustufen, Leistungsrückmeldung oder Anschlussfähigkeit – bleibt noch offen. Auch die Zielgruppenzuordnung (BVJ, Sprachförderklasse, Regelpraktikum) könnte konkreter ausdifferenziert werden, um Wiederholbarkeit und Transfer zu erleichtern. Und obwohl die öffentliche Sichtbarkeit (z. B. Website, Schaukasten) überzeugend beschrieben ist, fehlt bislang eine systematische Reflexion oder Evaluation ihrer Wirkung.
Diese Aspekte gilt es im nächsten Schritt einzuholen. Doch sie relativieren nicht, was erreicht wurde – im Gegenteil: Sie zeigen, dass dieses Projekt Potenzial trägt. Und dass es sinnvoll ist, darauf aufzubauen.
Denn Integration beginnt nicht in der St