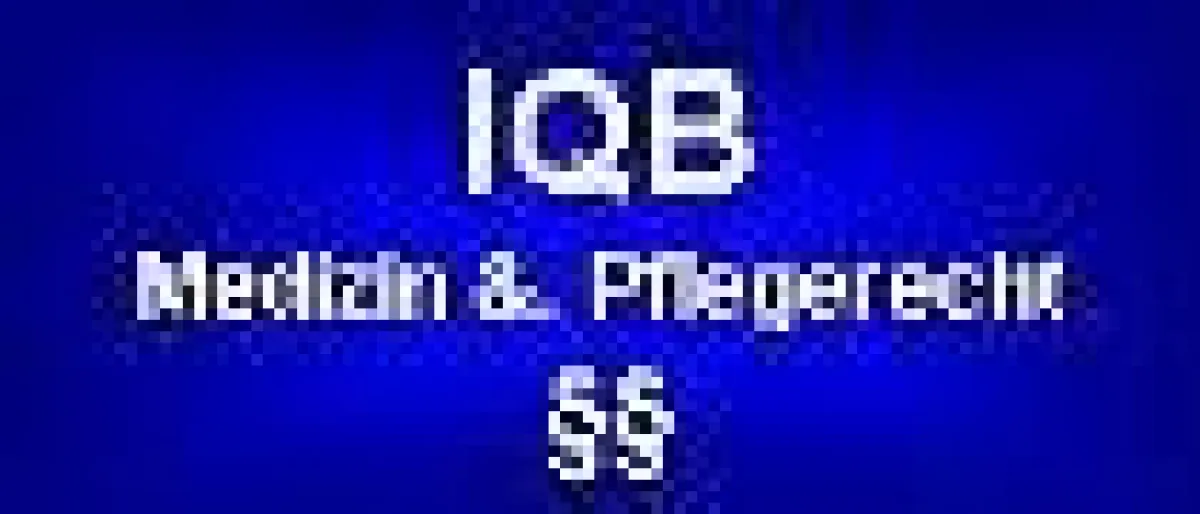(openPR) In der Diskussion um die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen rückt zunehmend die Gruppe der Demenzpatienten in den Blickpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Nicht selten wird hierbei der grammatikalische Wortlaut einer Patientenverfügung durch beliebige Interpretationsversuche der Adressaten dieser Verfügung in Zweifel gezogen. Man/frau begibt sich auf die Suche des wirklichen Willens des Patienten und hierbei wird unblässlich betont, dass auch Demenzkranke mit ihrer Krankheit ein lebenswertes Leben haben. Dies zu betonen, ist weder notwendig noch löst diese Selbstverständlichkeit die mit der Patientenverfügung eines Demenzkranken verbundenen Problemlagen. Der „Umgang mit den Patientenverfügungen eines Demenzkranken“ ist wenig spektakulär: die Patientenverfügung ist verbindlich und entbindet grundsätzlich etwa den Arzt oder die Pflegenden von ihrer selbst auferlegten Verpflichtung, sich auf die Suche des Willens des Demenzpatienten zu begeben, wenn und soweit dieser dokumentiert ist. Die Willenserklärung eines späteren Demenzpatienten in einer Patientenverfügung ist selbstverständlich der Auslegung zugänglich und in diesem Sinne können mögliche Auslegungsschwierigkeiten durch eine salvatorische Klausel sui generis sachgerecht begegnet werden. Es erscheint in Anbetracht der Komplexität der vielfältigen Geschehensabläufe nicht zwingend notwendig, jeden der denkbaren Einzelfälle im Voraus aufzulisten und zum Gegenstand einer Patientenverfügung zu erheben. Mit einer salvatorischen Klausel sui generis kann der spätere Patient ggf. die spätere Auslegung durch Dritte dergestalt präjudizieren, als dass sich aus ihr der hinreichend bestimmte Wille des Demenzpatienten durch entsprechende Interpretationsvorgaben ergibt. Mit einer solchen Klausel in der Patientenverfügung wird der Interpretationsspielraum Dritter bei einer im Zweifel gebotenen Auslegung resp. Interpretation der Patientenverfügung weitere entscheidungserhebliche Grenzen gesetzt; dies gilt freilich auch gegenüber einem ärztlichen Paternalismus als auch gegenüber dem höchst bedenklichen Beurteilungsmaßstab, wonach im Zweifel die „allgemeinen Wertvorstellungen“ eine Berücksichtigung finden sollen.
Auch wenn üblicherweise die sog. salvatorische Klausel im klassischen Vertragsrecht zur Anwendung gelangt, kann der damit verbundene Rechtsgedanke für die Patientenverfügung und ihrer späteren Auslegung durchaus fruchtbar gemacht werden. Gerade weil vielfältige Krankheitsprozesse als auch das „Sterben“ und damit ggf. auch der „psychische Tod“ als natürliche Geschehensabläufe nicht einer „Normierung“ im engeren Sinne zugänglich sind, sollte der Verfügende eine Lösung anstreben, wonach auch bei entsprechenden „Lücken“ der von ihm vorausverfügten Rechtshandlung (hier das Unterlassen einer im Zweifel in dubio pro vita resp. dignitate geboten Heilbehandlung) die Einwilligungserklärung keinen erheblichen Zweifel an ihrer Intention aufkommen lässt. Das Selbstbestimmungsrecht beinhaltet exklusiv die Möglichkeit, in Patientenverfügungen Regelungen resp. Anweisungen zu treffen, die insbesondere dem übergeordneten Ziel dienen, dass der von dem Verfügenden verfasste Wille auch tatsächlich umgesetzt wird.
Lutz Barth