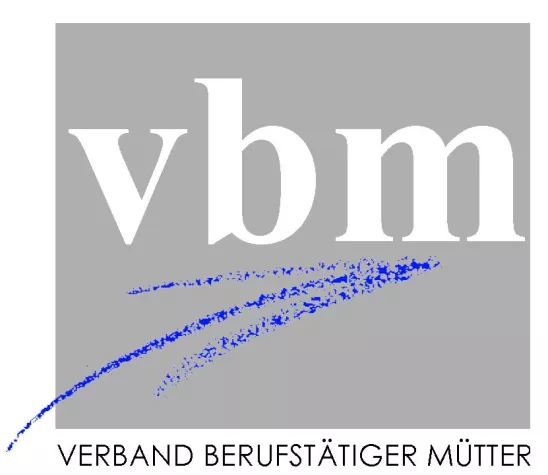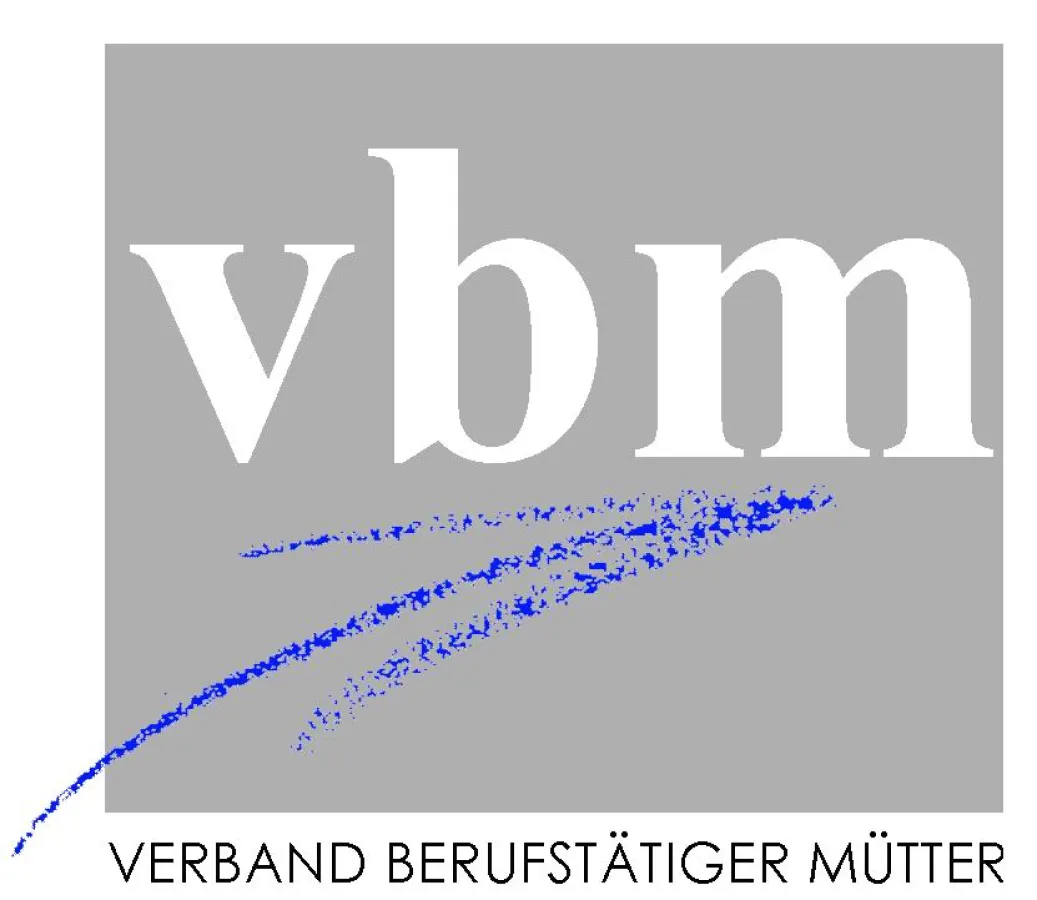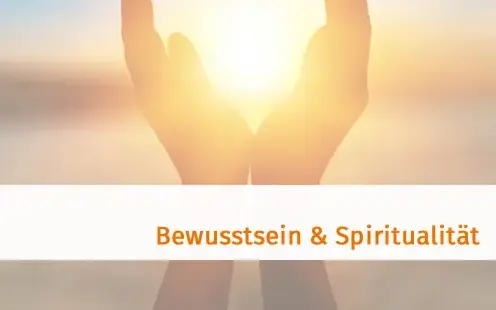(openPR) Auf der Klausurtagung der Bundesregierung vom 9./10. Januar 2006 wurden zur Förderung der Familien mit dem Fokus der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtige Beschlüsse gefasst. Damit soll – so das Positionspapier des Kabinetts – Deutschland eines der familienfreundlichsten Länder werden.
Einkommensabhängiges Elterngeld, Ausbau der Kinderbetreuungs- Infrastruktur sowie eine bessere steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten werden seit langem vom vbm gefordert. Aus diesem Grund begrüßt der vbm die Genshagener Beschlüsse als ersten Schritt in die richtige Richtung. Speziell an der Abzugsfähigkeit von Betreuungskosten entzündet sich allerdings Kritik.
Gerade die Berufstätigkeit von Müttern und die damit langfristige Existenzsicherung der Familie darf nach Meinung des vbm nicht länger ein kostspieliges Privat-Vergnügen für solche Familien sein, denen keine subventionierte öffentliche Betreuung zur Verfügung steht.
Mangelhafte Kinderbetreuungsinfrastruktur
Da Kinderbetreuungskosten bislang nur bis zu einem Betrag von € 1.500 pro Jahr steuerlich abzugsfähig sind, sind diejenigen Eltern überproportional belastet, die in einem höheren Umfang berufstätig sind und daher mehr Betreuungsbedarf haben als bei Verzicht eines Elternteiles auf Erwerbstätigkeit. Aufgrund der unterschiedlich stark öffentlich subventionierten Kinderbetreuungsangebote, insbesondere bei den unter Dreijährigen kommt hinzu, dass - sofern ein öffentlich geförderter Platz nicht zur Verfügung steht (immerhin ca. 90 % bis 95% im Westen Deutschlands) die tatsächlichen Kosten (bei einer privat-gewerblichen Einrichtung z.B. ca. EURO 900 für einen Vollzeitplatz pro Monat) überwiegend aus dem Nettoeinkommen bestritten werden müssen. Zum Vergleich: Eine Tagesmutter kostet – sofern verfügbar, vertrauenswürdig etc. - pro Monat ca. Euro 600 bis 800 für eine Vollzeitbetreuung. Um das finanzieren zu können, müssen unter Berücksichtung von Steuern und Sozialabgaben erst mal rund EURO 1.000 bis EURO 1.200 brutto (bei Steuerklasse VI und unter Berücksichtigung der derzeit begrenzten steuerlichen Absetzbarkeit von EURO 1.500 pro Jahr) monatlich verdient werden – bis zu diesem Betrag ist noch nichts für den eigenen Lebensunterhalt bzw. kein Beitrag zum Familieneinkommen verdient!
Absetzbarkeit erwerbsbedingter Aufwendungen
Hält man dagegen, dass beispielsweise die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch dann vom ersten Euro an als Werbungskosten berücksichtigt werden können, wenn das private Wohneigentum in einer idyllisch-schönen Lage weitab vom Arbeitsplatz liegt, die erwerbsbedingten Kinderbetreuungskosten dagegen nur sehr eingeschränkt als sog. außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind, wird schnell deutlich, dass dem Gerechtigkeitsempfinden des Einzelnen bereits nach der momentanen Rechtslage in vielerlei Hinsicht Vorschub geleistet wird. Deutlich wird auch, dass es unter ökonomischen Gesichtspunkten beispielsweise in der Ehe aktuell für den zweiten Partner kaum lohnt, berufstätig zu bleiben. Oder sollte nicht langsam doch der Ansporn für eine eigenständige Existenz- und Altersvorsorge von Frauen Berücksichtigung finden?
Relationen
Nicht zuletzt sollte mit Fokus der Genshagener Beschlüsse das Augenmerk auf die Relationen gestattet sein. Der für die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten eingeplanten Betrag von EURO 460 Millionen ist gering im Vergleich zu jährlich gut 36 Milliarden Euro Kindergeld, 25 Milliarden Euro kommunaler Kita-Kosten, 19 Milliarden Euro für beitragsfreie Kinderkrankenversicherung.
Diese vielen Milliarden nützen gar nichts, wenn Mütter mangels Kinderbetreuungsinfrastruktur keinen Job annehmen können bwz. weil sie netto gar nicht so viel verdienen können, wie sie brutto für Kindergarten und/oder private Kinderbetreuung bezahlen müssen.
Position
Daher erscheint es aus Sicht des vbm im Moment vertretbar, einen Grundbetrag als Eigenanteil der Familien – unabhängig von der Höhe der öffentlichen Förderung – bestehen zu lassen und gerade diejenigen zu entlasten, die in Ermangelung ausreichend öffentlicher Plätze aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit auf privat-gewerbliche Betreuung angewiesen sind. Durch ihre Erwerbstätigkeit zahlen diese Eltern darüber hinaus mehr Steuern und z.B. höhere Elternbeiträge in öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Der Schritt in die richtige Richtung ist mit den Genshagener Beschlüssen gefasst: Die Beschlüsse sollten umgesetzt werden, bevor sich die Diskussion um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit der geplanten Maßnahmen zur Förderung erwerbstätiger Eltern vollends im Gewirr der Vielzahl ganz anderer Ansprüche z.B. sozial- und bildungspolitischer zerredet wird. Der vbm ist dabei – damit Deutschland familienfreundlich wird und Berufstätigkeit nicht ein Privileg (gut ausgebildeter) Männer bleibt!