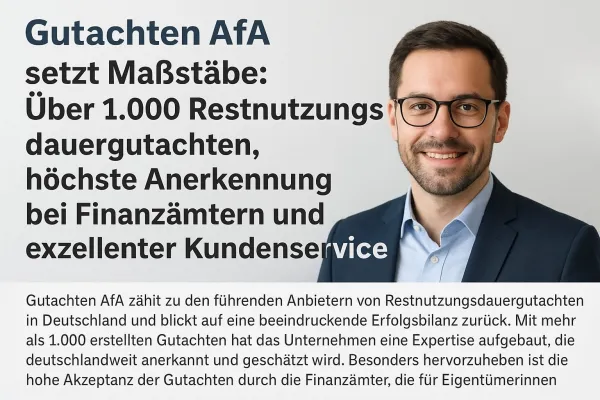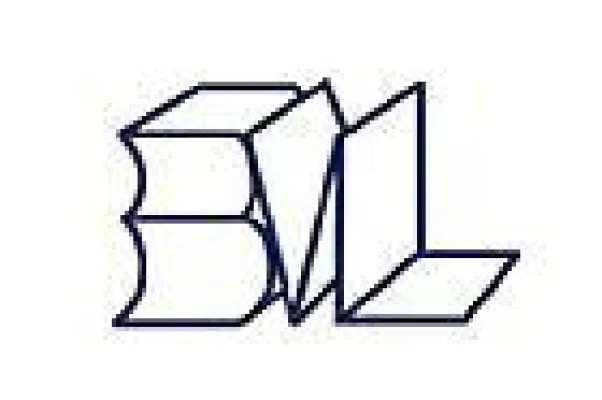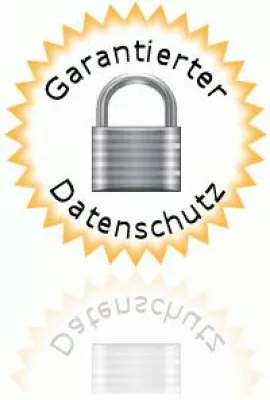(openPR) Der Verfassungsrechtler Professor Rüdiger Zuck aus Stuttgart weist in einem Gutachten dem Kindergartengesetz in Baden-Württemberg Mängel nach. Eine vorrangig wohnortbezogene Bedarfsplanung der Kommunen widerspreche der Verfassung. Der Bedarf als normative Größe sei auch unter Berücksichtigung von Kriterien wie Arbeitsplatznähe und pädagogischer Ausrichtung der Einrichtungen zu ermitteln. Wohnortkinder sowie gemeindefremde Kinder seien gleich zu behandeln und deren Plätze in gleicher Weise zu fördern.
Stuttgart – Nicht nur in Baden-Württemberg ist das Alltag: Eltern können ihre Kinder nicht in der Nähe ihres Arbeitsplatzes betreuen lassen, weil sie in einer anderen Gemeinde wohnen. Die gewünschte Betreuungskommune verweigert die Zuschüsse für den benötigten Platz. Die Wohngemeinde bietet den Eltern eigene Betreuungsplätze und möchte daher den Förderbetrag auch nicht übernehmen. Die so erzwungene Betreuung am Wohnort entspricht jedoch häufig nicht den Wünschen und Bedürfnissen der Familien. Dürfen Städte und Gemeinden sich den schwarzen Peter gegenseitig zustecken? Können Eltern genötigt werden, Betreuungsplätze am Wohnort zu nutzen, selbst wenn sie ihren Arbeitsplatz dadurch gefährden oder den Umfang der Erwerbsarbeit einschränken müssten?
Kindergartengesetz in Baden-Württemberg nicht verfassungskonform
Das neue Kindergartengesetz in Baden-Württemberg vom 14. Februar 2006 schafft für dieses Vorgehen der Kommunen die Grundlage. In anderen Bundesländern, wie Bayern, Hessen oder Niedersachsen, ist die Gesetzeslage ähnlich. Der Stuttgarter Verfassungsrechtler Professor Rüdiger Zuck bezweifelt jedoch in einem neuen, nicht auf konkrete Fälle bezogenen Grundlagengutachten zur Situation in Baden-Württemberg, das er im Auftrag des Kind e.V.-Dachverbands erstellte, die Rechtmäßigkeit dieser Regelungen. „Die Kommunen müssen eine Bedarfsplanung machen. Die darf sich aber nicht nur an Nachfragegesichtspunkten orientieren, sondern muss die Interessen von Familien und Kindern generell in den Blick nehmen“, erklärt Zuck. „Die Gemeinde muss dem Bedarf Rechnung tragen, der entsteht, wenn Eltern in Ausbildung oder beide erwerbstätig sind.“ Das zwinge sie dazu, auch in Gewerbe- und Industriegebieten von einem Bedarf auszugehen. Dabei sei es unerheblich, ob es sich bei den Nachfragern um Kinder aus der eigenen Kommune, einer anderen Gemeinde oder aus einem anderen Stadtbezirk handele. „Kita-Plätze, die sich aus einem gemeinde- bzw. stadtteilübergreifenden Bedarf ergeben, müssen mit denen gleichgestellt sein, die von Wohnortkindern benötigt werden“, betont der Rechtswissenschaftler.
Grundlagen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schaffen
Das Bundesverfassungsgericht erklärte bereits 1993, dass der Staat verpflichtet sei „Grundlagen dafür zu schaffen, dass Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können und die Wahrnehmung der familiären Betreuungsaufgabe nicht zu beruflichen Nachteilen führt.“ Die fußläufige Erreichbarkeit der Einrichtung vom Wohnort aus, hat keinen Vorrang vor anderen für die Eltern wichtigen Kriterien wie Arbeitsplatznähe oder auch die pädagogische Ausrichtung der Kindertagesstätte. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte den im Sozialgesetzbuch VIII verwendeten Begriff des „sozialen Umfelds“ als nicht auf Kontakte im Bereich der Wohnsitzgemeinde beschränkt und merkte an, dass daraus kein überwiegendes Gewicht der Ortsnähe abzuleiten sei. „In der Bedarfsplanung muss deshalb das Vorhandensein von arbeitskräfteintensiven Betrieben und die damit verbundene Nachfrage nach Kitas unabhängig vom Wohnsitz der Eltern eingestellt werden“, erklärt Zuck. „Pendler haben unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Gleichrang mit Wohnortkindern und müssen auf die gleiche Weise gefördert werden.“
Wer bezahlt?
„Die Berufstätigkeit von Eltern darf nicht daran scheitern, dass Kinder nicht betriebsnah betreut werden können“, sagt Peter Sauber. Er ist Vorstand des Kind e.V.-Dachverbandes, dem freie Trägervereine angehören, deren erklärtes Ziel es ist, mit ihren Einrichtungen auf einer Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzuwirken. „Das Gutachten bringt grundsätzliche Klarheit darüber, dass Betreuung nicht aufgrund der Tatsache verweigert oder nicht gefördert werden darf, dass eine Familie außerhalb der betreuenden Kommune wohnt.“ Zur speziellen Situation in einzelnen Städten oder Gemeinden sowie zur Finanzierung der Förderung sei damit jedoch keine Aussage gemacht. „Wir brauchen auf jeden Fall einen funktionierenden Finanzausgleich unter den Kommunen. Sonst wären Städte wie z.B. Stuttgart, die eine gut ausgebaute und hoch geförderte Betreuungsinfrastruktur betreiben und deren Umlandgemeinden häufig ein deutlich weniger attraktives Angebot vorhalten, benachteiligt. Aus unserer Sicht sollten sich jedoch auch die Länder und der Bund, die mittelfristig die Hauptnutznießer guter Betreuung und Bildung sind, stärker an den laufenden Kosten beteiligen. Das könnte auch den Finanzquerelen unter den Kommunen die Spitze nehmen.“
Platzmangel darf nicht durch Ablehnung von „Pendlerkindern“ entschärft werden
Das Gesetz lässt den Kommunen noch bis 2010 Zeit, um ihr Betreuungsangebot für unter Dreijährige dem (normativen) Bedarf entsprechend auszuweiten. Dies muss in jährlichen, nachweisbaren Ausbaustufen geschehen und kann nicht bis zuletzt aufgeschoben werden. Bei der Verwaltung des Mangels verfahren Kommunen heute vielfach so, dass Kinder aus der eigenen Gemeinde zunächst und bevorzugt mit Plätzen versorgt werden. Auch dieses Vorgehen ist nicht verfassungskonform und daher unzulässig. „Angebotslücken müssen zu Lasten aller Kinder geschlossen werden“, unterstreicht Zuck in seinem Gutachten.
eoscript Public Relations
Eike Ostendorf-Servissoglou
Kaiserstuhlweg 3
70469 Stuttgart
Tel.: 0711- 5530946
Mobil: 0172-7032745
E-Mail: