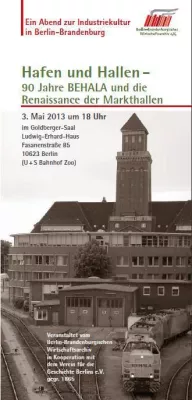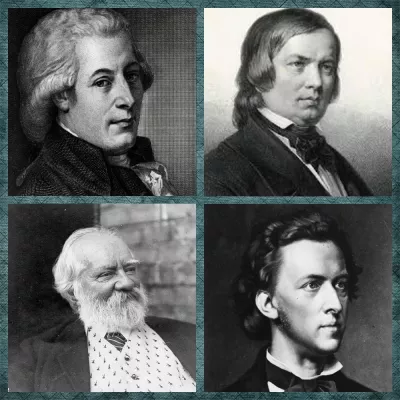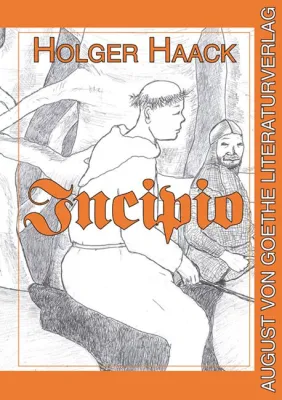(openPR) Der 48. Ehrenbürger der Stadt Berlin und seine verborgene Ruhestätte
Berlin im September 2008 (VfdGB). Albert Haack starb am 14. März 1906 in seinem Geburtshaus am Schiffbauerdamm 26 und wurde auf der Familiengrabstätte des Kirchhofs Sophien II in Berlin-Mitte, Bergstraße beigesetzt. In einem Nachruf in der Vossischen Zeitung vom 15. März 1906 hieß es: ... „Mit ihm ist einer der liebenswürdigsten und beliebtesten Männer Berlins, dahingegangen, auf den das Wort passte Die Berliner sind besser als ihr Ruf.“ Martin Mende vom Verein für die Geschichte Berlins, gegr. 1865, hat jetzt seine verborgene Ruhestätte wiederentdeckt.
Eine Ernennung zum Ehrenbürger ist seit fast 200 Jahren die bedeutendste Auszeichnung der Stadt Berlin. Mit der Ehrung für Wolf Biermann 2007 weist die Liste der Ehrenbürger nunmehr 115 Persönlichkeiten auf. Nahezu die Hälfte stellen Politiker und Militärs, den Rest teilen sich Kommunalpolitiker, Künstler und Wissenschaftler. Von 1900 an war auch eine Tendenz feststellbar, das Ehrenbürgerrecht an verdiente Personen der städtischen Körperschaften zu verleihen. Häufig erfolgte die Ehrung , wenn Personen aus dem Dienst ausschieden oder ein hohes Dienstjubiläum feiern konnten. So geschah es auch für den am 31. Dezember 1904 aus seinem Amte scheidenden ehrenamtlichen Stadtrat Albert Haack.
Albert Haack wurde am 20. September 1832 in Berlin im Hause Schiffbauerdamm 26 als Sohn eines Holzkaufmanns geboren. Nach dem Besuch des Friedrichswerderschen Gymnasiums und einem Jurastudium in Heidelberg und Berlin war er als Referendar im Justizdienst tätig, musste aber 1859 nach dem plötzlichen Ableben des Vaters seine Vorbereitungen für die Große Staatsprüfung abbrechen, um zusammen mit seinem Bruder das väterliche Holzhandelsgeschäft weiterzuführen. Schon früh begann er seine immer umfangreicher werdende ehrenamtliche Tätigkeit, ab 1862 als Schiedsmann, ab 1867 als gewählter Stadtverordneter, ab 1869 als unbesoldeter Stadtrat und Mitglied der Gewerbedeputation. Nach der 1808 erlassenen Städteordnung arbeitete in Berlin ein Magistrat als Stadtregierung und setzte sich damals aus besoldeten und unbesoldeten, von der Stadtverordnetenversammlung gewählten Stadträten zusammen. Im Range standen die unbesoldeten den besoldeten Kollegen gleich. Zudem wurden für einzelne Infrastruktureinrichtungen spezielle Deputationen als grundlegende Verwaltungsgremien geschaffen. Haack wechselte schon bald in die Deputation für die Wasserversorgung und übernahm nach kurzer Zeit den Vorsitz. Diese Deputation entschied über die Investitionsvorhaben und die Tarife und setzte sich aus drei Stadträten, fünf Stadtverordneten zwei Bürgerdeputierten und einem Magistrats-Assessor zusammen. Die Direktoren der Wasserbetriebe hatten die technische Leitung zu verantworten. Instruktionen der Stadtverordnetenversammlung legten das Rechtsverhältnis zwischen Deputation und Direktoren fest und sicherten den Einfluss der politischen Organe der Kommune. Der Übergang der von einem englischen Konsortium gegründeten Wasserbetriebe am Stralauer Tor auf die Stadt Berlin im Jahre 1873 war nicht zuletzt ein Erfolg von Albert Haack. Nacheinander setzte er sich danach für die neuen Wasserwerke in Tegel und am Müggelsee ein. Unter ihm begann die Umstellung von der Lieferung gefilterten Oberflächenwassers auf die Förderung von Grundwasser, lediglich im Wasserwerk am Müggelsee wurde neben der Grundwassergewinnung die Seewasserentnahme beibehalten. Durch die Einführung von Wasserzählern konnte der Wasservergeudung wirksam begegnet werden.
Obwohl Albert Haack ab 1872 allein sein Holzhandelsgeschäft weiterführen musste, engagierte er sich neben den bereits beschriebenen Tätigkeiten in der Leitung verschiedener wohltätiger Stiftungen, z. B. des Kuratoriums der Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg. Die von 1884 bis 1886 errichteten Neubauten der Stiftung in Wedding, Reinickendorfer Straße 59, stehen unter Denkmalschutz und werden heute als Seniorenheim genutzt.
Wolfgang Wehmeyer in Berlin-Spandau ist der Urenkel von Albert Haack und bemüht sich seit Jahrzehnten, die Erinnerung an diesen verdienstvollen Vorfahren wach zu halten. Er setzte es schließlich durch, dass 1964 die Haackzeile in Spandau unweit des Wasserwerkes nach seinem Urgroßvater benannt wurde. Die Grabstätte Haack wurde bis 2005 in der Liste der Ehrengrabstätten für Ehrenbürger geführt. Nach den Bestimmungen werden Grabstätten von Verstorbenen, denen das Ehrenbürgerrecht Berlins verliehen worden ist, ohne besonderes Anerkennungsverfahren und ohne zeitliche Begrenzung als Ehrengrabstätten anerkannt. Tatsächlich war die Grabstätte aber nicht mehr auffindbar und die Kirchhofsverwaltung sah sich durch das Fehlen eines Übersichtsplanes der früher vorhandenen Erbbegräbnisse auch nicht in der Lage, den Ort auch nur annähernd zu bestimmen.
Nach der schriftlichen Bestätigung der Kirchhofsverwaltung an die Senatskanzlei im Jahre 2005, die Grabstätte Haack sei bereits zu DDR-Zeiten geräumt worden zugunsten von Urnenwahlgrabstätten, eine Neuanlage sei daher nicht mehr möglich, wurde die Ehrengräberliste berichtigt.
Durch ein altes Foto im Besitz von Herrn Wehmeyer und einem Plan des Kirchhofes Sophien II im IV. Teil von Wohlberedts Verzeichnis der Grabstätten konnte die Grabstelle des Albert Haack an der Mauer des Kirchhofes zur Bergstraße nun wieder eindeutig lokalisiert werden. Auf dem Areal des ehemaligen Erbbegräbnisses wurden an den Seiten bereits von 1955 an Urnengrabstellen vergeben, unter dem mittleren Teil mit einem breiten Weg liegt aber weiterhin die Grabstelle des Ehrenbürgers. Sämtliche früher vorhandenen Metalltafeln an der Backsteinrückwand fehlen und auch der Grabstein von Albert Haack ist nicht mehr vorhanden. Lediglich der Fundamentstein ragt etwas aus dem Boden hervor.
Mit der fortdauernden Existenz des Grabes ist die Stadt Berlin in der Pflicht, für ein würdiges Aussehen der Grabstätte zu sorgen. Der gesamte Kirchhof Sophien II steht unter Denkmalschutz. Am 12. August 2008 hat Herr Mende beim Bezirksamt Mitte, Amt für Planen und Genehmigen, Fachbereich Denkmalschutz, einen Antrag mit diversen Unterlagen eingereicht. Die Senatskanzlei hat mit Schreiben vom 15. August 2008 Kenntnis von der Wiederauffindung des Ehrengrabes erhalten und ist als zuständige Behörde aufgerufen, die weiteren Maßnahmen zu koordinieren. Da die Sanierung der gesamten Kirchhofsmauer zur Bergstraße ansteht – die Finanzierung ist bisher nicht gesichert – werden sich unter Umständen Verzögerungen ergeben. Unabhängig davon könnte aber bereits die Grabstelle wieder eine Fassung erhalten und den Hinweis auf ein Ehrengrab bekommen. Über die weitere Form der Erinnerung, neuer Grabstein oder eine Tafel an der Mauer, sollte im Einvernehmen mit dem Urenkel Wolfgang Wehmeyer entschieden werden.
Wer die Liste der 115 Berliner Ehrenbürger anschaut, wird kaum einen Menschen finden, der sich über einen so langen Zeitraum für unser Gemeinwesen in so uneigennütziger Weise eingesetzt hat. Sein lebenslanger Wohnort am Schiffbauerdamm 26 in der Nähe der Marschallbrücke am Nordufer der Spree ist heute durch das mächtige Marie-Elisabeth-Lüders-Haus überbaut und bietet leider keine Möglichkeit für eine Gedenktafel. Es bleibt die Grabstätte. Und weil vorher viel von Wasser die Rede war: Die Spree ist nicht jener mystische Fluss Lethe, dessen Wasser alles Erinnern auslöscht.